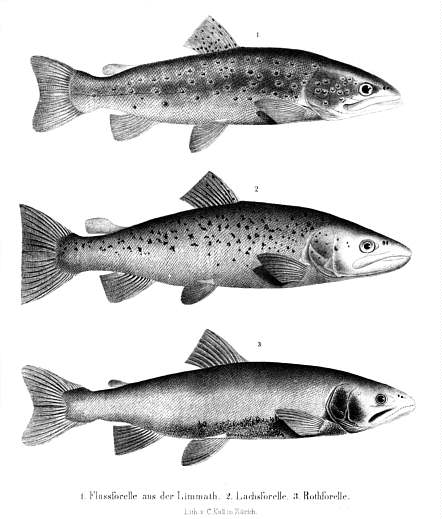An die Zürcherische Jugend auf das Jahr
1847, IL. Stück, 7 S., 1 Lithographie
von der Naturforschenden Gesellschaft
"Die Forellen" von Hch. Rud. Schinz
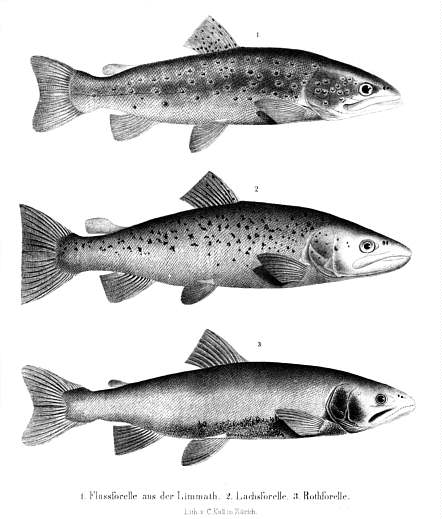
Lithographie von C. Kull Zürich,
Druck/Kunstdruck Mahler und Weber Zürich
Very Short Version
|
Ueber die Fische unserer Seen und Flüsse.
Unter die wichtigsten Produkte des Thierreichs, welche die Schweiz
überhaupt und besonders der Kanton Zürich liefert, gehören
die Fische. Zürich hat verhältnismässig seiner Größe
eine bedeutende Menge Gewässer, welche alle mit Fischen bevölkert
sind, die durch ihren Fang und Verkauf mancher Familie einen ordentlichen
Erwerb verschaffen. Eine nähere Bestimmung dieser Thiere und ihrer
einzelnen Wichtigkeit mag daher allgemeines Interesse haben, da die darüber
geschriebenen Werke wohl dem Kreise, welchem diese Blätter gewidmet
sind, weniger bekannt sein können.
Wenn auch die Fische bei uns nicht zu den nothwendigsten Lebensbedürfnissen
gehören, so sind sie dennoch im Allgemeinen aller Beachtung werth,
da sie vielen Millionen Menschen zur Hauptnahrung dienen und ihr Fang viele
Hunderttausende beschäftigt. Die Natur hat dafür gesorgt, daß
alle salzigen und süßen Gewässer in allen Klimaten, unter
jeder Temperatur, unter dem Aequator wie in der Nähe der Pole von
Fischen bewohnet sind; denn diese kaltblütigen Thiere hängen
wenig von der Temperatur der Klimate ab. Wir sehen, daß viele Seen
unserer Alpen, welche Dreiviertel des Jahres gefroren sind die schmackhaftesten
Forellen beherbergen, wenn sie nur einen Ausfluß haben. Alle ins
Eismeer fließenden Flüsse enthalten Fische, welche den Bewohnern,
da wo jede Pflanzennahrung fehlt, hinlängliche Nahrung liefern. Man
rechnet, daß jährlich tausend Millionen Heeringe und viele Millionen
Stockfische in den nordischen Meeren gefangen werden, und mehrere hundert
Schiffe auf ihren Fang ausgehen. Die Zahl der bekannten Fische mag sich
auf 6 bis 7000 belaufen, und vielleicht eben so viele bewohnen die unergründlichen
Tiefen der Meere. Von dieser großen Menge enthalten die süßen
Wasser nur eine kleine Zahl und nur wenige Familien, und selbst von den
Bewohnern der süßen Gewässer Europas fehlen viele den Seen
und Flüssen unsers Kantons, und keiner unserer Fische prangt mit den
reinen und glänzenden Farben von Roth, Grün, Gelb, Blau, dem
reinen Gold und Silber, mit welchen die Fische der heißen Zone so
vielfach geschmückt sind, daß sie mit den schönsten Kolibris
wetteifern können. Auch ist die Zahl der einzelnen Individuen, so
groß sie auch ist, doch nicht mit den unermeßlichen Schaaren
zu vergleichen, welche die Meere bewohnen, aber dennoch ist sie erstaunenswürdig.
Wie viele Zentner Heuerlinge werden jährlich auf dem Markte allein
verkauft, und wie viele tausende zählt nicht ein Zentner, und dennoch
nimmt ihre Zahl nicht ab, obschon gewiß noch viel mehr als unsere
Fischer fangen, von Hechten, Forellen und andern Raubfischen verschlungen
werden. Man kann sich dieses nur dadurch erklären, daß 100,000
Eier fast die geringste Zahl zu sein scheint, welche ein Weibchen oder
Rogener jährlich von sich gibt. Man berechnet die Zahl der Eier einer
Karpfe auf ungefähr 340,000, einer Schleihe auf 380,000, die eines
Barsches (Rechlings) auf 280,000 und diejenige eines Störs gar auf
150,000,000. Würden alle diese Eier aufkommen und keine zu Grunde
gehen, so würden nach gemachten Berechnungen alle Gewässer die
Menge nicht fassen und durch die Menge der Leichname, da es an Nahrung
gebrechen müßte, selbst das Meer in faulende Gährung übergehen.
Allein bei weitem nicht alle diese Eier werden befruchtet, sehr viele werden
von Wasservögeln und andern Fischen gefressen, und tausende der aufkommenden
kleinen Fische werden andern zur Beute. Die meisten Fische sind Raubfische
und zum Wohle des Ganzen herrscht in den Gewässern ein ewiger Krieg,
ja die Eltern fressen ihre eigenen Kinder und der Tod von Millionen bedingt
das Leben anderer Millionen. |
Hauptnahrung für uns sind aber die Fische nicht, im Gegentheil
hangt der Ertrag bei uns mehr vom Luxus ab, da nur die Reichern gewöhnlich
Fische essen, der Landmann aber nicht, da wir keine Fastenzeit haben. Deswegen
finden auch die schlechtern Fische fast keine Käufer und kommen nur
selten auf den Markt, die bessern aber sind immer theuer und die Fischer
legen sich mehr auf ihren Fang. Dahin gehören Lachse, Lachsforellen,
Forellen, Röthlinge, Aale, Aeschen und Trüschen. Von geringerem
Werth und doch vortrefflich sind die ungefleckten Salme oder Felchen, wozu
der sogenannte Bratfisch oder Blauling, die Albulen und Heglinge gehören.
Der letzte Fisch war früher so beliebt, daß nur die hohe Aristokratie
ihn zu essen bekam, da man ihn nicht verkaufen durfte, bis den sogenannten
Herren Seevögten eine gewisse Menge zugetheilt war. Hechte, Barsche
(Rechlinge) und Karpfen werden auch noch geschätzt, gemein aber sind
Alete, Brachsmen und Nasen, Schleien, Rottelen, Schwalen und die kleinen
Arten der Karpfenfamilie.
Die erste genauere Angabe über unsere Fische finden wir in einem
Werke, betitelt: Beschreibung des Zürichsees, von Hans Erhard Escher.
Zürich 1692. Die noch genauere Bestimmung aber fällt erst in
die neuere Zeit. Sehr gut sind alle Fische unsers Sees mit ihren gemeinen
Namen von einem Herrn Melchior Füßli 1709 in Oel gemalt worden
und diese Originaltafeln hängen noch jetzt auf dem Rathhaus. Sie wurden
von einem Johannes Simmler in Kupfer gestochen, sind aber nicht mehr zu
kaufen.
Manche glauben, die Menge der Fische habe seit der Einführung
der Dampfschifffahrt abgenommen und man behauptet dieses allgemein, wo
Dampfschiffe vorhanden sind, allein es scheint dies bei genauerer Untersuchung
nicht der Fall zu sein. Ausfüllungen und Veränderungen im Laufe
der Gewässer haben den Aufenthaltsort einiger Fische verändert.
So sind z. B. die Karpfen, welche früher nahe an der Stadt häufig
und groß vorhanden waren, durch Ausfüllung eines Theils ihres
Aufenthalts verdrängt worden und ganz verschwunden, so daß sie
jetzt nur noch in den sumpfigen Untiefen bei Rapperschweil vorhanden sind.
Im Greifensee, Pfäffikersee, Katzensee, Metmenhaslersee, Widensee
und Türlersee dagegen finden sie sich noch, auch in der Glatt.
Obschon die Fischerei an und für sich keine beschwerliche Arbeit
ist, so wird sie es durch die begleitenden Umstände, und der Fischer
muß seinem Beruf bei Tag und bei Nacht, bei Regen und Schnee, im
Sommer und Winter nachgehen. Wohlhabendere Leute treiben daher die Fischerei
selten, als etwa zum Zeitvertreib mit der Angelruthe, wozu es aber viel
Zeit und Geduld erfordert. Nur die Engländer sind leidenschaftliche
Angler, und fast alle, welche zu uns kommen, haben vollständige Fischergeräthschaften
bei sich und fischen, wo nur immer Wasser ist. Selbst ihre berühmtesten
Männer, wie Nelson und Byron, sollen leidenschaftliche Angler gewesen
sein.
Die Fischer, welche natürlich alle Eigenschaften der Fische kennen
sollten, werfen sich gar oft zu Wetterpropheten auf und finden großen
Glauben. Allein nur selten und zufällig treffen ihre Voraussagungen
ein. Fischer und Jäger könnten allerdings durch genaue Beobachtungen
wohl im Stande sein, aus gewissen Erscheinungen im Thierreich sich Kenntnisse
der künftigen Witterung auf längere Zeit zu verschaffen, wenn
dieß überhaupt möglich ist, aber sie sind, wenigstens bei
uns, keine genauen Beobachter, und meistens in Vorurtheilen und Aberglauben
befangen, daher haben ihre Voraussagungen keinen sichern Grund, und die
Erfahrung lehrt, daß häufig das Gegentheil dessen eintritt,
was sie prophezeiet haben. Würde es ihnen nach gehen, so würde
der Zürichersee alle Jahre gefrieren, was doch glücklicher Weise
nur ungefähr alle zehn Jahre geschieht.
Wir haben in unsern Flüssen, Bächen und Seen nur ein und
dreißig Arten Fische, welche in folgende Familien gehören. Barschartige:
nur eine Art, der Flußbarsch (Rechling). Groppenartige: eine Art,
die Groppe. Salmartige: Lachs, Lachsforelle, Flußforelle, Rötheli.
Ungefleckte Salme: Aesche, große Maräne (Blauling oder Bratfisch),
Blaufelchen, kleine Maräne (Albulen), Hägling. Karpfenartige:
Karpfe, Schleihe, Nase, Brachsen, Alet, Rottelen, Schwal, Hasel, Laugeli,
Bambeli, Rißling, Ellritze, Gründling (Gräsling), Bartgrundel
(Grundeli). Hechtartige: Hecht. Weichfische: Trüsche. Aale: Aal. Knorpelfische:
Großes und kleines Neunauge, Querder. Wir haben die Provinzialnamen
hier angeführt, bei Erwähnung der einzelnen Arten wird der wahre
deutsche und systematische Name auch angeführt werden. Für dieses
mal sprechen wir nur von einigen salmartigen.
Salme, Salmones, Saumons nennt man Fische, welche neben einem
verlängerten, seitlich zusammengedrückten Körper von gewöhnlicher
Fischgestalt und zwei Brustflossen, zwei Bauchflossen, einer After-, Rücken-
und Schwanzflosse mit Knochenstrahlen, hinter der Rückenflosse noch
eine kleine, fast durchsichtige Fettflosse, ohne Knochenstrahlen haben.
Die Arten unserer Gewässer bilden wieder zwei Unterfamilien.
Die erste Unterfamilie begreift die Forellen oder Salme mit kleinen
Schuppen, meist geflecktem Körper und außerordentlich vielen
Zähnen in weiter Mundöffnung.
Die zweite Unterfamilie hat große, weniger festsitzende Schuppen,
einen sehr kleinen Mund und sehr kleine oder gar keine Zähne.
Der Raum, der diesen Blättern gewidmet werden kann, erlaubt uns
nur von der ersten Familie zu sprechen.
Die Salme oder Forellen haben unter allen Fischen fast am meisten Zähne.
Sie haben solche in den Kinnladen, im Gaumen, auf der Zunge, an dem Pflugschaarbein
und am Schlundknochen. Diese Zähne dienen aber nicht zum kauen, sondern
nur zum Festhalten und Fassen der Beute. Es sind alle starke Raubfische.
Sie haben ein vortreffliches Fleisch und wenig Gräte.
Von diesen enthalten unsere Gewässer vier Arten:
1) Die gemeine oder Flußforelle, Salmo Fario.
2) Die Lachsforelle, Salmo Trutta.
3) Die Rothforelle, Salmo Umbla.
4) Der Lachs, Salmo Salar.
(Inzwischen waren Taxonomen aktiv: Salmo trutta fario;
Salmo trutta lacustris; für die Umbla (und andere) wurde eine andere
Gattung abgetrennt Salvelinus umbla, wobei aus der Beschreibung nicht zweifelsfrei
hervorgeht, dass es sich nicht um Salvelinus alpinus handelt. Nur der Lachs
heisst immer noch Salmo salar. Die einzige Aenderung hier ist die Kleinschreibung
des Artnamens.)
1. Die gemeine oder Flußforelle. Salmo Fario.
Sie heißt je nach ihrem Aufenthalt und ihrer verschiedenen Färbung
Goldforelle, Schwarzforelle, Bergforelle, Steinforelle, Förenen, und
in Zürich Niederwäßlerforelle, weil sie nur in der Limmat
oder im fließenden Wasser vorkommt. Französisch heißt
sie Truite, italienisch Trotta.
Kennzeichen der Art. Der Körper ist auf verschiedenfarbigem Grunde
immer mit zinober oder karminrothen runden Flecken, ohne bestimmte Zahl
und Stelle, besetzt. Brust, Bauch und Afterflossen sind meist schmutzig
orangengelb; die Rückenflosse grau, oben ins orangenfarbige, unten
ins olivengrüne übergehend; die Schwanzflosse schmutzig-orangenfarb.
Nacken, Hals und Rücken sind meist olivenfarbig, bald mehr bald minder
dunkel, zuweilen mit großen schwarzen Flecken auf dem Rücken.
Die rothen Flecken sind meist mit einem weißlichen Kreise umgeben,
der aber oft ganz undeutlich ist. Ueberhaupt ist die Grundfarbe gar sehr
nach dem Wasser verschieden, in welchem sich die Fische aufhalten, so daß
sie im Allgemeinen schwer anzugeben ist. Unter der Seitenlinie verliert
sich die Farbe bei den meisten ins Gelbe, bei andern ins Silbergraue. Der
Augenring ist silberfarben. Je reiner das Wasser ist, in welchem sie leben,
desto lebhafter ist ihre Farbe, in den Alpenwässern am dunkelsten,
wo dann auch die rothen Flecken am lebhaftesten erscheinen. Die Rogener
oder Weibchen sollen immer etwas kürzer, dicker und heller von Farbe
sein als die Milchner oder Männchen.*) Der Eierstock
und die Eier heißen Rogen, daher das Weibchen Rogener. Der männliche
Same heißt der Milch (nicht die Milch) und das Männchen Milchner.
Die Forelle wird in den Bächen nur 6 bis 10 Loth (146gr) schwer,
sehr selten ein Pfund, in der Limmat selten über fünf Pfund (2.6kg).
Im See findet man sie nicht. Diese Forelle ist durch die ganze Schweiz
allenthalben verbreitet und sowohl in Waldbächen des ebenen Landes,
als in den Seen der Alpen zu finden, wo kein anderer Fisch mehr vorhanden
ist, und in der Limmat und dem Rheine anzutreffen, aber nicht in unsern
Seen. Wo sie sich auch aufhält, immer wird sie unter die besten Fische
gezählt, aber die Bachforellen werden den Flußforellen vorgezogen,
da sie noch schmackhafter sind. Es findet sich kaum ein Bach mit kiesigem
Boden, wo sich nicht Forellen finden. Der Fang aber gehört Privaten
oder der Regierung. Auf dem Markte wird das Pfund meist zu 8 bis 10 Batzen
verkauft, gelegentlich aber erhält man sie oft wohlfeiler. Die Forelle
hat ein zartes Leben und hält sich deswegen nur in reinen Wassern
auf, ohne daß indeß Anschwellungen und Trübewerden der
Bäche nach Gewittern oder starkem Regen ihnen schadet. Hartes, tuffsteinhaltiges
Wasser, oder stehendes Wasser verträgt sie nicht, dagegen in weichem
beständig fließendem Wasser befindet sie sich sehr wohl, wie
in der Limmat und im Rhein. Deswegen findet man sie auch nur in solchen
Alpenseen, aus welchen Bäche ausfließen und niemals in solchen,
welche keinen sichtbaren Ausfluß haben. In den Bächen halten
sie sich gerne bei unterhöhlten Ufern und im Winter in Vertiefungen
auf. Sie sind sehr scheu und entfliehen dem Auge des Beobachters mit äußerster
Schnelligkeit. Nur in der Laichzeit sind sie zahm, daß sie sich fast
mit Händen greifen lassen. In ihren Flossen haben sie eine große
Stärke, und man sieht sie in sehr schnell fließenden Wassern
zuweilen Stunden lang unbeweglich aus einer Stelle stehen, wobei nur eine
fast unmerkliche Bewegung der Flossen statt hat. Besonders gerne geschieht
dies etwa hinter einem vorstehenden Stein oder einem andern Körper,
hinter welchem sich ein kleiner Strudel bildet. Sie liegen da im Hinterhalt,
um auf ein daher kommendes Insekt oder auf ein Fischchen mit größter
Schnelle springen zu können, und dasselbe wegzuschnappen. Wie alle
Fische verhältnißmäßig ein hohes Alter erreichen,
so scheinen auch die Forellen alt zu werden und schnell zu wachsen. Doch
läßt sich darüber nichts Bestimmtes sagen. In reinen Brunnen
oder Fischbehältern, in Bächen oder Flüssen lassen sie sich
viele Jahre erhalten, obschon außer dem Wasser ihr Leben nur kurz
dauert. Die Nahrung besteht aus allerlei Gewürm, Wasserschneckchen,
Blutegeln, besonders dem sogenannten Roßegel, Insekten, Fröschen
und kleinen Fischen. Da sie Insekten und kleine Fische im Sprunge zu erhalten
suchen, so wird die Sprungfischerei, besonders auch auf diesen Fisch angewendet,
wozu man sich als Köder der Wasserinsekten, Mücken, Hafte oder
auch kleiner Fische bedient, welche man, an die Angel gesteckt, immer hin
und her zieht. Die Engländer bedienen sich besonders künstlicher
Insekten dazu, welche immer oben auf schwimmen und erschnappt werden. In
den Brunnen werden sie gewöhnlich mit Ochsenleber oder ganz kleinen
Fischen gefüttert, können aber auch sehr lange ohne Nahrung sein
und sich doch wohl befinden, wenn sie nur immer frisches Wasser haben.
Die Laichzeit fällt in den November und dauert bis gegen Weihnacht.
Sie suchen zur Absetzung des Laiches einzelne Stellen aus, wo das Wasser
über feinen Sand und Kiesel fließt, wo es zuweilen so untief
ist, daß die Rückenflosse fast aus dem Wasser hervorragt. So
bald die jungen Fische ausgekommen sind, zerstreuen und verbergen sie sich
überall unter Steine. Sie vermehren sich stark. Die Alten ziehen sich
dann haufenweis zusammen, die Eier hängen an den Steinchen fest und
die Männchen reiben den Bauch am Boden, wodurch der Milch ausgegossen
wird und die Eier befeuchtet. Da sie bei Tag und bei Nacht auf Raub ausgehen,
so kann man sie auch zu allen Tagszeiten fangen, am besten aber beißen
sie Frühmorgens oder Spätabends an die Angel. Man fängt
sie auch mit Garnen, welche man Abends ausspannt, in welche sie sich dann
in der Nacht verwickeln. Der Angelfischer muß immer hin und her gehen
und den Köder beständig bewegen.
Es giebt zuweilen Mißgeburten unter ihnen , mit fehlerhaften
Köpfen. Unsere Sammlung besitzt eine solche, wo die obere Kinnlade
viel kürzer ist als die untere.
2. Die Lachsforelle. Salmo Trutta. Truite saumonée.
Seeforelle.
Oberwäßlerforelle.
Sie heißt bei uns einfach Seeforelle; Hartmann hat sie gewiß
irrig mit der im Bodensee und Rhein vorkommenden Rheinlanke verwechselt,
welche zwar ein ähnlicher, aber verschiedener Fisch ist. Sie wird
in allen großem Schweizerseen gefunden, in unserm Kanton bloß
im Zürichsee, Greifensee und Pfäffikersee, nie in der Limmat.
Ihre Gestalt ist länglich. Der Augenstern ist schwarz, der Augenring
silberfarben. Stirne, Nacken und obere Theile graulich, oft ins olivengrüne
spielend, Seitenlinie undeutlich, gerade, Seiten und untere Theile silberweiß,
mit unregelmäßigen schwarzen Flecken, welche mehr oder minder
zahlreich sind, der Bauch weiß. Bei jungen Fischen ist der Schwanz
etwas gegabelt, bei alten gerade abgeschnitten. Die Flossen sind graulichweiß
oder aschgraulich. Diese Forelle erreicht eine bedeutende Größe
bis 35 ja 40 Pfund, solche sind aber sehr selten, dagegen solche von 6,
8 bis 12 Pfund gemein. Man findet diese Forelle nur im See selbst, nicht
einmal bei seinem Ausfluß aus dem See; gegen die Laichzeit und während
dem Laichen aber tritt sie in den Ausfluß der Linth ein und setzt
da den Laich ab. Dies geschieht mit Ende September oder im Oktober und
dauert bis im November. Der Rogen geht fast auf einmal ab und bleibt an
den Steinen oder Wasserpflanzen hängen. Die jungen Fischchen kommen
nach 7 bis 8 Wochen aus. Die Eier haben die Größe einer Erbse
und sind durchsichtig, so daß man die nach und nach sich ausbildenden
Fischchen durch die Häute sehen kann. Die Männchen oder Milchner
reiben sich an den den Laich umgebenden Körpern, wodurch der Saame
ausfließt und die Eier befruchtet. Dieß soll meist des Nachts
geschehen und bei hellem Wasser und Mondenschein am liebsten. Die jungen
Fischchen bleiben einige Zeit in der Linth und gehen erst nach Monaten
in den See. Sie wachsen sehr schnell, pflanzen sich aber erst nach vier
Jahren fort, wenn sie wenigstens eine Länge von 13 bis 16 Zoll erreicht
haben. Schon im 6 ten Jahr kann der Fisch 7 bis 8 Pfund schwer werden.
Er scheint sehr alt zu werden und eine Forelle von 30 Pfund und mehr, welche
aber selten sind, hat gewiß ein hohes Alter, welches sich aber nicht
bestimmen läßt. Eine Seeforelle von 34 Pfund, welche in unserer
Sammlung sich befindet, ist eine große Seltenheit. Die Nahrung der
jungen Fische besteht in Würmern, Insekten und kleinen Fischen. Je
größer sie werden, desto größere Fische verschlingen
sie und verschonen keinen Fisch, den sie verschlingen können. Auch
Frösche verschlucken sie.
Das Fleisch dieses Fisches ist sehr geschätzt und um so mehr,
je größer er ist. Im Sommer ist das Fleisch roth, im Winter
weiß und wird mit 8 bis 10 Batzen das Pfund bezahlt. Im Mai ist es
am besten. Beim Sieden wird es goldgelb. In der Laichzeit ist es weniger
schmackhaft, wie dies bei allen Fischen der Fall ist; es ist dann weich
und hat einen faden Geschmack, während es außer dieser Zeit
fest ist. Für die Fischer ist dieser Fisch sehr wichtig, da er so
groß wird und so theuer verkauft werden kann. Als ein gefräßiger
und gewaltiger Räuber frißt er viele andere Fische, doch bei
weitem nicht, wie der Hecht. Seine Eingeweide sind oft sehr fett. Man fängt
ihn im ganzen See das ganze Jahr durch außer der Laichzeit, wo sein
Fang verboten ist. Man bedient sich zum Fang der sogenannten Trachtgarne
und der Setzangel, im Winter der Schwebgarne. Zuweilen befällt diesen
Fisch auch ein eigener Zufall, der ihn für einige Zeit unfähig
macht unterzutauchen. Unsere Fischer nennen diesen Zustand den Blast. Sehr
viele Fische haben nämlich im Körper eine doppelte oder einfache
Blase, welche mit Luft gefüllt werden kann. Wenn der Fisch aufsteigen
will, so füllt sich die Blase mit Luft; dadurch wird derselbe leichter
und kann sich der Oberfläche des Wassers nähern, will er wieder
tiefer sinken, so wird die Blase entleert. Fische, welchen diese Blase
fehlt, bleiben daher immer in den Tiefen. Zuweilen nun wird, namentlich
bei großer Sonnenwärme, diese Blase sehr von Luft ausgedehnt,
verliert für einige Zeit die Kraft sich zusammenzuziehen, so daß
der Fisch nicht untertauchen kann und in seinen Bewegungen gehemmt ist.
In diesem Zustand kann man einen solchen oft mit Händen greifen. Escher
erzählt von einem Fall, wo man eine 27 Pfund schwere Forelle fangen
konnte. Dieser Zustand befällt auch Hechte und andere Fische, er dauert
aber gewöhnlich nicht lange, und verliert sich, wenn der Fisch stärkere
Bewegungen macht. Diese Blase ist es, aus welcher die sogenannte Hausenblase
oder der Fischleim gemacht wird, den man nicht bloß vom Hausen, sondern
auch von andern großen Fischen bereiten kann.
Die Rothforelle. Salmo Umbla. Rötheli, Röthel.
Im Genfersee heißt sie der Ritter, l'ombre Chevalier. Diese Forellenart
ist nicht gefleckt, gehört aber ihrem ganzen Bau nach zu den wahren
Forellen, mit sehr vielen Zähnen. Die Farbe ist nach der Jahrszeit
und dem Wasser verschieden. Der Augenring ist silberfarb. Stirne, Nacken
und Rücken dunkel oder heller olivenfarb, der Bauch hoch orangenfarb,
die Seitenlinie zart, gerade und mehr oberhalb als in der Mitte. Im Sommer
ist die Farbe viel heller, oben olivengrünlich, Seiten und Bauch gelblich,
der letztere weiß und hin und wieder, wie auch unsere Abbildung zeigt,
wie mit Kohlen geschwärzt, doch nicht bei allen. Im Winter bemerkt
man bei einigen auch orangenfarbe Flecken, mit einem schwachen weißen
Ringe umgeben. Die Brust-, Bauch- und Afterflossen sind bei Erwachsenen
hoch orangenfarbig, Rücken-, Fett- und Schwanzflosse mehr grau.
Die Rothforelle gehört zu den kleinen Fischen, die meisten sind
ungefähr spannenlang, solche von einem Fuß und länger gehören
schon zu den seltenen und die allergrößte, welche in unsern
Zeiten im Zugersee gefangen wurde, wog 5 Pfund. Die Schuppen sind immer
sehr klein und kaum bemerkbar. Im Genfersee wird die Rothforelle bedeutend
größer und bis auf 7 - 8 Pfund, ja 10 Pfund schwer, deßwegen
wurde sie auch für eine verschiedene Art gehalten. Die Haut dieses
Fisches ist so zart und dünne, daß sie fast durchsichtig scheint.
Das Fleisch ist röthlich, aber zart und geht ungemein schnell in Fäulniß
über. Man fängt einzelne das ganze Jahr, in größerer
Menge aber fängt man sie von Martini an bis zum neuen Jahr. Hauptsächlich
werden sie bei dem Meilerfeld und bei der Au gefangen. Sie halten sich
immer in bedeutenden Tiefen auf, selten unter 10 bis 13 Klaftern, gewöhnlich
aber noch viel tiefer. Sie kommen nie in die Limmat und auch nicht in die
Linth und bedürfen zu ihrem Leben ein weiches Wasser, hartes vertragen
sie nicht. Sie haben ein sehr zartes Leben, doch aber lassen sie sich in
Brunnen Monate lang erhalten. Sie laichen auch nur in großen Tiefen,
im Zürichsee von der Mitte Oktobers an; die Laichzeit dauert fast
zwei Monate. Nach frühem Verordnungen sollte man annehmen, sie laichen
zweimal im Jahre und zwar im Juli und im Oktober, allein dieß scheint
unrichtig zu sein. Die Eier sind von der Größe des Hanfsamens
und von Farbe hellröthlich. Ihre Nahrung besteht hauptsächlich
in der Brut anderer Fische, da sie zu klein sind größere Fische
zu verschlingen. Man findet nur Heuerlinge in ihrem Magen. Vielleicht fressen
sie auch Wasserinsekten, welche aber selten in solche Tiefen kommen mögen,
wo sie sich aufhalten. In Brunnen fressen sie auch Regenwürmer, von
welchen sie in der Freiheit auch wohl keine bekommen. Diese Würmer
sind überhaupt allen Süßwasserfischen angenehm. Es scheint
fast, als ob dieser Fisch ehmals häufiger gewesen sei als jetzt, da
er auch zu der Zeit, wo man am meisten fängt, nicht häufig auf
den Markt kommt, und nur selten Pfundweise gekauft werden kann. Auch jetzt
noch werden sie am häufigsten bei Meilen und bei der Au gefangen.
Die Garne werden am Abend über 20 Klafter tief gesetzt und des Nachts
im Wasser gelassen, am Morgen aber wieder aufgewunden. Wahrscheinlich weil
der Fang weniger ergiebig, das Garn setzen aber mühsam und zeitraubend
ist, wird derselbe weniger betrieben, da er zu wenig Gewinnst abwirft.
Wenn auch im Allgemeinen die Menge der Fische sich nicht vermindert hat,
so können doch aus uns unbekannten Ursachen einzelne Arten weniger
zahlreich geworden sein. Noch gehört, wie schon angeführt worden,
auch der Lachs zu dieser Familie, allein der Raum für die Abbildung
gestattete nicht diesen Fisch abzubilden, und dann wäre so viel von
der merkwürdigen Lebensart dieses Fisches zu sagen, daß wir
genöthigt sind, dieß auf ein anderes Jahr zu versparen.
Bemerkungen des Uebertragers:
Die Nomenklatur der Fische ist für 1847 korrekt.
Inzwischen waren aber die Taxonomen aktiv. Sie haben 24 000 weitere Fischarten beschrieben und haben umgeteilt. Das Misstrauen von Schinz über die Gleichheit
der Röteli (Saibling) im Genfersee und im Zugersee war gerechtfertigt. Die
Formenvielfalt von Salmo trutta ist hingegen sehr gross (Stichwort: Rheinlanken).
Altersbestimmungen anhand von Schuppen waren offenbar noch nicht bekannt.
Bemerkenswert ist auch die Stelle über den Krieg von Jedem gegen Jeden. Darwin's Publikation war 9 Jahre später. Die erste Fischbrutanstalt wurde 1852 im Elsass gebaut.
Wie in anderen Neujahrsblättern werden Aberglauben und anderes angesprochen, diesmal sind es "Fischerlatein" und die "Schäden" durch die neumodischen
Dampfschiffe.
Masse: 1 Klafter ca. 1.8 - 2 m, 1 Fuss ca. 30.1 cm, 1
Zoll ca. 2.53 cm; 1 Pfund à 32 Loth ca. 500gr.
Mass und Gewicht sind ein besonders kompliziertes Kapitel
im 19.Jahrhundert. Stichworte: Napoleonische Kriege, Restauration, Einführung
des metrischen Systems.
Übrigens war gleichzeitig ein anderes Pfund à 36 Lot in Gebrauch.
To Zurich's (adolescent) youth on the year 1847, 49th piece
by the natural science society , 7 pg., 1 lithography
"Trouts" by Hch. Rud. Schinz
Trouts, charr, Salmo trutta lacustris, S. trutta fario, Salvelinus alpinus
On the fish of our lakes and streams
Fish belong to the most important products of the animal realm, which supply Switzerland in general and particularly the
canton Zurich. Zurich has relatively to its size an noteworthy quantity of waters, which are all populated with fish,
which provide to some families a tidy income by its catch and sales. A description of these animals and their individual
importance may therefore have general interest since the scientific books are not wide spread.
Even if, for us, the fish do not belong to the most necessary needs of living, they are nevertheless worth to all
attention, since they serve many millions humans as main food and their catch employs many hundredthousands. Nature
ensured that all salty and fresh waters in all climats, under each temperature, under the equator as in the proximity
of the poles are inhabited by fish; because these cold-blooded animals depend few on the temperature of the climates.
We see that many lakes of our alps, which are three-quarter of the year frozen accommodate the tastiest trouts, if they
only have a outlet. ...
Survival of fish can only been explained with fertility: 100.000 eggs seems to be nearly the smallest number, which
a female annually spawns. Egg counts of carps are approximately 340,000, of tench some 380,000, European perch some
280,000 and that of a sturgeon are 150,000,000*). If all those eggs would hatch and none would die, then all waters
would not hold the quantity and by the quantity of the starving bodies even the sea would turn into a putrid-ended
fermentation. However by far not all these eggs will become fertilized, many are devored by water birds and other fish,
and thousands of the arising small fish become others prey.
Values of fish of canton Zurich: ... the better fish are always expensive and fishermen put more effort on
their catch. Here belong salmon, salmon-trout, trout, charr, eel, grayling and burbot. Of smaller value and nevertheless
splendid are the unspotted salmons or whitefish, to which belongs the so-called roasting fish or bluefish (Coregonus
wartmanni). Pikes, perches and carps are still appreciated, common however are dace, carp bream, sneep, tench, rudd,
roach and smaller kinds of the carp family.
Some believe, that the quantity of the fish dropped since the introduction of the steam navigation and public
opinion supports this, where ever steam ships are present, however without connection to exact investigation. Filling
up the shores and changes of the streambed changed the location of some fish. Thus e.g. the carps, which were frequent
and largely present in former times close to the city, were displaced by filling out a part of their stay and completely
disappeared, so that they are now present near Rapperswil (upper end of Lake Zurich) only in the swampy shallow parts.
Fishermen, which should know all characteristics of the fish, often raise themselves to be prophets of weather and find
large faith. However their predictions happen only rarely and coincidentally. Fishermen and hunters could probably be
able to make weather forecasts by exact observations of certain features in the animal realm. If this is possible at
all, but they are no exact observers, at least not here, and mostly in prejudices and superstition, therefore their
predictions do not have a secure reason. Experience teaches that frequently the opposite of the prophesy occurs. If
it would go according to to them, then the Lake Zurich would freeze every year, which happens nevertheless only
approximately every ten years.
The rest of the paper covers a list of all fish species in the Canton of Zurich and descriptions of lake trout,
brook trout (brown trout) and charr, consisting of: local names, description, maximum size, water quality needed,
distribution, life history, food, spawning, catch.
*) Acipenser sturio is noted with 2,400,000 cf. fishbase
Another note (in the salmon paper): In older times it was believed, that flea are the best lure for grayling (umber), but already Gessner noted, that fishermen have to take "subtile care" of the flea.
Home Liste der Neujahrsblätter