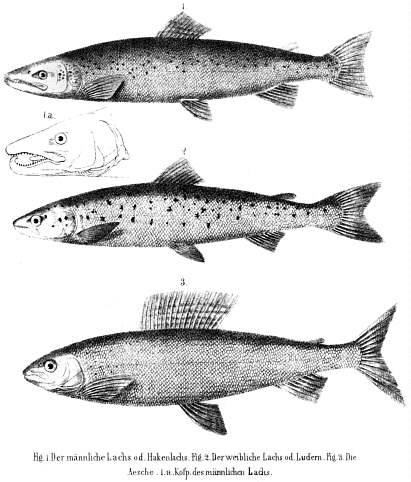An die Zürcherische Jugend auf das Jahr
1848, L. Stück, 7 S., 1 Lithographie
von der Naturforschenden Gesellschaft
"Die Lachse" von Hch. Rud. Schinz
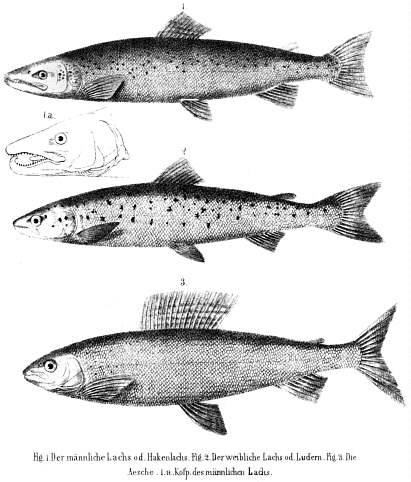
(von H.R. Schinz, Druck/Kunstdruck Mahler und Weber)
(Lithographie vermutlich von C. Kull Zürich, vgl. Nr. 49) |
Die Fische unserer Gewässer.
Ein halbes Jahrhundert ist bereits verflossen seit dem die naturforschende
Gesellschaft, nach dem Beispiel anderer Gesellschaften unserer Vaterstadt,
angefangen hat jedes neue Jahr ein Unterhaltungsblatt der reifern Jugend
zu widmen, welches, dem Zweck ihrer Stiftung gemäß, irgend einen
naturhistorischen Gegenstand darstellte. Im vorigen Jahr wurde der Anfang
gemacht die Naturgeschichte der Fische zu behandeln, welche unsere Seen
und Flüsse bewohnen, um zu zeigen wie wichtig diese Thiere für
den Erwerb einer bedeutenden Zahl unserer Mitbürger sei, welche sich
mit ihrem Fange beschäftigen. Wenn aber der Fang gehörig und
ohne die Fische zu sehr zu vermindern, betrieben werden soll, so muß
auch die Lebensart, der besondere Aufenthalt jeder Art und ihre Fortpflanzung
näher bekannt sein und diesen Zweck sollen diese Blätter zu erreichen
suchen. Wir machten im letzten Blatt mit der Darstellung der wahren Forellenarten
den Anfang, indem wir die Geschichte der Flußforelle, der Seeforelle
und der Rothforelle behandelten. Von dieser wichtigen Gattung bleibt noch
die vierte Art zu betrachten übrig, nämlich:
Der Lachs. Salmo Salar.
Dieser Fisch hat nach Alter, Jahreszeit und Geschlecht auch bei uns
verschiedene Namen, wie dies bei verschiedenen Fischen der Fall ist. Der
einjährige heißt ein Sälmling oder Saibling, der Erwachsene
heißt vom Frühjahr an bis zum August Salm und von da an bis
zum Neujahr Lachs, französisch Saumon. Das Männchen oder der
sogenannte Milchner heißt vom September an Haken, weil sein Unterkiefer
sich in einen Haken umbiegt, der Rogener oder das Weibchen heißt
Ludern.
Der Lachs ist der größte Fisch unserer Flüsse, (nur
der Hecht kommt ihm zuweilen an Größe nahe,) er erreicht ein
Gewicht von 35 bis 40 Pfund, man hat sogar Beispiele von solchen, welche
50 Pfund wogen. Der Kopf ist nach Verhältniß nicht sehr groß,
länger und spitziger beim Männchen, als beim Weibchen. Er hat,
wie alle Forellen, eine sehr große Menge von Zähnen, in den
Kinnladen, an der Zunge, im Gaumen und im Schlunde. Die Schuppen sind nicht
sehr groß und sitzen an der starken, dicken, fettigen Haut fest,
Kopf und Rücken sind am Männchen olivengrün, welche Farbe
an den Seiten bis zur Seitenlinie heller wird und unter derselben in Gelb
übergeht, die Flossen sind sämmtlich grau, die Fettflosse, welche
keine Knochenstrahlen hat, ist nicht groß, an den Seiten bis zur
Seitenlinie sind hin und wieder kupferrothe und schwärzliche, unregelmäßige
Flecken zerstreut. Das Weibchen ist oben mehr blaugrau, an den Seiten mehr
silberweiß und mit schwarzen Flecken bezeichnet. Gegen die Fortpflanzungszeit
verlängert sich beim Männchen die untere Kinnlade. wird knorpelartig
hart und biegt sich in einen Haken um, in der Oberkinnlade aber entsteht
eine Höhle, in welche die Spitze des Hakens einpaßt, so daß
der Mund sich doch schließen kann; nach der Laichzeit verliert sich
dieser Haken wieder und findet sich beim Salm nicht. |
Verbreitung und Aufenthalt. Der Lachs ist einer der am weitesten
verbreiteten und deswegen auch einer der wichtigsten Fische. Er findet
sich in allen Flüssen, welche in die Nord- und Ostsee fließen,
in allen denen, welche sich ins Eismeer ergießen, im ganzen Norden
von Nordamerika, bis zum nördlichsten Grönland, auch in den Flüssen,
welche in das stille Meer sich ergießen. (Die neuere Systematik ist nicht mehr einverstanden.)
Nach der Jahrszeit ist er
bald ein Bewohner des Meeres, bald der großem und zur Fortpflanzungszeit
der kleinem Flüsse, selbst der großem Bäche. Niemals aber
hält er sich in den Süßwasserseen bleibend auf. Unsere
Lachse steigen aus der Nordsee im Frühjahr in den Rhein und wandern
allmählich aufwärts, sodaß sie schon im Mai von Basel bis
zum Rheinfall sich finden und dann Salm heißen, im August oder Anfang
Septembers treten sie in die Limmat, Reuß und Aare und im Oktober
ziehen sie zum Theil in die kleinem in den Rhein fließenden Flüsse,
die Töß, die Thur, viele aber durch den See hinauf in die Linth,
und viele sogar durch den Wallensee in die Seez und bis gegen Mels hinauf.
Nach Vollendung der Linthunternehmung stiegen viele in das alte Linthbett
und wurden dort gefangen, erst in den folgenden Jahren kamen sie in die
neue Linth; in der Thur steigen sie bis gegen Untertoggenburg hinauf. Bei
ihren Wanderungen überspringen sie den kleinen Rheinfall bei Laufenburg,
allein den großen Rheinfall können sie nicht überspringen
und sammeln sich am Fuße desselben, wo oft sehr viele gefangen werden.
Durch die Reuß gehen sie in den Vierwaldstädtersee und aus diesem
bis nach Steg, aus der Aare bis durch den Thuner und Brienzersee. Die stärksten
Züge in die Nebenflüsse kommen im Oktober. Wenn sie aus dem Meere
aufsteigen, wandern sie in großen Schaaren, wobei sie ein zweiseitiges
Dreieck bilden sollen, an der Spitze ein Rogener oder Weibchen voran, nachher
zerstreuen sie sich. Sie überspringen Mühlwuhre und Dämme,
indem sie den Schwanz mit dem ganzen Körper in einen Ring biegen und
plötzlich wieder zurück schnellen. In diesem Schwanze haben sie
eine große Stärke, womit Gefangene selbst gefährlich um
sich schlagen können.
Nahrung. Ungeachtet der Lachs ein furchtbares Gebiß hat,
gehört er doch nicht unter die gewaltigen Raubfische, wie andere Forellen
und man findet seinen Magen oft leer. Die Jungen nähren sich von Würmern
und Wasserinsekten, wohl auch vom Laiche anderer Fische; ältere Salme
verschlingen kleine Fische, besonders soll der Stichling, der sich aber
in unsern Flüssen nicht findet, wohl aber in den meisten andern Flüssen,
welche in den Rhein fließen, seine Nahrung ausmachen und der Lachs
diesen kleinen Fisch, den andere Raubfische seiner Stacheln wegen nicht
verfolgen, ohne Schaden in Menge verschlingen. Wahrscheinlich frißt
er auch Krebse und Würmer.
Fortpflanzung. Der Hauptzweck der Wanderung der Lachse in die
Flüsse und besonders in die kleinen ist die Fortpflanzung, welche
nie im Meere geschieht. Sie treten in alle die kleinem Flüsse ein,
welche genug Wasser haben, doch bleiben auch viele im Rheine zurück,
an allen Orten aber suchen sie seichtere Stellen zur Ablegung ihrer Eier
auf, oft sogar sieht man sie in Bächen laichen, welche so wenig Wasser
haben, daß die Rückenflosse großer Lachse über das
Wasser hervorragt. Die Laichzeit beginnt mit Ende Oktober und dauert bis
Ende Dezember. Zu dieser Zeit sieht man Männchen und Weibchen beisammen
auf den sogenanten Gruben stehen. Diese Gruben sind nichts anders als kleine
Vertiefungen auf dem Grunde des Flußbettes, welche dadurch entstehen,
daß das Weibchen, oft auch das Männchen, an diesem Ort sich
schwimmend erhält, wie man sich ausdrückt, steht, und mit dem
Schwanze und Bauch am Boden wühlt, wodurch die kleinen Steinchen etwas
seitwärts geschoben und umgekehrt werden, indem die untere Fläche
derselben weniger schleimig ist, ist sie auch rauher und heller und zeigt
dadurch dem Auge leicht die Stelle der Grube an. Diese ist ungefähr
zwei Fuß breit und mehrere Fuß lang. Hat sie die gehörige
Eigenschaft, so reibt sich der Rogener oder das Weibchen am Boden, dadurch
gehen die reifen Eier aus dem Leibe ab und bleiben an den rauhern Steinchen
hängen. Nun kommt das Männchen und befördert durch lebhafte
Bewegung des Körpers den Abgang einer weißen Feuchtigkeit aus
dem After, welche der befruchtende Same ist. Diese ergießt sich mit
dem Wasser über die Eier und befruchtet sie, wobei indes nicht alle
befruchtet werden; da aber dies mehrmals wiederholt wird, so werden die
meisten befruchtet und da die Zahl der Eier groß ist, so ist auch
die Vermehrung stark. Mann rechnet nämlich die Zahl der Eier, welche
ein Weibchen von sich gibt, auf etwa 30,000. Sie sind roth und nicht viel
größer als Mohnsamen. Nach 10 bis 11 Wochen kommen die kleinen
Fischchen aus den Eiern und bleiben gerne eine ziemliche Zeit in derselben
Gegend unter Steinen oder andern Körpern verborgen, bis sie eine gewisse
Größe erreicht haben, dann treten sie die Reise abwärts
an, und so findet man sie im Frühjahr in den großem Zuflüssen
des Rheins als sogenannte Sälmlinge von sechs bis sieben Zoll Größe;
sie halten sich hier nur einige Wochen auf und schwimmen abwärts bis
zum Meere, wo sie so lange bleiben, bis sie zu Salmen erwachsen sind, daher
findet man nur Salme von einigen Pfunden im Rhein, nie kleinere.**
der Autor muss die Zwergmännchen übersehen haben.
Durch das Laichen wird das Fleisch des Lachses weicher und schlechter,
der Fisch wird mager und gegen das Ende der Laichzeit hat es viel von seiner
Derbheit verloren, wird auch durch das Kochen nicht roth, wie das Fleisch
der Salme, dem es in jeder Beziehung nachsteht; dennoch aber ist es immer
noch sehr geschätzt und angenehm. Wenn auch viele tausend Fische einer
Brut zu Grunde gehen, so erreicht doch die größere Zahl das
Meer.
Nutzen. Wenn auch bei uns das Fleisch der Salmen und Lachse
seiner Theure wegen nur auf die Tafeln der Wohlhabenden kommt, so ist der
Gewinn des Lachsfanges um deßwillen für den Fischer nur um so
bedeutender. Das Pfund wird gewöhnlich nicht unter einem Franken verkauft
und nur bei größerm Ueberfluß etwas wohlfeiler. Salme
werden in der Limmat selten gefangen und noch theurer verkauft, und zwar
mehr in den Gasthöfen. Man kann den Lachs frisch mehrere Tage aufbewahren.
Im Norden, wo der Lachs viel häufiger ist, wird er eingesalzen oder
gedört und so das ganze Jahr aufbewahrt, allein bei uns kennt man
dies nicht. Die Sälmlinge werden im Frühjahr sehr geschätzt,
aber bei uns selten mehr gefangen. Schaden thut dieser Fisch, als Raubfisch,
nur sehr unbedeutenden durch Fressen anderer Fischbrut.
Fang. Man erstaunt,
wenn man liest, wie unglaublich viele Salmen schon bei ihrem ersten Eintritt
in den Rhein gefangen werden, und der ganzen Länge des Rheines nach
bis zu uns wird dem Lachs und Salm auf vielfache Art nachgestellt, so daß
es ein wahres Wunder ist, daß noch so viele zu uns kommen können.
Bei seinem Eintritt in die Schweiz bei Basel wird, beim Ausfluß der
Wiese in den Rhein, täglich mehrere Male ein großes Garn, der
Wolf genannt, ausgestellt und meist mit Beute beladen wieder aufgezogen,
zwischen Basel und Laufenburg, von Rheinfelden bis Laufenburg, findet man
am Ufer allenthalben Lachsfallen und Garne, welche man die Wage nennt,
aufgestellt. Es ist dies eine Art von Schnellgarnen, wodurch der Lachs,
wenn er darüber hinschwimmt, schnell mit dem Netz in die Höhe
geschnellt wird, und zappelnd auf demselben liegend in der Luft hängen
bleibt. Da wo der Rhein zwischen Felsen enge durchfließt, wie in
Laufenburg, werden in diese Zwischenräume eine Art von eisernen Reusen
gelegt, worin der Lachs sich, wenn er sich durchdrängen will, fängt.
Man hat auch eigene Fallen, welche an eben solche Orte gelegt werden, wo
der Lachs durchschwimmen muß. Sie gleichen etwas den Fuchsfallen,
welche man Tellerfallen nennt, und klemmen den Lachs ein, indem sie zuschlagen
und zugleich den Fisch durchstechen. Zuweilen sucht man durch lebende Rogener
Männchen anzulocken, indem man dem Fisch einen Strick zwischen die
Kiemen durchzieht und ihn so ins Wasser hängt. Am Rheinfall werden
sehr viele Lachse gefangen, indem sie sich da sammeln und nicht weiter
reisen können. Die merkwürdigste Art des Lachsfanges geschieht
des Nachts, indem man sie blendet, und dann mit einer Gabel, der man den
Namen Geeren giebt, sticht. Dies gedieht auf folgende Art. Man beobachtet
am Tage, wo Lachsgruben sind, auf welchen Männchen und Weibchen schwimmen
oder, wie der Fischerausdruck ist, stehen. Dieses kann man von einem erhöheten
Standpunkte, z. B. einer Brücke oder auch wohl vom Ufer aus thun,
oder indem man in einem Schiffe hin und her fährt, wodurch zwar die
Fische sich entfernen, allein die Grube bemerkt man deutlich und bezeichnet
den Punkt auf irgend eine Art, so daß man denselben auch bei der
Nacht wieder finden kann. Nun verbindet sich eine Gesellschaft von 6 bis
8 Männern; man miethet ein Schiff, nebst einem Kahnführer und
einem Manne zum leuchten. Als Leuchtinstrument dient ein eiserner Korb,
in welchem man Kienspähne anzündet. Dieser Korb wird an einer
Stange so in die Höhe gehoben, daß das Wasser bis auf den Grund
erleuchtet wird. Nun stellen sich die 6 oder 8 Mann auf beide Seiten des
Kahns jeder mit dem Geeren bewaffnet und die Augen fest auf das Wasser
gerichtet. Der Kahnführer fährt dann über die bezeichneten
Gruben langsam hinab. Die durch den Schein des lodernden Feuers geblendeten
Lachse kommen an die Oberfläche des Wassers und werden in diesem Augenblicke
mit dem Geeren angestochen, und, da dieser Wiederhacken hat, so bleibt
der Getroffene hängen, und wird in das Schiff geworfen, was aber bei
einem großen Lachs nicht leicht ist, und Kraft nebst festen Fuß
erfordert. Man wählt zu diesem Fange lieber dunkle, als helle Nächte,
weil der Schein des Feuers mehr blendet, zugleich muß aber auch das
Wasser ganz hell und durchsichtig sein, weil man natürlich bei trübem
Wasser den Fisch nicht sehen kann, und dieser auch nicht geblendet wird.
Es ist ein schönes Schauspiel bei dunkler Nacht diese Männer
zu sehen, wie sie im Feuer stehen, besonders den Korbträger, über
welchen beständig Funken herabfallen. Der Glanz des beleuchteten Wassers,
die Beleuchtung der umgebenden Hügel und Häuser und die geröthete,
dunstige Athmosphäre scheinen eine Feuersbrunst anzudeuten, für
welche dies Schauspiel auch schon oft gehalten worden ist, daher muß
die Polizei vorher benachrichtigt werden, damit nicht Feuerlärm gemacht
werde. In den neuesten Zeiten scheint übrigens diese Art Fang seltener
betrieben zu werden, entweder weil die größere Seltenheit der
Lachse die nicht unbedeutenden Kosten oft kaum ersetzt, oder weil es an
Liebhabern fehlt, welche die meist frostige Fahrt nicht mitmachen mögen.
Sie dauert oft mehrere Stunden, da man mehrmals Fluß auf und abwärts
fahren muß, indem in einer Fahrt nicht alle Lachsgruben befahren
werden können. Die nicht getroffenen Lachse kehren bald wieder zur
Grube zurück und können bei einer zweiten Fahrt gefangen werden.
Ein glücklicher Fang ist aber einträglich und ersetzt die aufgewendeten
Kosten reichlich. Auch vom Land aus kann zuweilen etwa vor einer Brücke
oder einer Wuhrung herab ein Lachs gestochen werden. In frühem Zeiten
wurde oft eine eigene Fischerei auf Sälmlinge getrieben, wenn diese
im Frühjahr, ehe sie den Rhein abwärts gegen das Meer zueilten,
einige Zeit in der Limmat sich aufhielten. Sie geschah mit der Angel und
mit künstlichen Insekten als Sprungfischerei, und hieß die Rollenfischerei,
weil eine Rolle oder kleine Schelle an der Angelruthe angebracht dem Fischer
anzeigte, wenn ein Fischchen angebißen hatte. Die Angelschnur war
sehr lang und der Fischer fuhr in einem Kahn mitten auf der Limmat auf
und ab. Sie scheint wenig mehr getrieben zu werden, wahrscheinlich aus
Mangel an Liebhabern, weil sie viele Zeit erfordert und nicht einträglich
ist.
Feinde hat der Lachs in unsern Gewässern nur als Sälmling,
den erwachsenen Fisch greift kein anderes Thier an, nicht einmal der Fischotter,
Aber ein Schmarozer-Thier, der sogenannte Kieferwurm*) Lernaea
branchialis, zur Klasse der krebsartigen Thiere gehörend, man nennt
dieses Thier auch Lachslaus.
plagt den Salm im Sommer, oft so sehr, daß er vor Schmerz große
Sprünge über das Wasser macht, er hängt sich aber nicht
blos an die Kiefern, sondern auch an andere Theile. Auch hausen in seinen
Eingeweiden mehreren Arten von Eingeweidewürmern, welche ihm aber
wahrscheinlich wenig schaden.
Die zweite Familie der salmartigen Fische, welche in unsern Gewässern
sich aufhält wird durch die sogenannten ungeflekten Salme gebildet.
Nur durch die Fettflosse ähneln sie den Forellen, dann aber freilich
auch durch die wenigen Gräten, womit ihr Inneres versehen ist, dagegen
haben sie sehr kleine oder gar keine Zähne und können deßwegen
nicht wohl unter die Raubfische gezählt werden. Die Mundöffnung
ist sehr klein und gestattet ihnen nur sich von Würmern, Insekten
oder gar vegetabilischen Stoffen zu ernähren. Die meisten haben große,
weniger festsitzende Schuppen und find meist ungefleckt. Sie leben meist
in Seen, nur eine Art in fließendem Wasser, und die in Seen lebenden,
lieben die Tiefen und kommen fast gar nicht auf die Oberfläche. Mit
Recht sind sie von den Forellen, zu welchen man sie früher zählte,
getrennt worden und bilden die Gattung der Felchen (Coregonus). Unsere
Gewässer beherbergen folgende:
1) Die Aesche. Coregonus Thymallus.
2) Die große Maräne. Cor. Maraena.
3) Den Blaufelchen C. Wartmanni.
4) Die kleine Maräne C. Maraenula.
5) Den Hegling C. Albula.
Die Aesche Coregonus Thymallus.
In der französischen Schweiz l'ombre in der italienischen il temolo.
Man hat sie wohl auch zu einer eigenen Gattung Thymallus gemacht und Thymallus
vexilifer genannt. Beide Kinnladen sind mit leicht bemerkbaren, kleinen
Zähnchen besetzt, welche aber sehr spitzig sind; einige kleine Zähnchen
sitzen auch noch im Gaumen. Der Körper ist mit mittelmäßig
großen und harten Schuppen bedeckt; die obern Theile, Rücken
und Seiten desselben sind grau, an den Seiten geht diese Farbe ins hellere
grau über, die Seiten über und unter der Seitenlinie sind mattweiß
und über den ganzen Körper bis zum Schwanz, laufen 14 bis 15
schmutziggraue Parallelstreifen, welche dem ganzen ein düsteres Ansehen
geben. Die Rückenflosse dagegen ist sehr lebhaft gefärbt, sie
hat 20 Strahlen und ist hoch, mit mehreren Reihen runder schwarzer Flecken
besetzt, zwischen welchen die Häute zinnoberroth sind, die Fettflosse
ist nur klein und die übrigen Flossen mehr oder minder rot. Am vordem
Theil des Körpers bemerkt man meist einige kleine, schwarze, runde
Flecken. Die Aesche wird etwa 14 bis 15 Zoll lang und erreicht ein Gewicht
von einem Pfund, sehr selten von zwei, oder gar drei Pfund.
Aufenthalt. Es ist dieß ein Flußfisch, der nie in
die Seen geht. Er kommt in der Limmat, der Töß, der Thur und
dem Rhein vor und hält sich außer der Laichzeit mehr in der
Tiefe auf. Sie lebt gesellig in großen Schaaren beisammen. Sie liebt
hellströmendes klares Wasser mit kiesigem Grund, geht auch in schattige
Waldbäche, steigt aber nicht bis in die Alpengewässer hinauf.
An sumpfigen Orten findet man sie nicht. In Zürich kommt sie bis zum
Ausfluß des Sees herauf. Ein Zugfisch ist sie nicht, sondern bleibt
fast das ganze Jahr in derselben Gegend, und nur zur Fortpflanzung besucht
sie seichtere Stellen.
Nahrung. Die Aesche kann, da ihr Mund klein und mit schwachen wenn
schon spitzigen Zähnen versehen ist, nur Insekten, Würmer, kleine
Wasserschnecken, Fischlaich und Schlamm fressen. Die Schnecken verschlingt
sie mit der Schale. Nach Insekten springt sie, und fängt wohl nahe
am Wasser hinfliegende Insekten im Sprunge. Selbst in schnellfließenden
Wassern kann sie sich Stunden lang an derselben Stelle schwimmend erhalten.
Fortpflanzung. Zur Fortpflanzungszeit sucht sie seichtere und
weniger schnellfließende Wasser auf. Diese Zeit ist der März
die Eier sind etwas größer als Hanfsamen, größer
als die des Lachses und von gelblicher Farbe. Die Vermehrung ist stark.
Die ausgekommenen Fischchen wachsen schnell. Bei uns hat die junge Aesche
keinen besondern Namen und wird leicht von Unkundigen mit andern kleinen
Fischen verwechselt, wenn man die Fettflosse nicht beachtet.
Nutzen. Das Fleisch dieses Fisches ist weiß, derb und wohlschmeckend
und wird sehr gesucht, doch wird es aber weniger theuer, als die Forellenarten
verkauft. Es hält sich einige Tage, je nach der Jahreszeit, frisch.
Da sie oft in Menge gefangen wird, so ist für manchen Fischer der
Ertrag des Fangs ziemlich bedeutend. Escher in seiner Beschreibung des Zürichsees
nennt die Aesche den herrlichsten und gesündesten Fisch vor allen
unsern Fischen, der Geschmack muß sich geändert haben, denn
jetzt werden die Forellen den Aeschen vorgezogen.
Fang. Man fängt die Aesche mit Garnen und an der Angel.
Die Aesche ist ein Gegenstand der Sprungfischerei, der Fang erfordert aber
Erfahrung, denn es ist ein listiger Fisch. Die Alten hatten die sonderbare
Meinung, man müsse einen Floh an die Angel stecken, aber schon Geßner
meinte spaßhaft, man müßte damit sehr subtil umgehen.
Außerdem hat die Aesche viele Feinde, der Fischotter stellt ihr stark
nach, dann aber besonders auch der Flußadler, der Seeadler, die Tauchgänse
und Taucher, und jungen und alten anderer Raubfische.
Schaden thut die Aesche durchaus nicht.
Die Naturgeschichte der andern Arten der Felchen wird in einem andern
Blatt folgen.
Anmerkungen des Uebertragers:
Was dann leider nicht mehr
geschah.
Lachs und Forelle sind offenbar
einfach zu unterscheiden: einen Lachs kann man an der Schwanzwurzel halten,
während eine Forelle rausflutscht.
Der Originaltext ist in Fraktur gesetzt, was bei der Texterkennung einige Schwierigkeiten verursachte.
Die (wissenschaftlichen)
Namen sind die damals Gültigen. Sie stimmen meist nicht mehr mit den
heute gültigen Namen überein.
1) Die Aesche Coregonus
Thymallus.
2) Die große Maräne.
Cor. Maraena.
3) Den Blaufelchen C. Wartmanni.
4) Die kleine Maräne
C. Maraenula.
5) Den Hegling C. Albula.
Die Äsche "C. thymallus"
bekam (wie bereits erwähnt) ihre eigene Gattung und heisst Thymallus
thymallus. Die Coregonen-Systematik ist immer noch strittig, schon die
Anzahl der Chromosomen mit Zahlen (2N) von 36 bis 96, mit der Vermutung
von Polyploidie, deutet auf Schwierigkeiten, welche schon Hartmann und
Steinemann mit den Kiemenreusendornen hatten. Mit jeder neuen Art der Untersuchung,
das vorletzte waren Gel-Elektrophoresen der DNS, nun sind DNS-Sequenzierungen
dran (vorerst der Ribosomen), bieten sich neue Möglichkeiten, die
Phyllogenese abzuklären. Vermutlich wird noch einige Zeit vergehen,
bis sich die Forschergemeinde geeinigt hat.
Masse: 1 Fuss ca. 30.4 cm,
1 Zoll ca. 2.53 cm; 1 Pfund à 32 Loth ca. 500gr.
Home Liste der Neujahrsblätter