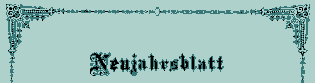
herausgegeben von der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich
Über Grönlands Eisberge. von Arnold Heim
mit 4 Tafeln nach photographischen Originalaufnahmen
Zürich
|
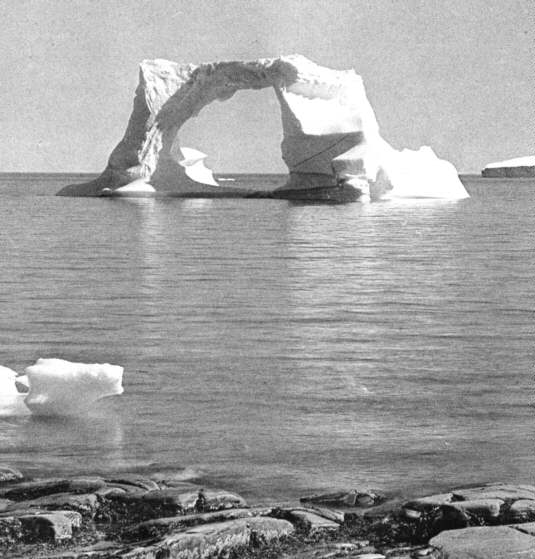
|
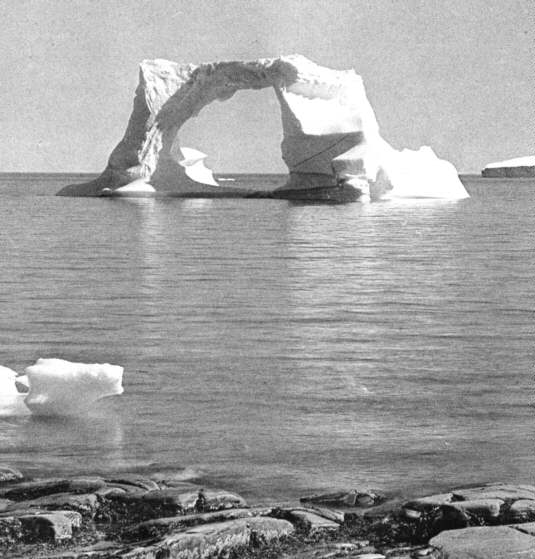 |
Die Abbildungen sind Photo-Lithographien ohne Rasterung der Polygraphischen
Institut A.G. in Zürich
nach Photographien von Arnold Heim
So wie es früher üblich war, im Neujahrsblatt der Zürcher
Naturforschenden Gesellschaft in erster Linie ein Bild zu geben, so möge
auch dieses Jahr wieder die bildliche Darstellung als Hauptsache und der
Text nur als Erläuterung betrachtet werden.
Zweierlei Arten von Eis erfüllten die polaren Meere: Meereis und
Landeis. Das Meereis ist direkt gefrorenes Meerwasser. Ist der polare Sommertag
des nördlichen Grönlands zur Neige gegangen und der erste Stern
am mitternächtlichen Himmel wieder erschienen, so wird es rasch kälter
und kälter, so dass schon im November die Fjorde zugefrieren.
Und wenn im folgenden Jahr Ende Mai oder Anfang Juli dänische Dampfer
nach Grönland fahren, müssen sie südlich vom Kap Farvel
vorbei und in die Davisstrasse steuern. Denn die ganze Ostseite Grönlands
ist den grössten Teil des Jahres mit einem undurchdringlichen Panzer
von Meereis umgeben. Mit der kalten Strömung, die der Ostseite
entlang vom Pole her kommt und die Südspitze Grönlands umgibt,
reicht auch der Eisgürtel noch ein Stück weil in die Davisstrasse
hinein. Durch Strömung, Sturm, Gezeiten und Schmelzen zerbricht
die Kruste in Schollen, die vielfach gestaut, gerundet und übereinandergestossen
werden, wodurch das Packeis entsteht. Als „Hans Egede“ am 9. Juni
1909 nahe von Ivigtüt in Südwestgrönland das Land aufsuchte,
da war das Packeis eben in einzelne treibende Schollen aufgelöst,
zwischen denen sich unser Dampfer mit halber oder Drittels-Fahrt hindurchzuwinden
suchte.
Das Landeis zeigt ganz andere Formen und eine körnige Struktur.
Es kommt von Gletschern und Inlandeis und ist aus Schnee hervorgegangen.
Jeder Gletscher, der ins offene Wasser mündet, bricht in Blöcke,
sobald das Eis nicht mehr auf dem Grunde sitzt. Die Stücke treiben
davon mit den Winden und Gezeiten und Strömungen, im allgemeinen Fjord-auswärts,
dem offenen Meere zu; aber vielfach werden sie wieder durch rückwärts
treibende Winde gestaut. So war es gerade, als wir Anfang August 1909 den
entlegenen Eskimowohnplatz Karajak im Hintergrunde des Umanakfjordes im
nordwestlichen Grönland zu erreichen suchten. Der Eingang des inneren
Fjordes war noch von einem Heer von zusammengetriebenen, mächtigen
Eisklötzen gesperrt. Drei Tage darauf aber blies ein kräftiger
Wind von Osten her und säuberte die Wasserstrasse.
Zwischen Landeis und Meereis gibt es im Küstenbereich auch Mischformen.
So schildert Drygalski unter dem Namen Schelfeis von der Antarktis einen
-4-
Eisgürtel zwischen Inlandeis und Meer, der gebunden ist an den
Bereich des Kontinentalsockels (Schelf) mit seinen Unebenheiten und Untiefen
des Grundes. Von der Landseite her brechen Stücke des Inlandeises
ab, während von der Aussenseite her ein Zuwachs von Meereis stattfindet.
Diese Schelfeismasse bewegt sich nicht aktiv wie das Inlandeis; sie wird
wie das Packeis von den Bewegungen der Gezeiten ergriffen.
Im folgenden soll nur noch vom Landeis, dem Gletschereis oder „grossen
Treibeis“ die Rede sein.
* *
*
Den, der zum erstenmal nach Grönland reist, bringt nichts so sehr
in Erstaunen und Entzücken, wie die weissen Eisgestalten, die auf
den blauen Wassern treiben - die Eisberge. Es ist das Inlandeis,
das sie erzeugt. Die grössten liefert das antarktische Inlandeis,
das vom Festlande her allseitig gegen das offene Meer hin vorstösst.
Philippi bildet gewaltige Klötze ab und spricht von treibenden
Tafeleisbergen von mehr als 30 km Länge und bis 50 m Höhe. In
Grönland hat sich seit der Eiszeit der Eismantel so weit zurückgezogen,
dass ein breiter Küstensaum von Inseln und Halbinseln mehr oder weniger
eisfrei geworden ist. Das Inlandeis ergiesst sich in der Regel in
Form von einzelnen Gletschern in den Hintergrund der Fjorde. Hier,
wo der Grund uneben und felsig ist, können so grosse Tafeln wie in
der Antarktis nicht entstehen. Aber dafür ist die Geschwindigkeit
des Eisvorstosses umso grösser. Am grossen Karajak-Eisstrom,
der 15 km breit und einer der kräftigsten Eisberglieferanten ist,
(in Taf. III, Fig. 3 abgebildet) wurden stellenweise 20 m tägliche
Bewegung gemessen, das ist über 20 mal so viel wie bei einem gewöhnlichen
Alpengletscher. Die Ursache liegt darin, dass statt eines beschränkten
Firngebietes das ungeheure Inlandeis den Gletscherstrom nährt.
Die Eisströme stossen ins Meer, bis etwa 4/5 der Eisdicke unter Wasser
tauchen. Dann trägt das Wasser. In Riesenklötzen
bricht mit gewaltigem Getöse das Eis ab und treibt schwimmend davon.
Noch befindet sich der „Berg“ in seiner ursprünglichen Stellung und
hat die Form einer Tafel; es ist der erste Typus, dem wir begegnen, der
Tafeleisberg (Taf. 1 links, Taf. II rechts, Taf. IV, Fig. 3 links).
Die grössten, die ich sah, kamen vom Karajak-Eisstrom und mochten
etwa 700 m Länge auf 50 m Höhe über Wasser (= ca. 200 unter
Wasser) gemessen haben.
Obwohl das sommerliche Fjordwasser nicht viel über 0° steigt,
schmilzt das treibende Landeis doch rascher unter der Wasserstandslinie.
Es entsteht überall eine Einkerbung, ein Gesimse, an dem man alle
späteren Umstellungen der Eisberge ablesen kann. Die Eisbergtafel
wird unterhöhlt, bis unter gewaltigem
-5-
Donnern seitliche Stücke niederbrechen. Dabei vernimmt man
zuerst einen hellen Knall. Eilig schweift der Blick umher, um unter
der weiss glänzenden Schar den zusammenbrechenden zu finden.
Haushoch spritzt das Wasser am Eisfels auf. Dem Knall folgt ein Rollen
wie Donner. Jetzt ist der Berg aus dem Gleichgewicht geraten und
pendelt noch einige Minuten langsam hin und her, bis er mit schief aufgerichteter
alter Wasserstandsmarke wieder eine neue Gleichgewichtslage gefunden hat.
Unterdessen ist die Welle ringsum fortgeeilt und hat die Nachbarn gerüttelt,
dass es ringsum vielstimmig von neuem zu donnern beginnt. Lag der
eiserfüllte Fjord stundenlang oder tagelang in Ruhe, so ist jetzt
die Stunde des Aufruhrs gekommen. Einer rüttelt den andern, bis alle
schwachen Stellen niedergebrochen sind.
Seltener als das seitliche Abbrechen, aber umso grossartiger ist das
Schauspiel, wenn ein Eisberg sein Gleichgewicht dermassen verloren hat,
dass er sich völlig rundum dreht. Doch man sieht dies am liebsten
vom Lande aus, denn der Wellenschlag kann nur zu leicht das schwache Umiak
1) umwerfen oder zerbrechen. Viele denken sich, die Gefahr der Eisberge
bestehe darin, dass man zwischen zweien zerdrückt werden könnte.
Doch dies ist eine ganz unrichtige Vorstellung. Denn im offenen Wasser,
wo nicht gerade lokale Strömungen einander entgegen ziehen, bewegen
sich die benachbarten schwimmenden Berge stets annähernd gleich rasch
und langsamer als das Boot. Doch muss man sich hüten, einem Eisberg
zu nahe zu treten, dessen Formen einen baldigen Abbruch vermuten lassen.
So würde kein vorsichtiger Reisender oder Eingeborener wagen, etwa
durch die Gasse links an dem Eisbergklotz der Tafel I oder unter dem Tor
der Tafel II vorbei zu steuern.
Hundert Mal kann man das Donnern der Eisberge gehört haben, und
doch wird man immer wieder getäuscht: diesmal ist es doch wirklicher
Donner. Woher kommt der erste scharfe Knall? Das wird jedem klar, der am
Strande die herangetriebenen Eisschollen mit dem Messer zu zerkleinern
sucht, um sie hernach auf dem Petrolfeuer zu schmelzen und das köstliche
Gletscherwasser zu trinken. Mit jedem Messerstich spritzt das Eis
fast explosionsartig auseinander. Es kommt dies von den fein zerteilten
Luftblasen, die sich nun in der höher gewordenen Temperatur und dem
zugleich seit der Loslösung vom Gletscherstrom niedriger gewordenen
Drucke auszudehnen suchen. Und so verstehen wir denn auch den ersten Knall,
denn es handelt sich dabei nicht nur um ein gewöhnliches Abbrechen,
sondern um ein sprengschussartiges Abspringen des Eises.
Am Strande können wir auch die Struktur des Eisbergeises studieren.
Je nach dem Luftgehalt wechselt die Durchsichtigkeit. Aber auch die
Grösse
- 6 -
des Gletscherkornes scheint darauf von Einfluss zu sein. Ein
kleinkörniges Eis ist weniger durchsichtig als ein grosskörniges.
Ich erinnere mich, ganz glas-klare Schollen gesehen zu haben, die aus verzahnten
Eiskörnern von mehr als Faustgrösse zusammengesetzt waren.
Die Verschiedenheit der Durchsichtigkeit und Reinheit hängt mit dem
Ort zusammen, den das Eis einst auf dem Inlandeis und dessen stromförmigem
Abflusskanal eingenommen hat. Das Gletscherkorn wächst mit der
Zeit und der Tiefe.
Während wir in unseren Alpen die Gletscher von Moränenschutt
oft völlig überdeckt finden, überraschen das grönländische
Inlandeis und die von dort kommenden Eisberge durch ihre Reinheit.
Es fehlen im allgemeinen aus dem Inlandeise aufragende Felsen und davon
kommende Moränen, und auch am Grunde kann das Eis nur wenig mächtig
mit Geschieben beladen sein; denn selten sieht man Moränenschutt und
Blöcke auf den treibenden Bergen und Schollen. Es sind fast immer
rein marmorweisse Gestalten, die auf den tiefblauen Wassern treiben, mehr
oder weniger durchschimmernd, mit unbeschreiblich grün-blauen Schatten
und Grotten. Nicht selten findet man auch tief kobaltblaue Bänder,
die den ganzen Berg geradlinig durchsetzen. (Ein schmales solches im Tor
Taf. II, rechter Fuss.) Man traut den eigenen Augen nicht, und das
Entzücken nimmt kein Ende. Damals, als es mir vergönnt
war, mit meinen lieben Zürcher Kollegen de Quervain und Bäbler
den grossen Karajak.Eisstrom (Taf. III, Fig. 3) zu besuchen, da konnte
ich mich überzeugen, woher diese blauen Bänder kommen.
Es sind Spalten des Inlandeises, die mit reinem Schmelzwasser gefüllt
wieder zugefroren sind.
Jetzt gehen wir hinaus in den offenen Fjord und verfolgen das weitere
Schicksal der Eisberge.
Ein zweiter Typus formt sich unter dem Einfluss der warmen Luft, die,
wenn der grönländische Föhn weht, im Hochsommer noch bei
70° Breite 15° C übersteigen kann. Er entsteht nur,
wenn der Eisberg lange Zeit in gleicher Stellung bleibt. Ich erinnere mich,
während meiner über zweimonatlichen Bootreise im nordwestlichen
Grönland einen einzigen solchen gesehen zu haben. Es ist der in Taf.
IV, Fig. 4 abgebildete Eisberg mit seiner gekräuselten Oberfläche,
die wohl nur auf Luftschmelzung zurückgeführt werden kann.
Durch vielfaches Zusammenbrechen entstehen aus den Klötzen und
Tafeln die mannigfaltigsten und wunderlichsten Formen, Zähne, Zacken,
Türme, Tore. Das ist der dritte Typus, dem wir begegnen. Mit jedem
erneuten Abbrechen verändern sie Form und Lage. Wie an den Farben
kann man sich nun auch an den Formen nicht satt sehen. Ist einmal ein Turm
entstanden, dessen breiter Sockel unter Wasser liegt, und bricht dann davon
ein weiteres Stück auf der Seite ab, so stösst der Sockel den
zurückbleibenden Zahn höher gegen den
-7 -
blauen Himmel. So wachsen oft die Charaktergestalten noch bis zu ihrem
letzten Augenblicke (Taf. III, Fig. 2 und Taf. IV, Fig. 3). Nicht jede
Tafel zerfällt in gleicher Entfernung vom Ausgangsort, und so ist
denn auch die ursprüngliche Tafel- und Klotzgestalt nicht nur auf
das Innere der Fjorde beschränkt. Wir finden auch solche noch draussen
im offenen Meer mit anderen in Gesellschaft, die schon mehr vom Schicksal
mitgenommen, aber auch eigenartige und schönere Formen angenommen
haben (Taf. II, Taf. IV, Fig. 2). Sie ziehen durch die Davisstrasse nach
Süden und vergehen. Doch es gibt solche, die noch 2000 km südlich
treiben bis zur Neufundlandbank.
Draussen im offenen Meer begegnen wir neben den früheren Typen
noch einem vierten mit runden Formen. Die kleineren Berge oder Stücke
von solchen gelangen in das Spiel der Wellen; sie werden hin und hergewiegt
von wärmer werdendem Wasser und mehr und mehr glatt geleckt. Die scharfen
Kanten verschwinden. Die einen recken noch eine Spitze in die Höhe,
sind aber unten gerundet wie ein Haifischzahn, andere sind ringsum geglättet.
Ob sie auf blauem Meer und unter blauem Himmel blendend die Sonne spiegeln,
ob sie zwischen grauem Wasser und grauer Luft zart wie Perlen schimmern,
sie ergötzen jedes Auge, das draussen im Unabsehbaren sich nach etwas
Bestimmtem sehnt.
* *
*
Ein Jahr ist vergangen seit jener unvergesslichen Fahrt. Noch
heute ziehen die zauberhaften Eisgestalten an mir vorüber, wie ein
Traum, der sich erneuernd die Seele beglückt.
Bildlegenden:
Tafel I.
Umanak-Fjord und Nugsuaks-Gebirge,
von Umanak aus, Blick nach Süd.
Aufgenommen am 17. August 1909, abends 6h30 (Ortszeit); Zeiss-Protar,
Brennweite 412 mm, Originalgrösse 18 × 24 cm.
Im Hintergrund breitet sich das mit einem frischen Anflug von Neuschnee
bedeckte Gebirge des inneren Teiles der Halbinsel Nugsuak aus. Noch kleben
vom Schneesturm zurückgelassene Nebelstreifen an den Bergwänden,
die bis zu etwa 2000 m Höhe ansteigen. Schmale Lokalgletscherzungen
reichen bis zum Meer, sind jedoch grösstenteils durch die Eisberge
verdeckt, die den Fjord erfüllen.
Der grosse Eisblock in der Mitte mit seiner ausgehöhlten Grotte
hat mindestens die Grösse des Polytechnikums in Zürich, doch
man muss sich stets noch mehr als das 4-fache des vorragenden Eises unter
Wasser dazu vorstellen. Da dieser Eiskoloss drei Tage lang trotz des vorangehenden
Schneesturmes fast genau am gleichen Orte stehen blieb, ist anzunehmen,
dass er auf dem Grund aufgestossen ist.
Der Typus des Tafeleisberges ist auch deutlich ausgesprochen in dem
Eisklotz links im Bilde. Die kleineren Eisschollen im Vordergrund sind
abgebrochene schwimmende Stücke der grösseren Eisberge, die von
den Windströmungen und Gezeiten fortgetrieben werden.
Das Fjordwasser ist rein blau, während die Eisbergschatten und
unterhöhlten Grotten blaugrün erscheinen.
Tafel II.
Gestrandetes Eisbergtor.
Blick nach Südost.
Aufgenommen am 20. Juni1909, mittags 2h; Zeiss-Protar, Brennweite 412
mm, Originalgrösse 18 × 24 cm. Godhavn, Südseite der Insel
Disko.
Der Eisberg, ursprünglich in Tafelform, kam von Osten, wahrscheinlich
von Jacobshavn's Isfjord in die Bucht vor der arktischen, naturwissenschaftlichen
Station hergetrieben, brach Stück um Stück zusammen und drehte
seine Lage, bis das wunderbare Eistor zustande kam. Es ragt nach Schätzung
etwa 30 m in die Höhe. Mehr als eine Woche lang blieb der Eisberg
nahezu an der gleichen Stelle, wobei er sich aber langsam, wohl den Grund
aufwühlend, in verschiedenen Richtungen drehte. Zuerst stand die linke
Ecke turmförmig in die Höhe. Als dann abermals ein unterschmolzenes
Stück niederbrach, wälzte sich der Koloss in die abgebildete
Lage. Der dunkle schräg nach rechts aufsteigende Strich am rechten
Sockel des Tores stellt eine mit tief kobaltblauem Eis gefüllte Spalte
dar, die den Eisberg durchsetzt.
Rechts hinten schwimmt ein Tafeleisberg, doch stösst er bei Ebbe
vielleicht auch schon auf den Grund.
Die Felsen im Vordergrund mit ihrer schwach geneigten Schichtlage gehören
zum Gneiss-Grundgebirge.
Tafel III.
Fig. 1. Umanak-Felsinsel mit Eisbergwand.
Blick nach Nordost.
Aufgenommen am 18. August 1909, morgens 9h, vom Deck des fahrenden
Dampfers „Hans Egede“, mit Handkamera 9 × 12 cm.
Im Hintergrund erhebt sich die wunderbar geformte Umanak-Felsinsel.
Sie besteht aus Gneiss mit Amphibolitlagen, und ist vom diluvialen Inlandeis
im unteren Teil zu Rundhöckern zugeschliffen. Die Eiswand bildet den
Rand eines schwimmenden, etwa 20 m hohen Tafeleisberges.
Fig. 2. Schwimmender Eisberg im Umanak-Fjord.
Blick nach Süd.
Aufgenommen am 18. August 1909, morgens 9h, vom Deck des fahrenden
Dampfers „Hans Egede“, mit Handkamera 9 × 12 cm.
Im Hintergrund liegen die noch mit frischem Schnee bestreuten Berge
der Halbinsel Nugsuak.
Der Eisbergzahn lässt deutlich die sukzessive steigenden Wasserstandsmarken
erkennen, die durch seitliches Abbrechen der etwa 30 m hohen Eiswand bedingt
sind. Die oberste Wasserstandskehle, etwas schräg nach links geneigt,
liegt über der halben jetzigen Höhe der Eiswand. Darunter folgt
noch eine parallele Kerbe. Dann hat sich der Eisberg um etwa 300 links
umgedreht, worauf er in gleicher Richtung ohne weitere Drehung noch in
zwei Hauptetappen und drei darauffolgenden geringeren Bewegungen infolge
weiteren seitlichen Abbrechens der Eiswand in die Höhe stiess.
Fig. 3. Am grossen Karajak-Eisstrom.
Blick nach Nordost.
Aufgenommen am 10. August 1909, abends 7h30; Brennweite 350 mm, Originalgrösse
18 × 24 cm; Standpunkt auf dem Gletscher, unweit Drygalskis ehemaliger
Beobachtungshütte.
Der grosse Karajak-Eisstrom ist einer der bedeutendsten Eisberglieferanten
und Eisabflüsse des grossen Inlandeises, das sich im Hintergrund des
Bildes ausdehnt. Er hat eine Breite von etwa 15 km und ergiesst sich in
den Hintergrund des Umanak.Fjordes. Das Bild zeigt seinen rechten, nordwestlichen
Rand gegen den Karajak.Nunatak und eine Stromschnelle mit wilder
Zerspaltung. Der Blick ist stromaufwärts gerichtet.
Im Vordergrund tritt die schief gegen den Gletscherstrom einfallende,
wohl als Druckschichtung zu deutende Struktur des Eises deutlich hervor.
Der Gletscher ist rein und frei von Obermoränen. Die unbedeutenden
Randmoränen treten auf dem Bilde nicht deutlich hervor.
Tafel IV.
Fig. 1. In den Eisschollen.
Aufgenommen am 9. Juli1909, morgens 10h10, mit Handkamera 9 ×
12 cm; Manek, Vaigat-Sund, Südseite der Halbinsel Nugsuak.
Eine schlimme Nacht ist glücklich vorbei. Noch konnte am
Abend das Motorboot in der eisfreien Bucht ruhig verankert werden. Da brachte
in der Nacht eine Wasserströmung einen riesigen Schwarm von Eisberg-Bruchstücken
aus dem Südosten her, die das verankerte Boot bedrohten. Nun ist es
Ebbe Zahllose kleinere Eisschollen sind am Geröllstrand aufgehäuft
- eine willkommene Wasserquelle; denn es gibt kein besseres Trinkwasser,
als geschmolzenes Gletschereis.
Fig. 2. Schwimmender Eisberg im offenen Meer.
Aufgenommen am 17. Juni 1909, mittags, aus dem fahrenden Motorboot,
mit Handkamera 9 × 12 cm, Exposition ca. 1/150 Sekunde; Ort südlich
Godhavn, Davis-Strasse, 69° Breite.
Aus der ursprünglichen Tafelform ist die wunderbare dreizackige
Eisgestalt ausgebrochen, die eine Höhe von gegen 40 m erreichen mag
und nun auf dem offenen Meere treibt. Infolge leichter Einsenkung der linken
Zacke tritt rechts eine ausgeschmolzene Hohlkehle aus dem Wasser hervor.
Fig. 3. Zwischen kleineren Eisbergen.
Blick nach Nord.
Aufgenommen am 3. Juli1909, abends 6h10, aus dem Ruderboot, mit Handkamera;
Unartoarsuk, Vaigat-Sund, Nordostseite der Insel Disko.
Wir sehen hier drei kleinere Eisberge verschiedener Art nebeneinander:
Links einen horizontal liegenden Tafeleisberg, rechts eine schräg
gedrehte Eisbergtafel, in der Mitte eine schräg gestellte Eisbergzacke.
Auch hier sieht man beim mittleren Eisberg wie bei dem der Tafel III, Fig.
2 die stossweisen Hebungsphasen an den Wasserstandsmarken und die Drehung
des Eisklotzes um etwa 40° nach links. Die oberste Wasserlinie liegt
in etwa 2/3 Höhe; die zweite darunter ist sehr ausgesprochen und erzeugt
eine scheinbar schraubenförmige Gestalt. Die Unterschmelzungen sieht
man auch deutlich am Tafeleisberg links.
Im Hintergrund sind die fernen Berge der Halbinsel Nugsuak sichtbar.
Fig. 4. Schwimmender Eisberg mit Luftschmelzfurchen.
Blick nach West.
Aufgenommen am 17. Juni 1909, mittags, aus dem fahrenden Motorboot,
mit Handkamera 9 × 12 cm, Exposition ca. 1/150 Sekunde; südlich
Godhavn, nahe der Schären von lmerigsok, die links noch hervortreten.
Im grossen ganzen hat der Eisberg seine Tafelform noch erhalten. Man
sieht keine Wasserstandskerben und muss darum annehmen, dass er seit langer
Zeit seine Schwimmlage nicht verändert hat. Infolgedessen konnten
sich die Erscheinungen der Schmelzwirkung in der Luft deutlich ausbilden.
Man sieht - zum Unterschied der glatten Schmelzformen unter Wasser hier
zahlreiche unregelmässige Kerben und Höhlungen auf dem Rücken
des Eisberges. Diese fehlen an der durch eine frische Abrisskehle ausgezeichneten
Wand links, lassen sich aber bereits als sehr feine Unebenheiten an der
etwas weniger frischen Abrissseite rechts deutlich erkennen.