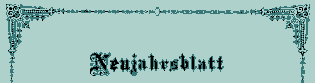
herausgegeben von der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich
Aus der Wolkenwelt. von Alfred de Quervain
mit 3 Tafeln nach photographischen Originalaufnahmen
Zürich
|
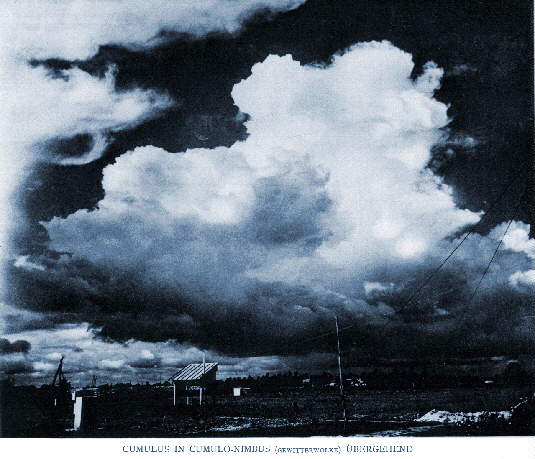
Paris, France
|
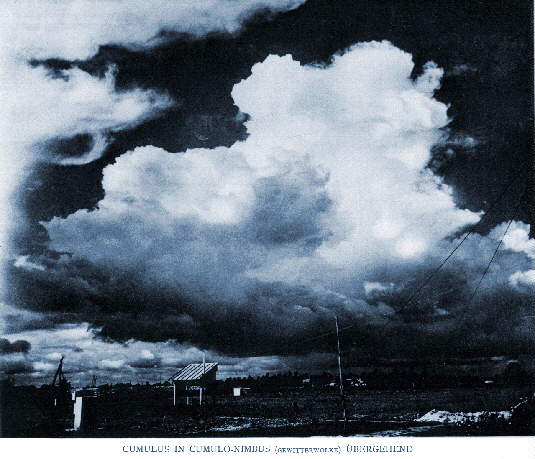 Paris, France |
„Was muss der Gebildete heutzutage von der Wolkenwelt wissen?“ Ich meine,
dass dieser unglückliche Gebildete von heutzutage weder von meiner
Wolkenwelt, noch sonst von irgend etwas Bestimmtem etwas Bestimmtes wissen
muss.
Aber gerade bei so alltäglichen Erscheinungen, wie die, über
welche wir uns jetzt unterhalten werden, lohnt es sich vielleicht am ehesten,
im Vorbeigehen freiwillig dies und das mitzunehmen, was unsere Beziehungen
zu diesem Alltäglichen vertiefen kann.
Und wenn irgend ein Gebiet der Meteorologie alle anziehen wird, die
mit der Natur fühlen, dann ist es das Kapitel von den Wolken!
Besonders an diese Gebilde denkt der grosse Ästhetiker Ruskin,
wenn er von unserer meteorologischen Wissenschaft die begeisterten Worte
sagt: „Ihre Gedanken sind inmitten der Lieblichkeit der Schöpfung;
sie führt die Seele wie das Auge zum Morgennebel, zur Mittagsglorie
und zur Abendwolke; es ist ein Wissen, welches wie wir unwillkürlich
empfinden voll ist von der Seele der Schönheit. Sein Interesse ist
unerschöpflich, unverringert an jedem Ort, zu jeder Zeit. Der, dessen
Reich der Himmel ist, kann nie die Erscheinungen einer Stunde aus schöpfen;
er ist in einem Reich beständigen Wechsels - ewiger Bewegung - endlosen
Geheimnisses.“
Ich muss dem Ästhetiker vollkommen zustimmen, schon deshalb, weil
er die Poesie, die Seele der Schönheit auch ausserhalb der üblichen,
stellenweise öden Pfade der literarischen Zünftler zu finden
weiss. Der ästhetische Genuss ist zwar nicht das Ziel unserer Fachwissenschaft;
aber es ist doch erfreulich, dass das reine, unmittelbare Naturempfinden,
das ich künstlerisch nenne, durch wissenschaftliche Forschung, durch
sachliche Kenntnis nicht etwa, wie man gemeinhin behauptet, gestört
oder unmöglich gemacht werden muss, sondern im Gegenteil bedeutend
entwickelt und vertieft werden kann. Ein gedankliches, tiefes Eindringen
in die Dinge, ein Wissen um ihr Werden und Vergehen ist ein Quell des intensivsten
sich Vertraut- und Einsfühlens mit dem Naturgeschehen um uns her -
soweit dieses Einssein überhaupt unser Wesen erschöpft.
Sobald wir beginnen die Wolken zu studieren, so finden wir, dass Wolkenstudium
und Wolkenbenennung, Wolkenklassifikation sehr nahe zusammenfallen.
Wenn ich von Wolkenklassifikation spreche, mögen Ihnen allerdings
zwei zweifelnde Fragen nahe liegen: Ist es nicht von vornherein ein hoffnungsloses
- 4 -
Beginnen, in dem endlosen Vielerlei des Wolkenhimmels Ordnung zu schaffen?
Kann man diesem Chaos von ineinander übergehenden Gebilden Namen
geben?
Bei näherer Beschäftigung mit den Wolken erkennt man, dass
eine. solche Ordnung tatsächlich zu schaffen ist, weil sie in der
Natur existiert. Es kommt für den Wolkenkenner ein Zeitpunkt, wo er
in der Hauptsache alle Formenmöglichkeiten kennt; und dabei sieht
und meint nicht etwa der eine Beobachter dieses und der andere etwas ganz
anderes; sondern es ist eine Erfahrungstatsache, dass die, welche ihre
Wolkenkenntnis nicht aus Büchern haben, sich gegenseitig sogar über
Einzelheiten sehr gut verständigen.
Nun kann man aber die zweite Frage aufwerfen, ob nicht in verschiedenen
Erdgegenden die Wolkenformen so verschieden seien, dass doch keine allgemein
gültige Klassifikation möglich sei. Zur Beantwortung dieser Frage
sind von einem englischen Meteorologen besondere Weltreisen unternommen
worden, und das Ergebnis war, dass nicht nur für eine bestimmte Gegend
die Zahl der Wolkentypen beschränkt ist, sondern dass auf dem ganzen
Erdenrund in der Hauptsache eben dieselben Formen wiederkehren. Kennen
Sie die launischen Gestalten zu unsern Häuptern einmal, so werden
Sie dieselben am Nordkap ebenso gut wiederfinden, wie am Kap der guten
Hoffnung.
Um die Aufstellung der Grundformen der Wolken hat sich zuerst der durch
Göthes Schriften nicht unbekannte Luke Howard vor ungefähr 100
Jahren durch seine klassische Schrift „On the modifications of clouds“
verdient gemacht. Diese Grundformen, deren Kenntnis fürs erste genügt,
sind so wenig zahlreich, dass man sie an den Fingern herzählen kann.
Zur bessern internationalen Verständigung werden lateinische Wolkennamen
gebraucht, für welche aber meist auch gute deutsche Namen vorhanden
sind.
Man unterscheidet da, um mit den höchsten Wolken anzufangen: zweierlei
Arten von Federwolken, den Cirrus und den Cirrostratus in 8000 bis 10,000
Metern Höhe; dann zweierlei Arten von Schäfchenwolken, feine
und grobe, die Cirrocumulus und Altocumulus, zwischen 6000 und 4000 m Höhe,
und in letztem Höhen auch eine durchgehende Schichtwolke, den Altostratus,
dann zwei tiefere Schichtwolken, die regnende Nimbus und die gutmütige
Stratocumulus genannte, dann auch zweierlei Haufenwolken, die gutartige
Cumulus, die bösartige Cumulonimbus benannt, schliesslich noch zwei
ganz tiefe Winterwolken, den Hochnebel und den Nebel, Stratus und Nebula
in der lateinischen Benennung.
Auf diese Formen wollen wir später näher eingehen, wenn wir
ihre Entstehung besprechen; hingegen sind hier noch einige allgemeine Bemerkungen
über die Klassifikation am Platz.
Es wäre wohl vom wissenschaftlichen Standpunkt am besten, wenn
man die Wolken nach ihrer Entstehung und physikalischen Beschaffenheit
einteilen würde; aber da man zur Zeit, als die Wolkennamen festgesetzt
wurden, noch sehr wenig von ihren Entstehungsumständen wusste, wurden
sie nach ihrer äussern Form,
- 5 -
ihrer Erscheinung klassifiziert; daran hat die Klassifikation festgehalten.
Nun hat aber auch die Einteilung nach der äusseren Form ihre innere
Bedeutung Die Form der Wolke hängt ganz eng mit ihrer Bildungsursache
zusammen. So viel verschiedene typische Wolkenformen wir unterscheiden,
welche immer wieder kehren, so viel verschiedene Entstehungsumstände
gibt es in der Atmosphäre; die Wolke ist also eine sichtbare Ankündigung
eines sonst unsichtbaren Vorgangs von bestimmtem Charakter. Die verschiedenen
Wolkenformen bilden zusammen die Elemente einer Hieroglyphenschrift am
Himmel, und wenn man diese Hieroglyphen zu lesen versteht, dann sind sie
wertvolle Wetterzeichen; von diesen Wolken-Wetterhieroglyphen werden wir
später noch einige kennen lernen.
Es schwebt jede Form in einer besondern Höhe; allerdings kommen
im Einzelfall bedeutende Abweichungen vom Mittelwert vor. Aber daran ist
doch festzuhalten, dass mehrere Wolkenarten, wenn sie zugleich am Himmel
stehen, relativ zu einander eine ganz bestimmte Höhenfolge innehatten,
mit Ausnahme der Cumuluswolken, die wie ein Lift alle Wolkenetagen durchbrechen.
Es seien z. B. zugleich Federwolken, Schäfchen und sogenannte Stratocumuluswolken
am Himmel: dann schwebt unter allen Umständen die Federwolke am höchsten,
dann folgen die Schäfchen und zu unterst der Stratocumulus. Es ist
leicht einzusehen, dass ein solches Gesetz bei der Wolkenklassifikation
sehr wichtig ist.
Dadurch, dass man den Himmel häufig längere Zeit beobachtet,
erlangt man eine gewisse Fähigkeit, die dem Anfänger noch abgeht,
sich die Wolkengebilde und die sie trennenden Räume richtig plastisch
vorzustellen; das bringt grossen Genuss. Es handelt sich darum, auf den
ersten Blick richtig zu erfassen, welche Teile einer Wolke wirklich in
die Höhe ragen, und welche sich nur in der Perspektive so darstellen,
und tatsächlich einfach horizontal nach vorn oder hinten verlaufen.
Der Eindruck wird dadurch oft ein ganz anderer. Es ist nicht gleich gültig,
ob wir nur ein Wolkenband vor uns sehen, das wenige hundert Meter Mächtigkeit
hat, und nur perspektivisch in die Höhe ragt, oder ob es in Wirklichkeit
eine Wolkenburg ist, die sich zu doppelter Montblanc-Höhe türmt.
Aus was bestehen die Wolken? Ohne Zweifel aus Wasser! Es interessiert
uns aber, in welcher Form dies Wasser besteht. Da ist nun zu unterscheiden
zwischen Wolken der höchsten Regionen, die aus ganz feinen Eisnädelchen
zusammengesetzt sind, und tieferen Wolken, die aus Wassertröpfchen
bestehen. Diese Tröpfchen sind so klein, dass es ihrer etwa 250 Millionen
braucht, bis sie zusammen nur ein Gramm wiegen. Ein so leichtes Tröpfchen
fällt in einer Stunde nicht mehr als 30 - 40 m; so begreifen wir,
wie eine Wolke sich schwebend in der Luft halten kann.
Es ist zu der Frage des Schwebens der Wolken noch daran zu erinnern,
dass eine Wolke ja gar nicht fortwährend aus den gleichen Teilchen
besteht; manche gehen ab und verdunsten, andere kommen immer neu dazu,
die Wolke bleibt nur scheinbar dieselbe.
- 6 -
Warum bildet sich aber eine Wolke? Dies geschieht aus dem gleichen Grund,
weshalb sich Nebel bildet. Es ist Ihnen bekannt, dass die Luft immer eine
gewisse Menge von Wasser enthält, aber in unsichtbarer Gasform. Je
wärmer es ist, um so mehr Wasserdampf kann die Luft unsichtbar in
sich aufnehmen; bei den Sommertemperaturen unserer Gegenden bis zu etwa
25 g im Kubikmeter. Umgekehrt muss die Luft, wenn sie unter eine gewisse
Temperatur abgekühlt wird, einen Teil des Wassergases in Form von
flüssigen Tröpfchen kondensieren. Nur beiläufig sei bemerkt,
dass diese Wassertröpfchen sich mit grösster Vorliebe an die
in der Luft vorhandenen feinsten Staubteilchen ansetzen.
Also Wolkenmaterial bildet sich immer, wenn feuchte Luft sich genügend
abkühlt. Je nachdem die besonderen Umstände dieser Abkühlung
beschaffen sind, darnach gestaltet sich auch die Wolkenform. Die uns sonst
geläufigen Abkühlungsvorgänge sind: Abkühlung durch
Wärmeausstrahlung oder Wärmefortleitung; diese beiden spielen
aber in der Atmosphäre eine untergeordnete Rolle; eine sehr grosse
Rolle dagegen folgender Vorgang, der speziell den gasförmigen Körpern
eigen ist: Wenn eine Luftmasse unter geringem Druck kommt, als sie vorher
war, so wird sie notwendig auch kälter, als sie vorher war, und dies
aus keinem andern Grund, als weil sie sich bei dieser Verminderung des
Druckes ausdehnen und da bei Arbeit leisten muss. Wenn z. B. das Barometer
sehr schnell fällt, wird schon wegen dieser Druckabnahme die Luft
ein bisschen kälter; allerdings ist es nicht merklich.
Nun ist bekannt, dass der Luftdruck in dem Masse, wie man sich in die
Höhe erhebt, sehr schnell abnimmt. In 2500 m Höhe besteht bloss
etwa 2/3 des Drucks am Erdboden. Es wird sich darum eine Luftmasse, die
in die Höhe steigt, verhältnismässig stark abkühlen.
Auf je 100 m Steigens macht es zufällig genau einen Grad Abkühlung
aus, diese Art von Abkühlung (adiabatische Abkühlung genannt)
ist bei der Wolkenbildung sehr häufig, ja geradezu der wichtigste
Faktor.
Wir können jetzt an die Besprechung der Entstehung einzelner Wolkenformen
gehen, und ich will den Versuch machen, Ihnen das Entstehen dieser Formen
hier, vielleicht zum erstenmal, von einem einheitlichen Gesichtspunkt aus
zu entwickeln.
Versetzen wir uns in den frühen Morgen eines klaren Septembertages.
In der langen Nacht hat die Wärmeausstrahlung gegen den Weltraum die
Erdoberfläche stark abgekühlt, und damit auch die dem Boden nahen
Luftschichten. Diese werden so kalt, dass der Taupunkt erreicht wird; es
scheiden sich Nebeltröpfchen aus und höher und höher steigt
die Nebelschicht, an ihrer Oberfläche sich weiter abkühlend und
deshalb weiter in die Höhe wachsend.
Nun ist aber die Sonne aufgegangen und die Wärmestrahlen haben
durch den Nebel hindurch den Boden etwas erwärmt; so sind auch die
untersten Luftschichten in Berührung mit dem Boden wärmer geworden,
und der Nebel hat sich unten aufgelöst. Nur oben schwebt, einige hundert
m über uns, noch eine
-7-
Decke, der Hochnebel oder Stratus. Bald aber steigt vom Boden wärmere
Luft auch dorthin, die Decke zerreisst, es schwimmen nur noch einzelne
niedrige Fetzen herum, die Fractostratus. Dann verschwinden auch diese.
(Der Stratus bedeutet als Wetterzeichen trockenes Wetter; wenn schnell
aus Osten ziehend, eventuell ganz schwache Regen.) Die Sonne wärmt
jetzt den Boden und die ihm aufliegenden Luftmassen immer mehr; die warme
Luft wird leichter und fängt deshalb an, in einzelnen unsichtbaren
Luftsäulen in die Höhe zu steigen; dabei wird sie aber bei je
100 m Aufsteigens um 1 Grad kälter, wie wir schon wissen; und schliesslich
sehen wir, nach dem, was wir früher besprochen, den Augenblick kommen,
wo diese aufsteigende Luft nicht mehr allen Wasserdampf in unsichtbarer
Form in sich behalten kann, sondern anfängt, einen Teil davon auszuscheiden.
In diesem Augenblick erscheint an dem vorher blauen Himmel das erste formlose
Wölkchen, Fractocumulus genannt. Bald bekommt es eine bestimmte Gestalt,
unten eine flache Basis, oben einen runden Gipfel; es ist ein richtiger
kleiner Cumulus; seine Höhe über dem Boden lässt sich annähernd
berechnen aus dem Feuchtigkeitsgrad, den die Luft beim Verlassen des Erdbodens
hatte; je trockener diese Luft war, desto höher oben bildet sich die
Wolke; meistens schwebt sie 1000 bis 2000 m über dem Boden. Oft kommt
es an einem Tag nicht weiter als bis zur Bildung vieler kleiner neben einander liegender
Cumuli (Fig. 1, Taf. II); gegen Abend vergehen sie wieder, was sich zuerst
an den zerfransten Umrissen erkennen lässt; oder dann stossen sie
immer mehr mit ihren Rändern aneinander, es bleiben nur kleine Lücken,
die Gipfel der einzelnen Cumuli werden flach; es entsteht eine einheitliche
Wolkendecke in 1500 bis 2000 m Höhe, Stratocumulus genannt, und von
einem für das kommende Wetter günstigen Charakter. Für diese
Wolkenform gibt es noch andere Entstehungsweisen; ich führe nur diese
an.
Oft bleibt aber der Cumulus nicht so klein, sondern wenn die Zufuhr
von Luft von unten her sehr gross ist, steigt sein Gipfel hoch empor, vielleicht
2000 bis 3000 m über die Basis, und man bemerkt ein gewaltiges Wallen
und Arbeiten in der Wolkenmasse. Was die Wolke immer höher hinauftreibt,
ist ihr Überschuss an Wärme gegenüber der umgebenden Luft
in gleicher Höhe Und diese relative Erwärmung rührt her
von der Kondensation des Wasserdampfs, bei welcher bekanntlich immer Wärme
frei wird. Je dampfreichere Luft also in der Wolke aufsteigt, desto stärker
wird sie in die Höhe streben. Noch hat die Wolke einen gutmütigen
Charakter und in den meisten Fällen wird sie ihren Gipfelpunkt erreichen,
indem sie in einer Höhe von ca. 4000 m an eine Luftschicht mit anderer
Temperatur und Strömungsrichtung stösst, in welche sie nicht
eindringen kann. Ihr Gipfel läuft dann oft in einen flachen Kuchen
auseinander; diese flachen, hochschwebenden Decken verschiedener Wolkenindividuen
vereinigen sich, und die untern Teile der Cumulussäulen verschwinden;
so entsteht eine hoch schwebende Wolkenschicht, etwa in 4000 m Höhe,
welche ganz analog sich ge-
-8-
bildet hat, wie der schon erwähnte Stratocumulus; nur dass diese
hier in einem viel höhern Niveau schwebt. Diese Decke, die dem entspricht,
was man in der Wolkenkunde Altostratus nennt, zerteilt sich nun immer mehr
in einzelne Flocken und Ballen, in die Altocumulus-Wolken (Fig. 1, Taf.
III). Dies ist eine Entstehungsart des Altostratus und der Altocumulusformen;
nicht die häufigste, aber diejenige, die sich am leichtesten erklären
lässt. Es kommen in dieser Höhe von 4000 m noch manche andere
Schäfchenwolken vor, die sich dadurch auszeichnen, dass sie ihre Gestalt
sehr schnell wechseln und von einer Varietät in die andere übergehen.
Bald sind es grobe Ballen, bald feine, zarte Bällchen, oder es ordnen
sich auch die Schäfchen zu eigentlichen Reihen, wie Wasserwogen an.
Man hat es hier auch tatsächlich mit Luftwogenbildungen zu tun, die
ganz den Wasserwogen entsprechen. Diese Luftwogen bilden sich dann, wenn
zwei Luftströmungen mit verschiedener Bewegung und verschiedener Temperatur
scharf abgegrenzt übereinander weglaufen; es treten dann die gleichen
physikalischen Bedingungen ein, die bewirken, dass der Wind eine glatte
Wasserfläche in Wellen legt.
Die Luftwogen haben je nach den Umständen Längen bis zu mehreren
tausend Metern. Im Wellenkamm kann dann die Luft um einige hundert Meter
gehoben werden. War die Grenzschicht schon vorher ziemlich feucht, so genügt
die Abkühlung, welche, wie wir wissen, bei einer solchen Hebung eintritt,
um den Wassergehalt zur Kondensation zu bringen; so wird der Kamm der Luftwoge
als Wolkenstreifen sichtbar. Andere Vorgänge können auch zur
Hebung und Kondensation der ganzen feuchten Grenzschicht führen.
Das Auftreten solcher Schäfchenwolken ist kein gutes Wetterzeichen;
der Volksmund sagt, es seien Wölfe in Schafskleidern. In der Schweiz
treten gewisse Formen von ihnen speziell vor F ö h n auf; ganz gleiche
Formen sah ich auch als Begleiter des grönländischen Föhns
erscheinen. Eine andere Form von Schäfchenwolken, die sog. Altocumulus
castellatus, sind wichtige Gewittervorboten; sie sind dadurch gekennzeichnet,
dass sich über das Niveau der Schichtwolken kleine weisse Köpfchen
wie Cumuli erheben (in ungewöhnlich starker Ausbildung in Fig. 3,
Taf. III); oder es kommt auch vor, dass eine eigentliche flache Schicht
ganz fehlt und sich nur viele kleine Köpfchen zu einer Schicht aneinander
reihen. Nach meinen eingehenden Beobachtungen traten fast ausnahmslos in
einer Gegend Gewitter ein etwa 10 bis 20 Stunden, nachdem solche Wölklein
sich gezeigt hatten. Die am meteorologischen Institut in Zürich ausgeführten
Ballonmessungen haben den Zusammenhang zwischen diesen Wolken und dem Auftreten
von Gewittern in jüngster Zeit aufgeklärt, durch den Nachweis,
dass sie sich immer bei ungewöhnlich starker Temperaturabnahme in
höhern Schichten bilden, welche ja Gewitter begünstigt.
Kehren wir zu der Cumuluswolke zurück, von der wir ausgegangen
sind, und die wir verlassen haben, als ihr Gipfel etwa 4000 m Höhe
erreicht hatte,
- 9-
und nicht mehr höher steigen konnte, sondern in jener Höhe
flach sich ausbreitete. Nehmen wir jetzt an, jene störende Schicht,
die den Cumulusturm am Steigen hinderte, sei nicht vorhanden gewesen, oder
das Zuströmen und Aufquellen in der Wolke sei so stark gewesen, dass
jene Schicht durchbrochen worden sei. Dieses Durchbrechen macht sich oft
durch die Bildung von kleinen seideglänzenden Schleiern und Käppchen
oben auf dem Scheitel der Cumuluswolke geltend, das sehr charakteristisch
ist, und ein ziemlich sicheres Gewittervorzeichen ist (siehe Taf. III,
Fig. 4). Nun kann der Wolkenturm noch tausende von Metern hinaufwachsen,
wahrhaft gigantische Dimensionen annehmend. Noch hat die Wolke einen gutmütigen
Charakter, der sich aus ihren runden, vollen Formen erkennen lässt.
Aber der Gipfel ist jetzt so hoch gestiegen, dass er sich weit unter Null
Grad abgekühlt hat; jetzt naht der grosse Moment im Leben der Wolke.
Mit dem Scheitel des Gebildes geht binnen weniger Minuten eine überraschende
Veränderung vor sich: die bisher scharfen, runden Umrisse der Kuppen
verflachen sich und fasern in seitlich ausfliessende, weisse Massen aus,
die nun nicht mehr aus Wassertröpfchen, sondern aus Eisnadeln bestehen.
Mit dieser äussern Umwandlung hat sich zugleich der ganze Charakter
der Wolke verändert; denn jetzt prasseln auch schon die ersten schweren
Tropfen aus der Unterseite der Wolke, und rollt der erste Donnerschlag.
Der Cumulus ist zum Cumulo-Nimbus, zur Gewitterwolke geworden. Und nun
kann die Wolke ins Masslose zunehmen. Aus ihrem Haupt wächst der Eisnadelschirm
schnell hervor, meist in charakteristischer Ambossform, wie Fig. 3, Taf.
II zeigt. Bald reckt sich dieser Wolkenschirm viele Stunden weit, gespenstisch
drohend, über das Land, die Sonne verschleiernd und das Unwetter verkündend.
Der Körper der Wolke selbst ist jetzt der Schauplatz der wildesten
Wirbelbewegungen; wir wissen das von Luftschiffern, die wider ihren Wunsch
in das Chaos einer Gewitterwolke hinein gerieten: Ihr Fahrzeug wurde wild
geschüttelt, das Gas aus der Hülle gequetscht und das schwere
Schleppseil in den heftigsten Bewegungen bis zum Korb hinauf gewirbelt.
Beim Abziehen der Gewitterwolke zeigt sich die untere Seite der Wolke
nicht selten mit halbkugeligen Gebilden wie mit Guirlanden bedeckt; der
Engländer nennt sie deshalb festoon cloud, die Wissenschaft Busenwolken
oder Mammato-cumulus.
Die untern Wolkenpartieen der Gewitterwolke verschwinden schliesslich,
nachdem sich das Gewitter ausgeregnet hat, die obern in 6000-9000 m Höhe
schwebenden aber ziehen weiter, zunächst noch als ziemlich kompakte
aber weisse Masse, wie das Bild 4, Taf. II zeigt, im Laufe der Stunden
und sogar der Tage aber von den verschiedenen Luftströmungen zu immer
feineren Locken und ganz langsam sinkenden Streifen ausgesponnen. So entstehen
die meisten Federwolken, die Cirrus oder Cirrostratus. Es gibt aber noch
weitere Cirrusformen, die auf eine etwas andere Weise entstanden sein dürften,
wie ich zum Schlusse noch kurz an deuten möchte.
- 10 -
Die Kenntnis des Aufbaus der Gewitterwolke gibt uns nämlich unmittelbar
das Verständnis für einen noch viel ausgedehntem Wolkenkomplex;
denken Sie sich die horizontalen Dimensionen einer Gewitterwolke verhundertfacht,
und Sie bekommen die Wolkenbedeckung jener grössern Gebiete niedrigen
Luftdrucks, der barometrischen Depressionen, die uns von Westen her schlechtes
Wetter zu bringen pflegen. Die der Depression voraneilenden Federwolken
mit ihren Ringen um Sonne und Mond sind Ihnen ja als Vorboten eines Wetterumschlages
wohlbekannt. Ihnen folgen in unserm Lande zunächst meist Föhnschäfchen,
dann erst die geschlossene graue Decke des Altostratus, und bald auch die
tiefere regenbringende Nimbusdecke. Steigt dann das Barometer wieder, so
treten oft grosse Cumulus und Cumulo-Nimbus mit wechselndem böigen
Wetter auf, die besonders für das „Aprilenwetter“ charakteristisch
sind.
Vergessen wir aber jetzt Wolkenzeichen und Wetterregeln, lateinische
Namen und die Wissenschaft, und behalten wir nur den Eindruck, dass wir
nicht in einem Reich toter Formen geweilt haben, auch nicht in einem Chaos,
sondern in einer Welt lebendiger, organisch wachsender und vergehender
Gebilde. Und bevor wir uns ganz von unserm Gegenstand trennen, betrachten
wir noch einmal, nun nicht mehr vom Erdboden, auch nicht nur vom Ballonkorb
aus, sondern aus der weiten Ferne des Weltraums unsern Planeten, unsere
Erde, mit ihren rötlichen Land massen, ihren grünen Meeren, wie
sie umschwebt ist von einem Strahlenband silberhell glänzender Schleier;
da werden wir die Majestät der kosmischen Intuition des uralten Dichters
nachempfinden, der zum Weltenschöpfer spricht:
Du hast die Erde in das Nichts gehängt;
In Wolken hüllst du sie, wie in ein Kleid!
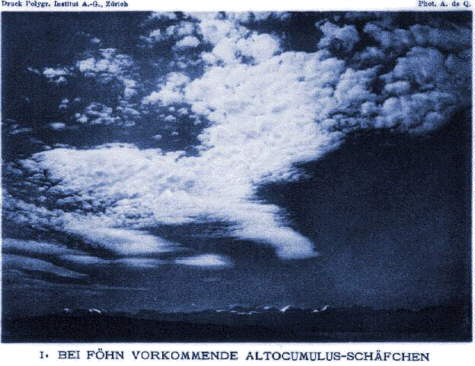 |
Tafel III: Abb. 1
Bild 1. Schäfchenwolken, in etwa 4000 m Höhe schwebend (Altocumulus), besonders in den dem Horizont nähern Partien den Charakter der Föhnwolken zeigend; die Alpenkette ist sichtbar, wie dies bei Föhnsituation der Fall zu sein pflegt. Aufnahme des Verfassers vom Zürichberg nach Süden. Photo:
|