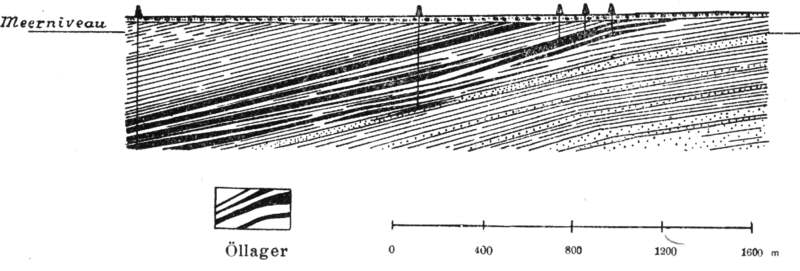
Ausstreichende und auskeilende Schenkellager
Los Angeles Kalifornien
nach Ralph Arnold
|
Inhalt:
|
V. Abtragung des Festlandes. - Entleerung
der Öllager.
...
Nachdem ein offenes Öl- und Gaslager sein Öl und Gas gänzlich
verloren hat, erinnern häufig noch Salzwasser- und Schwefelquellen
an den ursprünglichen Gehalt; beide sind daher für Schenkelgebiete
von Ölantiklinalen bezeichnend. Schliesslich fallen auch sie der gänzlichen
Aussüssung durch das atmosphärische Wasser zum Opfer, das nimmermüde
die offenen Ölhorizonte aufs gründlichste durchspült. Wenn
auf diese Weise die natürliche Abtragung des Festlandes und die Arbeit
des atmosphärischen Wassers im Laufe der Zeiten die Ölvorräte
des Erdinnern vernichten, so beteiligt sich seit einem halben Jahrhundert
auch das Menschengeschlecht an diesem Zerstörungswerke der Natur.
Denn es hat seit dem Jahre 1857 gelernt, mit künstlichen Bohrlöchern
von Bruchteilen eines Meters Durchmesser und von bis über fünfzehnhundert
Metern Tiefe die undurchlässigen Hüllschichten zu durchstechen,
die die Öllager des Erdinnern bedecken und beschützen, und auf
diese Art früher ungeahnte Schätze mit spielender Leichtigkeit
zu heben. Seither sind in den verschiedensten Ländern und Erdteilen
Hunderte und Hunderte von Ölfeldern, Hunderttausende von Ölbohrungen
entstanden.
Wenn ein unterirdisches Öllager, in dem Öl und Gas unter
einem bis zu hundert Atmosphären steigenden Drucke hermetisch eingeschlossen
sind, angebohrt wird und damit Öl und Gas urplötzlich von dem
schweren auf ihnen lastenden Drucke befreit werden, so geschieht im grossen,
was bei einem Heronsball im kleinen. Öl und Gas drängen durch
die geschaffene Öffnung ungestüm an die Erdoberfläche, und
da gleichzeitig unter dem verminderten Drucke die Löslichkeit des
Erdgases im Erdöl sich gewaltig vermindert, entweicht der grösste
Teil des bisher im Erdöl gelösten Gases schäumend und spritzend.
Eine gewaltige Säule von Öl, Gas und mitgerissenem Sand steigt
unter betäubendem Getöse, gelegentlich bis über hundert
Meter, in die Luft empor, wobei die Öl- und Sandteilchen durch das
Gas zerstäubt und über die ganze Umgebung ausgestreut werden.
Das ist das glänzende Schauspiel der Ölspritzer, das namentlich
für die Anfangsperiode aller grossen Ölfelder bezeichnend ist.
Diese Spritzer entwickeln beim Anbohren oft explosive Heftigkeit; Bohrröhren
werden ausgeblasen, schwere gusseiserne Klappen im Bohrloch zertrümmert;
neben Öl und Sand werden selbst grössere Steine aus dem Öllager
mitgerissen und in die Luft geschleudert. In manchen Gebieten, so auf Apscheron,
kann die ausgeworfene Sandmasse der Ölmenge gleichkommen. Alle paar
Minuten wird dann das Bohrloch durch Sand verstopft, wodurch eine kurze
Pause entsteht, auf die nach Beseitigung des Widerstandes ein um so heftigerer
Ausbruch folgt! Ja, bei sehr sandreichen Brunnen wird oft die Bohrmaschine
begraben unter dem ausgeworfenen Sande; das Dach des Bohrturmes stürzt
unter der Sandlast zusammen, und um die Austrittsöffnung häuft
sich ein Kegel von weichem, fliessendem, öligem Schlamm, in dem alles
verschwindet. Das durch solche Ausbrüche erzeugte Getöse kann
meilenweit vernommen werden und der Untergrund im Umkreis von einem halben
bis einem ganzen Kilometer erzittern.
Wenn aber in der Folge immer neue Bohrungen auf dasselbe Öllager
niedergebracht werden und so schliesslich die bedeckende Hüllschicht
wie ein Sieb durchlöchert ist und durch alle diese Öffnungen
fortwährend Gas und Öl entweichen, so nimmt selbstverständlich
der in der. Lagerstätte herrschende Druck immer mehr ab und wird der
Öl- und Gasvorrat immer kleiner. Darum sind die ersten Brunnen eines
Feldes gewöhnlich die grössten Spritzer; später werden die
Brunnen schwächer und schwächer; schliesslich hört im Felde
das Spritzen, ja selbst das selbsttätige ruhige Ausfliessen auf; nun
müssen die Bohrungen gepumpt werden. Aber auch das hat einmal ein
Ende; es kommt die Zeit, wo man selbst durch Pumpen keinen befriedigenden
Ertrag mehr erzielt. Nunmehr ist das Öllager erschöpft; dieser
Moment erscheint einmal, früher oder später, unausbleiblich bei
jedem einzelnen Brunnen wie bei jedem ganzen Ölfelde.
Jeder Brunnen wie jedes Ölfeld hat also eine bestimmte Lebensdauer,
die vom Reichtum, der Konzentration und dem Drucke der Lagerstätte,
sowie von der Intensität der Ausbeute abhängt. Die längste
mir bekannte Lebensdauer einer Ölbohrung ist drei bis vier Jahrzehnte.
Alle Brunnen, die über ein Jahrzehnt gut produziert haben, sind sehr
langlebige Brunnen. Unzählige haben nur einige Monate, einige Wochen,
ja selbst nur einige Tage Öl geliefert. Die durchschnittliche Lebensdauer
der Ölbrunnen dürfte auf Bruchteile eines Jahres bis mehrere
Jahre angegeben werden. Die Lebensdauer ganzer Felder ist natürlich
grösser, oft eine Anzahl Jahrzehnte.
Während der Ertrag einer natürlichen Ölquelle von Bruchteilen
eines Liters bis auf höchstens mehrere hundert Liter im Tage steigen
kann und gewöhnlich nur einige Liter beträgt, ist die grösste
Produktion in vierundzwanzig Stunden, die je durch eine Bohrung erzielt
worden ist, fünfundzwanzigtausend Tonnen, das heisst fünfundzwanzig
Millionen Kilogramm oder etwa achtundzwanzig Millionen Liter. Das ist eine
Ölmenge, die zu ihrem Transporte hundert Eisenbahnzüge von je
fünfundzwanzig Wagen benötigen würde, die bei einer Mächtigkeit
des Ölsandes von zehn Metern und einem Porenraum von dreissig Prozent
ein Quadrat von hundert Metern Kantenlänge oder einen Kreis von sechzig
Metern Radius bedecken würde. Es ist nicht verwunderlich, dass solche
Erträge höchstens einige Tage anzuhalten pflegen.
Alle Brunnen, die einmal über tausend Tonnen in vierundzwanzig
Stunden gegeben, können als sehr reiche, alle, die hundert Tonnen
gegeben, als gute Brunnen bezeichnet werden. Man beutet aber gelegentlich
noch Bohrungen aus, die nur ein Fass, das heisst hundert bis zweihundert
Liter im Tage liefern. Als Durchschnittsertrag der Ölbohrungen könnte
man vielleicht einen Bruchteil einer Tonne bis mehrere Tonnen angeben.
Die Gesamterträge einzelner Brunnen können bis auf mehrere
Millionen Tonnen steigen; das sind dann allerdings ungeheure Produktionen,
die der gesamten Jahresproduktion von Galizien oder Hinterindien gleichkommen.
Die totale Jahresproduktion an Erdöl erreichte vor dem Weltkrieg
fünfzig Millionen Tonnen und wird damit an Wert nur noch von Kohle
und Eisen übertroffen. So gross diese Zahl anmutet, so steht sie doch
mit unserer ganzen bisherigen Darstellung in Einklang. Denn da allein der
jährliche Ertrag der Seefischerei schon viele Millionen Tonnen beträgt,
so muss die Gesamtmasse der jährlich absterbenden Fische noch viel
grösser sein, steht also mit der jährlichen Ölproduktion
in derselben Grössenordnung. Wie viel mehr muss die demgegenüber
noch weit bedeutendere, ja unerschöpfliche Mikrofauna der Meere genügen,
um die Erdölmengen des Erdinnern zu erklären.
Die gesamte bisher, das heisst in den vergangenen sechs Jahrzehnten
gewonnene Ölmenge beträgt rund siebentausend Millionen Fass oder
über eine Billion Liter oder über tausend Kubikkilometer. Diese
Menge würde also einen Würfel von zehn Kilometern Kantenlänge
ausfüllen. Und doch scheint selbst eine solche Masse klein, sobald
wir sie mit dem ganzen Planeten ins Verhältnis setzen; denn auf die
Erdoberfläche verteilt, würde sie um den Erdball nur eine dünne
Haut von zwei Millimetern Dicke bilden.
Von dieser Menge sind gegen zwei Drittel durch Nordamerika, beinahe
ein Drittel durch Russland geliefert worden. Alle übrigen Länder
beteiligten sich bisher nur mit einigen Prozenten oder gar nur mit Bruchteilen
eines Prozentes an der Weltproduktion. Während aber die amerikanische
Produktion auf weite Gebiete verteilt ist, stammt der russische Ertrag
fast ausschliesslich von einem kleinen Fleck Erde auf der Halbinsel Apscheron.
Von dort, von einer Fläche von fünfundzwanzig Quadratkilometern
in der Umgebung von Baku, stammt nahezu ein Drittel der bisherigen Weltausbeute.
Das ist der grösste Bodenschatz, der je von Menschen gehoben, die
grösste Energiekonzentration, die menschlicher Ausbeute zugänglich
geworden. Nicht Gold und nicht Diamanten können mit solchem Reichtum
wetteifern!
Man hat zur Erklärung derartigen Ölreichtums immer wieder
und noch bis in die neueste Zeit zur Annahme rätselhafter Massenmorde
in den Meeren der Vorzeit gegriffen; doch wäre das nur ein neu auftauchender
Sonderfall der alten, abgetanen Katastrophentheorie. Wir haben demgegenüber
auf den vorangegangenen Blättern zu zeigen versucht, dass die Erdölbildung
einen über grosse Flächen und lange Zeiträume ausgedehnten,
allgemeinen, anhaltenden und stetigen Naturvorgang darstellt. Die ungeheuren
Anhäufungen mancher Öl- und Gaslagerstätten, die vor allem
den Menschen in Erstaunen versetzen, haben wir dann weiter geschildert
als entstanden durch zweimalige Anreicherung, erstens durch eine vermutete
beschränkte Anreicherung gegen die Ölhorizonte hinaus den darüber
und darunter liegenden Hüllschichten zur Zeit der Gesteinsverfestigung,
zweitens durch sicher nachgewiesene weite Wanderungen und bedeutende Anreicherungen
innerhalb der Ölhorizonte nach der Gesteinsverfestigung und besonders
während der Gebirgsfaltung, wodurch, was einst ausgebreitet lag über
Hunderte von Quadratkilometern, nunmehr aufgespeichert ist innerhalb einer
Fläche von einigen wenigen Quadratkilometern!
Allverbreitet wie Leben und Sterben auf Erden ist das Erdöl innerhalb
der grossen Grabstätte unseres Planeten, der sedimentären Erdkruste.
Das heutige Vorhandensein wäre ein noch unvergleichlich viel allgemeineres,
wenn nicht die oberflächennahen Gesteinsschichten durch den Kreislauf
des Wassers grossenteils entleert wären, so dass die gegenwärtigen
Vorkommen nur äusserst lückenhaft und fragmentarisch sind, verglichen
mit dem ursprünglichen Verbreitungsgebiet. Denn das atmosphärische
Wasser ist der Todfeind aller Öllagerstätten. Wie es alle Kalilager
und alle Kochsalzvorkommen vernichtet, die es einmal erreicht hat, so gibt
es, wo es einmal in eine Öllagerstätte eingedrungen ist, keine
Rast und Ruhe, bis Gas und Öl gänzlich ausgetrieben, das Salzwasser
gänzlich ausgesüsst ist; dann erst tritt wieder Gleichgewicht
ein. Eine offene Lagerstätte ist daher eine Lagerstätte ohne
Gleichgewicht; sie ist in beständiger Zerstörung begriffen. Allein
in einem geschlossenen Öllager herrscht Gleichgewicht und Ruhe.
Die sedimentäre Erdkruste zerfällt nach diesen Gesichtspunkten
in zwei grosse Sphären, die ich in neuer Verwendung älterer Namen
als die vadose und die profunde Sphäre bezeichne.
Die vadose Sphäre ist vom atmosphärischen Wasser durchtränkt
und durchflossen. Ihre obere Grenze ist die Erdoberfläche; ihre untere
Grenze bilden undurchlässige Schichten. Ihre geothermische Tiefenstufe
ist normal. Das Grundwasser kommuniziert mit der Erdoberfläche und
steht unter deren hydrostatischem Drucke. Ihre Gesteine sind entsalzt;
ihre Öl- und Gaslager sind verarmt, verwässert oder gänzlich
entleert und verschwunden. Sie ist das Gebiet der offenen Öl- und
Gaslagerstätten, die reich an Ölfundstellen, aber ohne bedeutenden
Gehalt und ohne Gasdruck sind. Am besten haben sich hier noch die Asphaltkalke
und Asphaltsande erhalten, sowie die ölhaltigen Thon- und Mergelmassen,
die gerade wegen ihrer Schwerdurchlässigkeit ihre Ölführung
bewahrt haben und darum auch noch häufig Ölfundstellen liefern.
Die profunde Sphäre ist vom atmosphärischen Wasser gänzlich
abgeschlossen; denn ihre obere Grenze wird von undurchlässigen Schichtmassen
gebildet; ihre untere Grenze fällt zusammen mit dem Eintritt in die
porenlose latentplastische Zone in einer Tiefe, die schon auf zwanzig bis
dreissig Kilometer geschätzt worden ist. Ihre geothermische Tiefenstufe
ist abnorm klein, da infolge des Abschlusses nach oben und infolge des
Fehlens abkühlender durchspülender Wassermassen von oben die
Temperatur rascher steigt als in der vadosen Sphäre. Ihr Wasser steht
nicht unter hydrostatischem Druck in Zusammenhang mit der Erdoberfläche.
Sie ist die Region der geschlossenen Öl- und Gaslager. Hier haben
die Gesteine noch ihren ursprünglichen Inhalt; hier führen sie
noch das alte Meerwasser, in dem sie entstanden sind; hier enthalten sie
noch die organische Substanz, die einst in ihnen begraben wurde. Sie sind
daher Salzwasserdurchtränkt, bitumendurchsetzt, öl- und gashaltig.
Durch weite und eigentümliche unterirdische Wanderungen haben sich
dann Öl und Gas an einzelnen Punkten angereichert zu Lagerstätten
von unerhörtem Reichtum.
Es ist kein Zufall, dass mehr als die Hälfte der bekannten Öllagerstätten
aus der Tertiärzeit stammen, also geologisch sehr jung sind. Wohl
ist Erdöl entstanden, seit organisches Leben unseren Planeten belebt.
Aber je weiter die Entstehung der Ölvorräte zurückliegt,
um so grösser war auch die Gelegenheit zu ihrer Zerstörung. In
harmonischem Einklang damit liegen die uralten und reichen paläozoischen
Lagerstätten im Innern des nordamerikanischen Kontinentes in weitem
Tafellande, dessen Mangel an Störungen die erhabene tektonische Ruhe
spiegelt, die dieser Teil der Erdrinde durch alle Zeitalter hindurch bewahrt
hat. Bei solcher Ruhe konnten sich auch Erdöllager durch ungezählte
Jahrmillionen erhalten. Dagegen gehören fast alle die gefalteten Ölregionen
jungen und namentlich tertiären Gesteinsschichten an. Und dabei sind
es immer die einfacher gefalteten Teile, die Vorländer der Gebirge,
die ölreich sind. Im hohen Gebirgsinnern sind Störungen wie Abtragungen
zu bedeutend gewesen, um viel an Ölvorräten übrig zu lassen;
die Hochgebirge gehören daher in der Regel zur vadosen Sphäre.
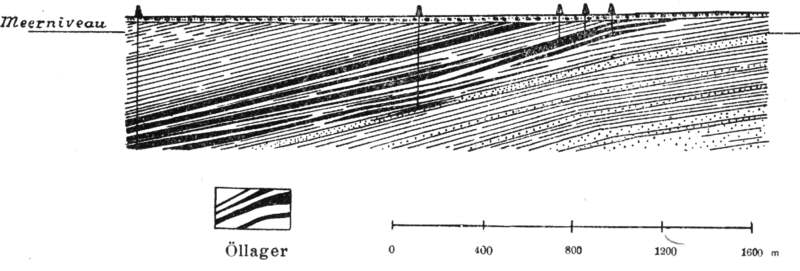 |
Fig. 9
Ausstreichende und auskeilende Schenkellager Los Angeles Kalifornien nach Ralph Arnold |
Kommentar:
Vor dem Ersten Weltkrieg war die Produktion zirka 1000 Barrel pro
Tag (252 l/s), was 1920 als gewaltige Menge empfunden wurde. Heute (2005)
hat Rohöl eine Tagesproduktion von zirka 70 Mio Barrel à
158.98 l, also vergleichbar der Wasserführung der Limmat.
Während Jahrzehnten wurde postuliert, dass die Grünalge
Botryococcus braunii Kütz. (Chlorophyta/Chlorococcales) allein für
die Erdölbildung verantwortlich sei (Begründung: B.braunii speichert
Energie als Fett, viele andere Grünalgen als Stärke). Ich bevorzuge
Blumers Hypothese, sie berücksichtigt auch den Rest der Lebensgemeinschaften
und ihre Physiologie.
In einem Detail irrt Blumer: es gibt sehr wohl Erdölbildung
aus Süsswasserseen.