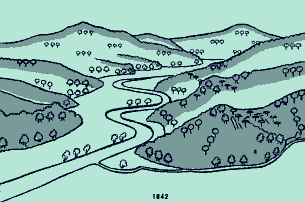Neujahrsblatt der NGZH Nr. 144 auf das Jahr
1942, 78S. mit 24 Abb. in 7 Tafeln
Das Pflanzenkleid des Kantons Zürich
von A.U. Däniker
DÄNIKER A.U. DAS
PFLANZENKLEID
DES KTS.ZÜRICH
|
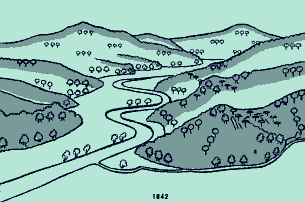 |
Gebr. Fretz AG. Zürich |
Bild: Pflanzengeographie
German only |
Inhalt:
| Einleitung |
5
|
| Die Methoden der Vegetationsforschung |
7
|
| Die an der Bildung der Vegetation des Kantons Zürich
beteiligten Biocoenosengürtel und ihre Pflanzengesellschaften |
9
|
| Die Oberflächengestalt |
19
|
| Die Gliederung der Vegetation des Kantons Zürich |
24
|
| Literatur |
34
|
| Spezieller Teil |
37
|
| Tafel I; Das zürcherische Rheintal |
38
|
| Tafel II; Die Deckenschotterhöhen |
42
|
| Tafel III; Sumpfwald und Flachmoore des innermoränischen
Teiles der Fluvioglacialtäler |
46
|
| Tafel IV; Die Flussauengehölze und das Querceto-Carpinetum |
50
|
| Die Ufergesellschaften |
53
|
| Die Hochmoore |
55
|
| Tafel V; Der Molassebergzug |
59
|
| Tafel VI; Die Schmelzwasserrillen |
65
|
| Die Nagelfluhterassen am Zürichsee |
67
|
| Die Bergspitzen im Zürcher Oberland |
68
|
| Tafel VII; Der Lägernkamm |
71
|
| Der Nordhang des Hohen Ron |
74
|
| Ueber den Naturschutz |
75
|
|
Die an der Bildung der Vegetation des Kantons Zürich beteiligten
Biocoenosengürtel und ihre Pflanzengesellschaften
Von den in Europa vorkommenden Biocoenosengürteln sind nicht alle
am Aufbau der zürcherischen Vegetation beteiligt und auch diese in
sehr ungleichem Masse. Einige derselben sind nur durch Arten repräsentiert,
die sich Pflanzengesellschaften anderer Gürtel angeschlossen haben,
oder kommen in Abhängigkeit von Kulturgesellschaften vor. Andere sind
mit eigenen Gesellschaften nur reliktisch erhalten. Der Fagus-Abies-Gürtel
dagegen beherrscht mit seinen verschiedenen Waldgesellschaften, soweit
er nicht durch künstliche Vegetation verdrängt worden ist, weitaus
den grössten Teil des Gebietes.
Die Ursache für diese Verteilung ist die bioklimatische Entwicklung,
welche seit der Eiszeit, wie heute sicher steht, nicht eine geradlinige
war, sondern im ganzen, zum Teil sekundär, im kleinen vielleicht mehrfach
ansteigend und wieder rückläufig war. Dies trotz der im geologischen,
wie im pflanzengeographischen Sinne kürzeren Zeitspanne!
Zudem, und das ist besonders zu betonen, scheinen die Veränderungen
anzudauern. Ein Ausgleich, wie ihn namentlich die Vegetationen in wärmeren
Erdteilen zeigen, ist weit weniger vorhanden. Daher sind auch endgültig
stabile und nur nach den Standorts-Bedingungen differenzierte Biocoenosen,
die über weite Strecken ausgedehnt sind und die den Wert einer Klimaxvegetation
beanspruchen können, wenig ausgeprägt.
Hier wäre wohl der Buchenwald zu nennen. Doch ist dieser durch
jahrhundertlange forstwirtschaftliche Massnahmen, durch die Bevorzugung
einzelner Holzarten, sowie durch die konsequente Nutzung bestimmter Altersstadien
und den so verunmöglichten Ausgleich derselben derart verändert,
dass er sowohl floristisch als auch in der Gliederung und in der Struktur
seiner einzelnen Gesellschaften kaum rekonstruierbar ist
So sind entwertete, gemischte Gesellschaften oder unnatürliche
Regenerationsstadien als Zwischen- oder Übergangsbildungen überall
zu finden. Die Gliederung der Gesellschaften, die ursprünglich wahrscheinlich
ziemlich markant war und in feiner Abhängigkeit von Boden- und Geländeeigenschaften
gestanden hat, ist verwischt. Ja, die Vegetation des Buchenwaldes ist sogar
besonders trivialisiert
Die Biocoenosengürtel unserer Vegetation sind:
der Vaccinium uliginosum-Loiseleuria-Gürtel
der Larix-Pinus Cembra-Gürtel
der Picea-Gürtel
der Fagus-Abies-Gürtel
der Quercus Robur-Calluna-Gürtel
der Pinus silvestris-Pulsatilla-Gürtel
der Quercus-Tilia-Acer-Gürtel
der Quercus pubescens-Gürtel.
Diese Gürtel liegen bei uns und besonders in den Alpen im Grossen
ganzen jedoch nicht immer stufenmässig übereinander. doch sind
sie keineswegs mit Vegetationsstufen zu verwechseln. Der Begriff des Biocoenosengürtels
ist chorologischen, derjenige der Vegetationsstufe geographisch-topographischen
Inhaltes. Die Höhenanordnung der Gürtel war nicht immer so;
ihre Garnituren sind eher Floren zu vergleichen, die in zeitlich verschiedenen
Epochen bei uns einwanderten, in verschiedenem Masse geherrscht, z. T.
sogar das ganze Gebiet als die damaligen Floren eingenommen haben, die
sich später aber in die ihnen heute zukommenden Gebiete und Lagen
zurückgezogen haben. Dabei sind in den Gürteln floristische Veränderungen
durch Aufnahme neuer Arten und besonders aber durch Verluste anderer entstanden.
Es sind aber auch die Pflanzengesellschaften, die sie im einzelnen bildeten,
nicht genau die gleichen gewesen wie die heutigen. Hierin lässt sich
immerhin durch Rückschlüsse ein gewisses Bild rekonstruieren.
Die Quartärgeologie, die Arealgeographie und vor allem die Pollenanalyse
haben uns bis heute ein Bild der Entwicklung unserer Flora seit der Eiszeit
gegeben, das in den grossen Zügen als gesichert gelten kann. Ein Nachteil
dabei ist allerdings der, dass man über die Geschichte der Kräuter
relativ wenig weiss. Hier lässt sich das Bild immerhin durch die Prüfung
des ökologischen und des biocoenologischen Verhaltens konstruktiv
soweit ergänzen, (lass wir durch die Angaben der Geschichte einer
Baumart bis zu einem gewissen Grade auch Vermutungen über deren Begleitflora
und damit über die Vegetation machen können. 14, 15, 16, 23)
Home Liste der
Neujahrsblätter