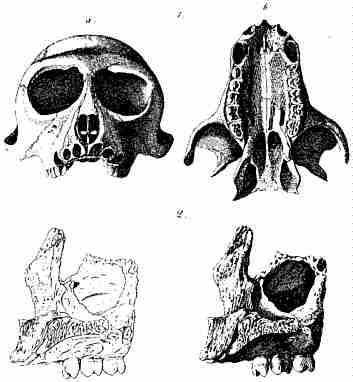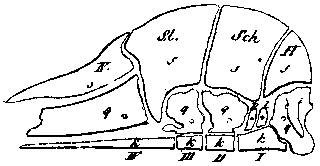NGZ-Neujahrsblatt 1950, 131 Seiten, mit 87 Abbildungen
Goethes Wirbeltheorie des Schädels
Bernhard Peyer
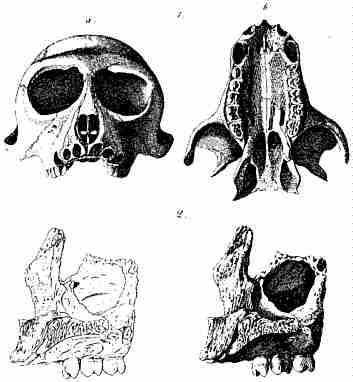
Abb. 6 Verkleinerte Wiedergabe von Tafel V der Zwischenkieferarbeit
von J. W. Goethe. 1. Schädel eines Affen von vorn und von unten gesehen.
2. rechter Oberkiefer des Menschen, Innenansicht. Aus J. W. Goethe 1830
German only |
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
I. Goethe's Studien über die Morphologie des Schädels
II. Schädelmorphologische Arbeiten von Zeitgenossen Goethe's
III Rückblick
IV. Die Zeit von Goethe's Tod bis zu Th. H. Huxley's Croonian
Lecture (1858)
V. Die Entwicklung der Schädelmorphologie vom Jahre 1859
bis zur
Gegenwart
VI. Einführung in die Morphologie
des Wirbeltierkopfes
VII. Wirbeltiere und Gliedertiere
VIII. Bau und Entwicklung des Wirbeltierschädels
1. Amphioxus
2. Jetztlebende und fossile
Cyclostomen
3. Cyclostomen - Gnathostomen
4. Pisces
5. Der Übergang von
der Kiemenatmung zur Lungenatmung
6. Fossile und jetztlebende
Amphibien
7. Fossile und jetztlebende
Reptilien
8. Fossile und jetztlebende
Vögel
9. Fossile und jetztlebende
Säugetiere
IX. Bau und Funktion
X. Der Schädel des Menschen
XI. Rückblick und Ausblick
Anmerkungen
Literaturverzeichnis |
Vorwort
Das Jahr 1949 steht im Zeichen Goethe's, denn es sind
nunmehr 200 Jahre vergangen, seit er das Licht der Welt erblickte. In den
vielen Veranstaltungen, die bei Anlass dieses Bicentenariums abgehalten
worden sind, wurde nicht nur der Dichter gefeiert, sondern es wurde auch
seine Tätigkeit als Naturforscher gewürdigt, in Zürich insbesondere
durch Paul Niggli und durch Hans Fischer. Diese beiden tiefgründigen
Darstellungen umfassen das Gesamtgebiet von Goethe's naturwissenschaftlicher
Tätigkeit. Unser Neujahrsblatt behandelt nur Goethe's Studium der
Morphologie des Schädels. Die Beschränkung auf dieses Teilgebiet
ergab sich aus folgenden Gründen: An trefflichen Gesamtdarstellungen
von Goethe's biologischen Forschungen fehlt es nicht, wohl aber an einem
allgemein verständlichen geschichtlichen Überblick, der zeigt,
warum der Goetheschen Wirbeltheorie des Schädels in ihrer ursprünglichen
Form nur ein vorübergehender Erfolg beschieden sein konnte, wie sie
überwunden wurde, wie dann an ihrer Stelle vielseitig begründete,
vertiefte Einsicht in den metameren Aufbau des Kopfes trat und wie damit
der innerste Kern von Goethe's grossem Gedanken Bestätigung gefunden
hat.
In allgemein verständlicher Weise liessen sich diese
Fragen nur darstellen, wenn dem Texte die notwendige Zahl von Abbildungen
beigegeben werden konnten. Daran drohte die Ausführung des Vorhabens
deswegen zu scheitern, weil eine hinreichend illustrierte Publikation die
im Budget unserer Gesellschaft für ein Neujahrsblatt zur Verfügung
stehende Summe bei weitem überschritten haben würde.
Dass die Absicht trotzdem verwirklicht werden konnte,
ist einer hochherzigen Unterstützung von Seiten der Georges und Antoine
Claraz Schenkung zu verdanken. Der Verfasser möchte nicht verfehlen,
an dieser Stelle dem Präsidenten des Kuratoriums der genannten Schenkung,
Herrn Dr. W. Zollinger, sowie dem Vizepräsidenten, Herrn alt Rektor
Prof. Dr. G. Geilinger, für die wohlwollende Behandlung seines an
das Kuratorium gerichteten Gesuches und ebenso dem Gesamtkuratorium für
die Genehmigung aufs beste zu danken.
Für die Ausführung der zeichnerischen Arbeiten
bin ich Herrn J. Mayer-Gräter zu Dank verpflichtet. Der hohen
Kosten wegen musste von einer Beigabe von farbigen Abbildungen, wie sie
in mehreren Lehrbüchern und Handbüchern der Schädelmorphologie
zur Verwendung gelangten, abgesehen werden. Es bedurfte besonderer zeichnerischer
Anstrengungen, um auch ohne Anwendung verschiedener Farben die hervorzuhebenden
Differenzen in übersichtlicher Weise zum Ausdruck zu bringen. Für
mannigfache Hilfe beim Abschluss dieser Arbeit, die infolge eines längeren
Spitalaufenthaltes mit gewissen Schwierigkeiten verbunden war, habe ich
sodann meinem getreuen Mitarbeiter P.-D. Dr. E. Kuhn zu danken.
- Zürich (Klinik Hirslanden), im Oktober 1949. Bernhard
Peyer
Zur Wirbeltheorie Goethes:
«Welche Reihe von Anschauungen und Nachdenken verfolgte
ich nicht, bis die Idee der Pflanzenmorphose in mir aufging, wie solches
meine Italien-Reise den Freunden vertraute. Ebenso war es mit dem Begriff,
dass der Schädel aus Wirbelknochen bestehe. Die drei hintersten erkannt
ich bald, aber erst im Jahr 1790, als ich aus dem Sande des dünenhaften
Judenkirchhofs von Venedig einen zerschlagenen Schöpsenkopf aufhob,
gewahrt ich augenblicklich, dass die Gesichtsknochen gleichfalls aus Wirbeln
abzuleiten seien, indem ich den Übergang vom ersten Flügelbeine
zum Siebbeine und den Muscheln ganz deutlich vor Augen sah (vgl. Abb. 12);
da hatt ich denn das Ganze im Allgemeinsten beisammen. So viel möge
diesmal das früher Geleistete aufzuklären hinreichen.»
(Zur Morphologie, Zweiten Bandes erstes Heft, 1823.)
«Im zweiten Teile der ,Morphologie' steht ein Bekenntnis:
wie ich erst drei, dann sechs Wirbelknochen anzuschauen und anzuerkennen
veranlasst worden. Hierin fand ich nun Hoffnung und Aussicht auf die schönste
Beruhigung, bedachte möglichst die Ausbildung dieses Gedankens ins
einzelne, konnte jedoch nichts Durchgreifendes bewirken. Zuletzt sprach
ich hievon vertraulich unter Freunden, welche bedächtig zustimmten
und auf ihre Weise die Betrachtung verfolgten. Im Jahre 1807 sprang diese
Lehre tumultuarisch und unvollständig ins Publikum, da es ihr denn
an vielem Widerstreit und einigem Beifall nicht fehlen konnte. Wieviel
ihr aber die unreife Art des Vortrages geschadet, möge die Geschichte
dereinst auseinandersetzen; am schlimmsten wirkte der falsche Einfluss
auf ein würdiges Prachtwerk, welches Unheil sich in der Folgezeit
leider immer mehr und mehr offenbaren wird.
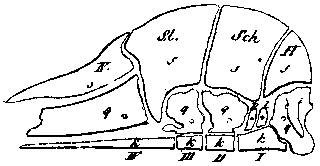 |
Schädel eines Säugetieres in seitlicher Ansicht entsprechend
den Anschauungen von Oken's Wirbeltheorie des Schädels. H Urwirbel,
Sch Zungenwirbel, S Augenwirbel, davor der Nasenwirbel. k Körper,
q Lochbogen, s Stachel. Aus L. Oken 1819, Tafel 18, Fig. 17
(Oken (Ockenfuss) war der erste Anatom der Universität Zürich) |
Zur Priorität Goethes beim Zwischenkieferknochen:
Felix Vicq d'Azyr wurde ein Jahr vor Goethe, am 23. April
1748 als Sohn eines Arztes zu Valogne in der Normandie geboren. Schon in
jungen Jahren machte er sich in Paris durch einen glänzenden anatomischen
Kurs sowie durch anatomische, physiologische und medizinische Arbeiten
einen Namen. Mit fünfundzwanzig Jahren war er bereits Mitglied der
Académie des Sciences und 1788 wurde er als Nachfolger von Buffon
in die Académie française aufgenommen. Am bekanntesten sind
seine hirnanatomischen Arbeiten. Er starb schon am 20. Juni 1794, bedrückt
durch die Schrecken der Revolution und den Verlust vieler Freunde, noch
vor seinem Lehrer Louis Marie Daubenton, der ihn am Jardin des Plantes
in die Osteologie eingeführt hatte.
Der Name von Felix Vicq d'Azyr muss hier genannt werden,
weil ihm ganz unzweifelhaft die Priorität der Entdeckung des Zwischenkiefers
beim Menschen zukommt. Als Goethe im Frühjahr 1784 aufs tiefste bewegt
voller Freude Herder seine Entdeckung des Zwischenkiefers beim Menschen
brieflich mitteilte, da wusste er sicher nicht, dass Vicq d'Azyr kurz zuvor
die gleiche Entdeckung schon gemacht hatte (siehe Abb. 13). Wenn Goethe
nun auch nicht, wie er meinte, als erster den Zwischenkiefer beim Menschen
gefunden hat, so war er doch in seiner Arbeit völlig selbständig.
Ihr Verdienst liegt darin, dass die unabhängige Wiederentdeckung nicht
auf einem Zufallsfunde beruhte, sondern dass sie auf Grund von selbst erarbeiteten
vergleichend-anatomischen Vorstellungen in planmässigem Nachsuchen
erreicht wurde. Beispiele davon, dass ein Forscher in guten Treuen die
Priorität einer Entdeckung beansprucht, während in Wirklichkeit
ein oder sogar mehrere Vorgänger schon das gleiche gefunden hatten,
sind, wie F. J. Cole in seiner Geschichte der vergleichenden Anatomie hervorhebt,
nicht selten..
Schwer zu verstehen ist es, dass Goethe auch später,
als er von Vicq d'Azyr's Arbeit Kenntnis erhalten und sie eingesehen hatte,
ja sogar wahrscheinlich Vicq d'Azyr's Abbildung des menschlichen Zwischenkiefers
für die Herstellung einer Abbildung in seiner eigenen Publikation
über den Zwischenkiefer mit benützte, den Namen des französischen
Forschers mit keiner Silbe erwähnte. Auch auf die ausgedehnten vergleichend-anatomischen
Betrachtungen Vicq d'Azyr's ist er nicht eingegangen.
Der in den «Naturwissenschaften» 1949 (36.
Jahrgang, Heft 7) erschienene Aufsatz von Max Pfannenstiel, Freiburg i.
Br., trägt den Titel: Die Entdeckung des menschlichen Zwischenkiefers
durch Goethe und Oken. Pfannenstiel weiss es sehr wahrscheinlich zu machen,
dass Oken, trotzdem ja zum mindesten Loder über Goethe's Entdeckung
des Zwischenkiefers beim Menschen etwas publiziert hatte, glaubte, als
erster diese Entdeckung gemacht zu haben und dass er auch in seiner akademischen
Antrittsrede vom Jahre 1807 offenbar noch dieser Meinung war. Von einem
Prioritätsstreit zwischen Goethe und Oken kann in dieser Frage schon
deswegen nicht die Rede sein, weil heute unzweifelhaft feststeht, dass
Vicq d'Azyr die gleiche Entdeckung schon vor den beiden genannten Forschern
gemacht und publiziert hat.
XI. Rückblick und Ausblick
Aus Goethe's naturwissenschaftlichem Arbeiten, das sich
über weite Gebiete erstreckt, sind hier nur seine morphologischen
Leistungen hervorgehoben worden und auch diese nur, soweit sie sich auf
die Osteologie des Schädels beziehen. Dass er nicht der erste war,
der den Zwischenkiefer beim Menschen nachwies, beeinträchtigt sein
Verdienst in keiner Weise, denn er machte diese Entdeckung durchaus selbständig
und gegen eine in der damaligen Wissenschaft herrschende Zeitströmung.
Seine Wirbeltheorie des Schädels hat, wenn ihr auch keine dauernde
Geltung beschieden war, doch auf Jahrzehnte die schädelmorphologischen
Vorstellungen beherrscht und sich als heuristisch wertvoll erwiesen.
Von tiefer Nachwirkung und bleibender Bedeutung sind
seine Bemühungen um die Erfassung des Typischen. Sie wurden in neuerer
Zeit wieder zu Ehren gezogen, als sich die Kritik an dem sogenannten biogenetischen
Grundgesetz und an der während Jahrzehnten üblichen Art des Betriebes
stammesgeschichtlicher Forschung zu regen begann. Man besann sich darauf,
dass die Untersuchung der fossilen Überreste im Grunde auf einer idealistischen
Morphologie beruht. Es muss aber beigefügt werden, dass die Vergleichung
nicht mehr rein zeitlos ist. Neu hinzugekommen ist die Kenntnis der zeitlichen
Aufeinanderfolge der fossilen Formen, die noch während der letzten
Lebensjahrzehnte Goethe's erst im Werden war. Goethe's Einstellung zu den
Anfängen der Deszendenzlehre in der Form, wie sie damals vorlagen,
ist umstritten. Die meisten nehmen wohl mit Recht an, dass ihm der Gedanke
an einen realen Transformismus fernlag.
Im Zusammenhang mit Goethe's Ausspruch «Die vergleichende
Anatomie eröffnet uns die Tiefen der Natur mehr als jede andere Bemühung
und Betrachtung» schrieb der um die Goethe-Forschung sehr verdiente
J. Schuster (66): «Das Jahr 1795 ist als Geburtsjahr der vergleichend-idealistischen
Anatomie ewig denkwürdig.» Diese Auffassung scheint mir bei
aller Würdigung von Goethe's Verdiensten den geschichtlichen Tatsachen
nicht gerecht zu werden.
Die vergleichende Anatomie beginnt mit Aristoteles und
sie war schon damals ihrer Natur nach eine idealistische Morphologie. Auch
mit Belon's Vergleich des Vogelskelettes mit dem menschlichen Skelett aus
dem Jahre 1555 und mit den wahren Glanzleistungen vergleichender Forschung
aus dem 17. Jahrhundert, z.B. denjenigen eines Nicolaus Steno, verhält
es sich nicht anders. Billigerweise darf aber von einem Goethe, der andere,
grössere Aufgaben zu erfüllen hatte und der den morphologischen
Studien nur einen kleinen Teil seiner Arbeitskraft widmen konnte, keine
vollständige Übersicht über die schon damals weitverzweigte
Fachliteratur erwartet werden.
(in anderen Worten: er war hier, wie auch bei der
Farbentheorie, ein Dilettant. Goethe war aber, als Direktor der Sammlungen,
die künstlerische Freiheit bekannt, mit welcher Zeichner fehlende
Knochen zufügten.)
Home Liste der
Neujahrsblätter