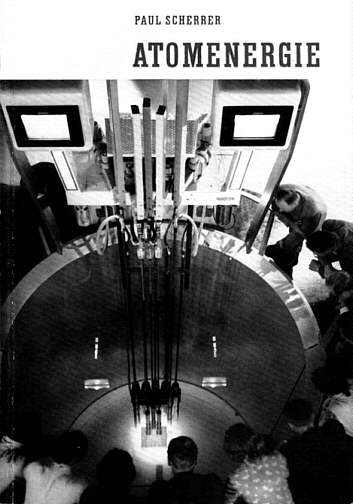NGZ-Neujahrsblatt 1957, 42 S., mit 25 Abb.,
Nr. 159
Atomenergie
Paul Scherrer
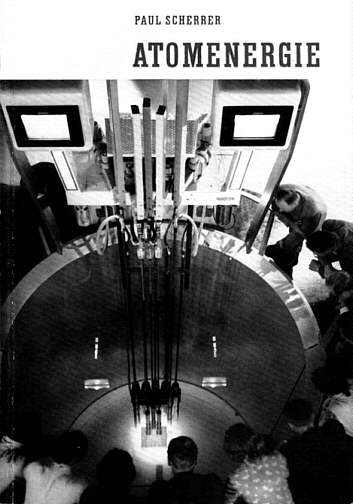
Umschlagbild:
Forschungsreaktor, Typ "Swimmingpool", ausgestellt 1955 an der Genfer
Konferenz "Atoms for Peace" (Tscherenkow-Strahlung), 1957 in Würenlingen
auf 100fache Leistung modifiziert aufgebaut.
German only |
Inhaltsverzeichnis
1. Arbeit und Energie
2. Die Energiequellen der Erde
3. Die Brennstoffreserven und ihre Erschöpfung
4, Der Atomkern als Energiequelle
5. Der Atombau
6. Die künstliche Kernumwandlung
7. Die Uranspaltung
8. Reaktorphysik
a) Die Kettenreaktion
b) Der Wirkungsquerschnitt
c) Neutronenstreuung
d) Der Uranreaktor
9. Reaktortechnik
a) Leistungsreaktoren
b) Breeder
c) Beispiele von Reaktoren, Der Schweizer Reaktor
|
1. Arbeit und Energie
Gegen Ende des 18. Jahrhunderts ging eine romantisch
anmutende Epoche der Naturwissenschaften zu Ende. Die Grundgesetze der
Mechanik waren gefunden und streng formuliert worden. NEWTON konnte die
Bewegung des Mondes und der Planeten exakt berechnen. Erste Versuche zur
Beherrschung der komplizierten Bewegungen von Flüssigkeiten durch
EULER und BERNOULLI verliefen erfolgreich. In der Differential- und Integralrechnung
war durch NEWTON und LEIBNIZ ein mathematisches Werkzeug von unschätzbarem
Wert für die Behandlung physikalischer Probleme geschaffen worden.
Die Theorie des Lichtes hatte entscheidende Fortschritte gemacht. Fernrohre
und Mikroskope waren schon hochentwickelte Instrumente, nur das Verständnis
der elektromagnetischen Vorgänge steckte noch in den Anfängen.
Nun erklärte 1775 die französische Akademie
mit Bestimmtheit, daß die Konstruktion eines Perpetuum mobile unmöglich
sei und dass sie keine diesbezüglichen Erfindungen mehr zur Prüfung
entgegennehmen könne. Der Traum so vieler Erfinder, eine Maschine
zu bauen, die dauernd Energie aus nichts erzeugen würde, war damit
zu Ende. Freilich flackern die Bestrebungen für den Bau einer solchen
Maschine in der Phantasie immer wieder auf, wäre doch kaum eine Erfindung
von grösserer Tragweite möglich.
Seither hat die Wissenschaft neue Wege beschritten: Weniger
anspruchsvoll in der Zielsetzung, hat sie Kräfte zu entfesseln und
auch zu bändigen gewußt, welche die Muskelkraft aller Lebewesen
und zugleich wohl auch die kühnen Vorstellungen aller Perpetuum-mobile-Erfinder
bei weitem übertreffen. Der neueste Schritt auf diesem Wege ist die
Nutzbarmachung der Atomenergie.
Die schwierige Frage nach dem Wesen der Energie, nach
den Erhaltungssätzen für Energie und Masse hat die Physiker schon
immer beschäftigt.
....
aus dem Ausblick:
Während die Forschung auf dem Gebiet der Kernphysik
an den schweizerischen Hochschulen seit vielen Jahren äusserst intensiv
gepflegt wurde und die Schweiz hier einen sehr hohen Standard aufweist,
ist die Reaktortechnik in unserem Lande noch sehr wenig entwickelt. Trotz
grösster Anstrengung unserer Behörden und der Schweizerischen
Forschungskommission war es nämlich sehr lange Zeit nicht möglich,
die für den Bau eines Reaktors nötige Menge Uran zu bekommen.
Es gibt ja leider keine abbauwürdigen Uranvorkommen in unserem Lande,
und wir waren in dieser Beziehung völlig auf das Ausland angewiesen.
Erst jetzt, da wir über das nötige Uran verfügen,
sind wir in der Lage, Reaktoren zu bauen und uns in die Technologie dieser
Maschine einzuarbeiten. Sehr wichtig dabei ist auch die Zusammenarbeit
mit andern Ländern. So ist beabsichtigt, mit den USA, England, Kanada
und Frankreich bilaterale Verträge abzuschliessen, welche uns in den
Besitz von weiterem spaltbarem Material setzen und die einen technischen
Erfahrungsaustausch zwischen den Industrien der Vertragspartner ermöglichen
sollen. Ein solcher Vertrag mit den USA, der den Charakter eines Lizenzvertrages
hat und welcher der Schweiz ausserordentliche Vorteile bringen wird, ist
vom Parlament gerade ratifiziert worden.
Es kann wohl kein Zweifel darüber bestehen, dass
die Atomenergie in der Wirtschaft der Zukunft eine bedeutende Rolle spielen
wird. Es ist als glücklicher Umstand zu betrachten, dass gerade jetzt,
wo das Ende der Kohle- und Ölreserven abzusehen ist, die Atomenergie
entdeckt wurde. Bei den heute noch hohen Kapitalkosten eines Atomkraftwerkes
(der Brennstoffpreis spielt keine wesentliche Rolle), liegt der Preis der
aus Uran erzeugten elektrischen Energie noch über dem üblichen
Wert. Das Calder-Hall-Atomkraftwerk gibt allerdings als Preis für
die Kilowattstunde schon heute den erstaunlich tiefen Betrag von 0,6 d,
entsprechend etwa 3 Rappen, an.
Die schweizerischen Wasserkräfte werden in spätestens
15 bis 20 Jahren völlig ausgebaut sein und dann etwa doppelt so viel
Energie liefern wie heute. Weil der Energiebedarf dauernd steigt, müssen
wir uns dann nach neuen Energiequellen umsehen. Es ist nicht zu erwarten,
dass dieser Energiebedarf durch das Ausland gedeckt werden kann, weil sich
die anderen europäischen Staaten, Norwegen (seiner reichen Wasserkräfte
wegen vielleicht ausgenommen), in ähnlicher Lage befinden werden.
Die Schweiz ist auf die Atomenergie unausweichlich angewiesen
und es ist daher dringend nötig, dass sie die Entwicklung auf diesem
so wichtigen Zukunftsgebiet mit allen Kräften fördert.
Home Liste der
Neujahrsblätter