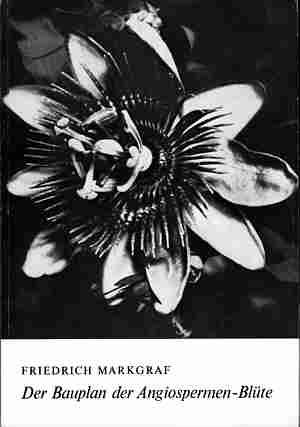NGZ-Neujahrsblatt 1971, 40S., 28 Abb.
Der Bauplan der Angiospermen-Blüte
Friedrich Markgraf
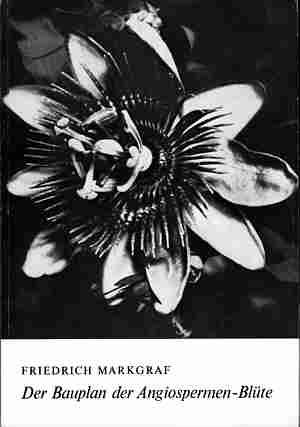
Umschlagbild: Blüte einer Passionsblume (Passiflora coerulea)
P.Peisl ; German only |
Inhalt:
Die Achse
Der Kelch
Die Blumenkrone
Die Staubblätter
Die Fruchtblätter
Synkarpie
Samenanlagen
Sporophylle
Die Stellung der Blütenphyllome
Verwachsene Zyklen
Symmetrie
Andere Deutungen
Pseudanthien
Auswahl aus einschlägiger Literatur |
Stärker vielleicht als zu Beginn dieses Jahrhunderts
fühlt sich heute der Mensch Unsicherheiten, Zweifeln und Gefahren
ausgesetzt, «in einer nicht mehr heilen Welt», wie die poetisierende
Formel heisst. Was ist denn nicht mehr heil? Doch nur das, was er selbst
zerstört hat durch Masslosigkeit oder durch Einseitigkeit im Tun und
im Denken. Empfindet man es nicht als Vorwurf und als Mahnung, unsere Grenze
einzuhalten, dass die Natur, von der wir doch auch ein Teil sind, unbeirrt
weiter wirkt, als ob unser Pessimismus oder gar unser Zorn selbstverständlich
nicht ernst zu nehmen sei? Sie hat Sicherheit in dem geordneten Bau ihrer
Organismen.
Am unmittelbarsten erkennen wir solche Ordnung im gesetzmässigen
Aufbau der Pflanzen, die uns umgeben, weil sie ihre wichtigen Organe mehr
als die Tiere frei nach aussen entfalten. Ob beachtet oder nicht bringen
die Pflanzen ihre Blüten hervor, ein Wunder an Gesetzmässigkeit
für jeden, der bereit ist, es wahrzunehmen.
Die Achse
Wollen wir einmal darauf achten. Da ist z. B. die Hahnenfuss-Blüte
(Abb. 1) (Ranunculus acer). Wenn wir sie längs durchschneiden, zeigt
sich ihr innerster Teil als ein halbkugeliger oder kegelförmiger Abschluss
des Stengels. Dabei trennen winzige Abstände entlang dieses Kegels
die Organe, die seitlich daran sitzen. Offenbar haben wir ein verkürztes
Stengelende vor uns, das sich aus ganz kurzen Gliedern zwischen den Kelch-
und Kronblättern, den Staubgefässen und den Fruchtknötchen
aufbaut. Unterhalb der Blüte ist es uns aus Gewohnheit vertraut, dass
der Stengel von Blatt zu Blatt aus Gliedern aufgebaut ist; nur sind sie
da meist mehrere Zentimeter lang, in der Blüte dagegen kaum Millimeter.
Das ist die erste Gestaltsregel, die in der Blüte herrscht: Verkürzung
der Achse, wie man den Stengel allgemeiner benennt.
Diese Verkürzung gehört zur Blüte, aber
die Voraussetzung dafür besitzen die Blütenpflanzen schon in
ihrer vegetativen Region. Bei vielen unserer Bäume beobachtet man,
dass Zweige, die die Ausdehnung der Krone vergrössern, von Blatt zu
Blatt lange Achsenglieder zeigen, dass aber im nächsten Jahr aus den
Achselknospen dieser Blätter «Kurztriebe» hervorgehen,
die die Baumkrone nicht vergrössern, sondern füllen. Es sind
Blattbüschel, in denen nur kurze, oft sehr kurze Achsenglieder von
Blatt zu Blatt wahrnehmbar sind.
Auch die Blüte kann also als Kurztrieb aufgefasst
werden. Mit den Achsengliedern verkürzt sich zugleich noch etwas anderes.:
der Weg für die Zuleitung der Nährstoffe. Die Blüte hat
einen besonders grossen Nahrungsbedarf, weil sie im allgemeinen nicht oder
doch weniger grün ist als die Laubsprosse, daher nicht oder wenig
assimiliert. Dagegen muss sie die eiweissreichen Pollenkörner in grosser
Menge bilden und die oft zahlreichen Samen mit ihrem Vorrat an Reservestoffen
für die Keimung. Auch hierfür ist es einleuchtend, dass sie sich
als Kurztrieb gestaltet.
Das ist jedoch nur eine Voraussetzung, nicht eine Ursache
ihres Bauplans. Denn neu ist an ihr eine Differenzierung der Organe, die
an der Achse sitzen, in senkrechter Richtung, als Kelchblätter, Kronblätter
usw., die gesetzmässig in kurzen «Regionen» aufeinander
folgen. Ein zuverlässiger Regulator, dessen Wesen man nicht kennt,
sorgt dafür, dass die Sprossspitze des Blüten-Kurztriebes in
einem bestimmten Zeitpunkt Kelchblätter, etwas später nur noch
Kronblätter usw. ausbildet. Es kann vorkommen, besonders bei Blüten
mit schraubiger Anordnung ihrer Teile, dass eine neue Blattanlage gerade
im Zeitpunkt der Umschaltung von einem Blatt-Typ in den nächsten entsteht.
Dann kommt es zu Übergangsformen.
Mit der Achsenverkürzung ist in der Blüte eine
neue Gestaltsänderung verbunden, die der vegetative Kurztrieb nicht
aufzuweisen hat: das Wachstum der Achse wird endgültig abgeschlossen.
Die Kurztriebe eines Kirschbaumes oder einer Lärche können in
jedem Jahr weiterwachsen, manchmal sogar als Langtriebe; der Kurztrieb
«Blüte» kann das nicht oder doch nur in krankhaften Ausnahmefällen.
Aber er hat dafür eine neue Fähigkeit ausgebildet: das Achsenende
verbreitert sich. Die Rundung, die beim Hahnenfuss die Fruchtknötchen
trägt, ist dicker als die Achsenglieder unter ihr. Sie kann auch abgeflacht
oder als Becher vertieft sein, etwa bei den Rosen (Abb. 24). Bei der Bachnelkenwurz
(Geum rivale), den Passionsblumen und bei mehreren anderen Pflanzen kehrt
sogar oberhalb des Kelches noch ein stielförmiges Stück, wahrscheinlich
Achse, wieder (Abb. 2). Es ist interessant als Entsprechung zu den vegetativen
Kurztrieben, die - allerdings nur gelegentlich - mit gestreckter Achse
als Langtriebe weiterwachsen können. Die Hemmung ist in der Blüte
jedoch offenbar grösser: nach einigen Millimetern endet jener Stiel
und trägt als «Gynophor» die Fruchtknoten oder als «Androgynophor
» die Staubgefässe und den Fruchtknoten. Es ist aber wohl kein
Zufall, dass gerade bei Geum rivale Durchwachsungen der Blüte gar
nicht so selten vorkommen. Die Achse verlängert sich dann oberhalb
des Kelches weit hinauf und bildet noch einmal eine vollständige Blüte.
Voraussetzung ist auch hierfür der starke Nahrungs-Zustrom
zur Blüte. Teleologisch gesehen ist die Achsenverkürzung nützlich,
indem sie durch Zusammendrängung der Blütenorgane den Zutritt
der Bestäuber wirksamer macht und überhaupt fördert. In
vergleichender Betrachtung stellt man schlicht die Erkenntnis fest, dass
durch dies einfache Merkmal die Blüte ein eigener Gestaltstyp unter
den Teilen der Pflanze geworden ist [50].
.....
Home Liste der
Neujahrsblätter