Vorläufige Fassung; mehr oder weniger vollständig.
| Schaeppi,H.J. | Ueber die Gestaltung der Sprosse bei einigen einheimischen Gentianaceen. | 114,1-27 | ||||||||||||
| Sprossmophologische Untersuchungen
an einigen einheimischen Gentianaceen ergaben:
1. Von der für die Familie typischen opponiert-dekussierten Blattstellung kommen relativ oft Abweichungen vor, so 3 zählige Wirtel und Trennung der Blätter eines Wirtels. 2. In der Gestaltung der Blätter zeigen sich häufig kontinuierliche Übergänge, so zwischen Nieder- und Laubblättern und zwischen Laub- und Hochblättern. Bei manchen Gentianaceen fehlen am Hauptspross ausgeprägte Hochblätter. 3. Hinsichtlich Internodien sind regelmässig beblätterte Sprosse und Halbrosettenpflanzen zu unterscheiden. Die grosse Mehrzahl der Gentianaceen gehört der letztgenannten Gruppe an. 4. Die Messung der Internodien ergab bei vielen Arten die typische Längenperiode, die sich graphisch als eingipflige Kurve darstellt. Bei einigen Arten wird die Kurve zweigipflig durch die Verlängerung des Endinternodiums. Von diesen Verhältnissen beobachtet man bei manchen Arten Vereinfachungen. 5. Bei allen Gentianaceen schliesst der Spross mit einer Endblüte ab. Die Infloreszenzen sind somit monotel. Die Seitenachsen der meisten Arten verzweigen sich monopodial, so dass rispige Sprosssysteme entstehen. - Demgegenüber haben Blackstonia und Centaurium Thyrsen, die sich zunächst dichasial, später monochasial verzweigen. 6. Die Verzweigung ist basiton gefördert; bei den Arten mit Thyrsen verzweigen sich allerdings die terminalen Dichasien zunächst weiter, bevor basalwärts weitere Äste 1. Ordnung entstehen. 7. Bei manchen hapaxanthen Gentianaceen können aus allen Blattachseln längs des ganzen Sprosses Seitenzweige entstehen, während bei vielen staudenartigen im unteren Teil des Sprosses die Astbildung gehemmt ist. Eine Sonderstellung nimmt hier Gentiana ciliata ein, wo neben terminalen auch vereinzelte Äste aus der Basis entstehen können. 8. Weitere Einschränkungen der Verzweigung zeigen sich bei manchen Arten in der Bildung eines Akladiums oder dann so, dass nur eine Achsel des Blattpaares fertil ist. 9. Von der rispigen Grundstruktur lassen sich Vereinfachungen beobachten, so dass traubige und kopfartige Blütenstände und schliesslich wenig- oder gar einblütige Sprosse resultieren. 10. Die untersuchten Arten lassen sowohl in der Internodiengestaltung wie auch in der Verzweigung mannigfache Beziehungen erkennen. |
||||||||||||||
| Messikommer,E. | Beiträge zur Algenflora des Kt.Zürich. VII. Die Algenflora des Glattalgebietes östlich von Rümlang und Oberglatt (Klotener Ried). | 114,29-47 | ||||||||||||
| Einleitung
Die gesammelten Algen entstammen Gewässern an der Übergangsschwelle vom oberen zum unteren Glattal. Sie liegen an der Peripherie des heutigen Zivilflugplatzes Kloten und damit im Ausdehnungsbereich eines verlandeten glazialzeitlichen Sees. Der näheren Topographie nach lassen sich folgende Gewässergruppen unterscheiden: 1. Altwasserteiche im Naturschutzgebiet an der Glatt, 2. Quelltopf, Gräben, Tümpel und Kopfbinsenwiese im Naturschutzgebiet «Goldenes Tor», 3. wasserhaltende Granatentrichter und Graben südöstlich von Oberglatt. Genannte Algenstandorte sind vom Verfasser zu Exploitationszwecken wiederholt besucht worden. Exkursionen ins Gebiet fanden statt im Mai und Juni 1928, im Mai 1943, im Oktober 1946, im September und Oktober 1948 und im Mai 1952. |
||||||||||||||
| Stauffer,H.U. | Amphorogyneae, eine neue Tribus der Santalaceae. Santalales-Studien X. | 114,49-76 | ||||||||||||
| Anmerkung: An dieser Arbeit hat
Herr Dr. Stauffer noch in seinen letzten Tagen geschafft. Sie ist als Vorarbeit
für eine Monographie zu verstehen, die er ebenfalls schon in Angriff
genommen hatte, zunächst für die malesischen Gattungen Cladomyza,
Dendromyza, Dendrofrophe, Dufrenoya. Sehr viele Herbarbelege, einschliesslich
der Holotypen, hatte er überprüft und eingehende Notizen über
viele Exemplare niedergelegt, teilweise durch Fräulein Dr. Gutzwiller
aufschreiben lassen. Es schien mir in seinem Sinne recht, diese weit gediehenen
Untersuchungen mit heranzuziehen und wenigstens die von ihm neu aufgestellten
Arten zu beschreiben. Er hatte sie ja bereits in den fast druckfertig hinterlassenen
Seiten 1-6 (dieser Arbeit) mit Namen genannt. Ich habe also versucht, zur
Ergänzung seines Manuskripts aus seinen Roh-Notizen die in diesem
Formenkreis wesentlichen Merkmale herauszufinden und in lateinische Diagnosen
zu fassen, habe auch zu den von ihm genannten Synonymen ihre Originalzitate
angeführt und in die Verbreitungskarte das noch fehlende Areal von
Phacellaria eingetragen. Ferner schien es mir notwendig, die Belege aufzuzählen,
aus denen sich seine Begrenzung der Arten ergibt. Sie liegen in den verschiedensten
Herbarien und waren von ihm bereits kurz in Listen zusammengestellt worden.
Auch die Reihenfolge der Arten, wie sie hier eingehalten wird, ist ein
Ausdruck seiner Auffassung über ihre Zusammengehörigkeit.
F. Markgraf |
||||||||||||||
| Markgraf,F. | Eine neue Santalacee aus dem östlichen Südafrika. | 114,77, (1) | ||||||||||||
| Thesium Lisae-Mariae H.U. Stauffer n.sp. Suffrutes semiparasiticus, glaber, ... | ||||||||||||||
| Pilleri,G. | Ueber eine Forschungsreise des Berner Hirnanatomischen Institutes nach Bolivien zum Studium des Amazonasdelphins (Inis geoffrensis). | 114,79-96, (1) | ||||||||||||
| Es wird über die Expedition
des Berner Hirnanatomischen Institutes in die Gegend von Beni (Bolivia)
im Februar 1968 berichtet. Nach kurzen faunistischen Angaben über
den südamerikanischen Regenwald werden einige Verhaltensbeobachtungen
über den Amazonasdelphin Inia geoffrensis im Biotop mitgeteilt.
Summary
|
||||||||||||||
| Rast,D. | Chemotaxonomie der Pflanzen -gestern, heute, morgen. | 114,97-111, (1) | ||||||||||||
| Ausblick
Die letztere Eigenschaft würde auch eventuellen auf DNS-Charakteristika der Organismengruppen basierenden Klassifikationen zukommen, ganz abgesehen davon, dass sich die Bestimmung der Basenaufeinanderfolge ganzer DNS-Moleküle vorläufig noch als undurchführbar erweist. Wohl können uns Approximationen bzw. indirekte Methoden der DNS-Analyse, wie Bestimmung des G+C-Gehaltes und der «nearest neighbor frequencies» in DNS verschiedener Herkunft (vgl. hierzu Jukes 1966) oder des Ausmasses, in welchem Hybridisierung zwischen Teilen einfacher DNS-Stränge verschiedener Species erfolgt (Schildkraut et al. 1961; McCarthy und Bolton 1963), Auskünfte über genetische Ähnlichkeit und somit phylogenetische Verwandtschaft geben. An eine rein klassifikatorische Verwendbarkeit derartiger Daten ist jedoch ebensowenig wie im Falle der Proteine zu denken. Wenn nun auch die Pflanzeninhaltsstoffe und deren jeweilige Biogenesewege künftighin einen integrierenden Bestandteil der zur Konstruktion natürlicher Systeme notwendigen Merkmalsgruppen darstellen werden und das vergleichende Studium der genetischen Substanz sich zur Rekonstruktion der Phylogenie der Pflanzen als geeigneter erweisen sollte als die Untersuchung der äussern Form der Organismen, so wird die Morphologie dennoch stets eine erstrangige Bedeutung beibehalten, und wäre es auch nur ihrer grossen praktischen Vorteile wegen. Und wenn einer eine Rose von einer Orchidee zu unterscheiden hat, so wird er sich dabei auch in Zukunft weder um die Aminosäurensequenzen ihrer Proteine noch um die Basenaufeinanderfolge in ihrer DNS interessieren, sondern die Schönheit der Orchideengestalt und den besonderen Duft der Rose beachten. |
||||||||||||||
| Meyenburg, Kaspar von | Katabolit-Repression und der Sprossungszyklus in Saccharomyces cerevisiae. | 114,113-222, (2) | ||||||||||||
| Das aerobe Wachstum von Saccharomyces
cerevisiae in statischer wie in kontinuierlicher Kultur in Glucosemedien
ist durch die Gliederung in zwei Phasen verschiedenen Stoffwechsels gekennzeichnet.
In statischer Kultur ergibt sich Diauxie, wobei in einer ersten Wachstumsphase
Glucose fermentativ zu Äthanol abgebaut und eine hohe spezifische
Wachstumsrate erreicht wird. Äthanol wird in einer zweiten Wachstumsphase
bei niedrigerer spezifischer Wachstumsrate oxydativ umgesetzt.
In kontinuierlicher Kultur ist analog bei kleinen spezifischen Wachstumsraten rein oxydativer, mit steigenden spezifischen Umsetzungen zunehmend fermentativer Stoffwechsel nachweisbar. Parallel zu diesen Veränderungen gehen die Veränderungen der Zusammensetzung der Zelltrockensubstanz (RNS-, DNS-Gehalte), der Zellgrösse und des Anteils von Einzel- und Doppelzellen in der Population. Die Gliederung des Sprossungszyklus in Einzelzell- und Sprossungsphase ändert je nach Wachstumsbedingungen. Bei hohen Wachstumsraten ist der Zyklus durch die Sprossungsphase ausgefüllt, mit abnehmender Wachstumsrate nimmt die Einzelzellphase einen immer grösseren Anteil am Sprossungszyklus ein, wogegen die Dauer der Sprossungsphase konstant bleibt. Die von der spezifischen Wachstumsrate unabhängige Dauer der Sprossungsphase, d.h. der Bildung der Tochterzelle, wird durch den Aufbau von Reserven und deren Abbau mit dem Einsetzen der Sprossung ermöglicht. Durch die Bestimmung des Enzymmusters von Saccharomyces cerevisiae unter verschiedenen Wachstumsbedingungen (in statischer Kultur in Funktion der Wachstumszeit; in kontinuierlicher Kultur in Funktion der spezifischen Wachstumsrate) wird gezeigt, dass die Veränderungen des Stoffwechsels mit steigender Wachstumsrate durch Änderungen des Enzymmusters bedingt sind. Die Enzyme zeigen ganz unterschiedliches Repressions- und Derepressionsverhalten in Funktion der spezifischen Wachstumsrate. Die Bildung der Enzyme des oxydativen Stoffwechsels wie Malatdehydrogenase, Isocitratdehydrogenase, Isocitratlyase, NAD-Glutamatdehydrogenase und Alkoholdehydrogenase und anderer wie Glucose-6-Phosphat-Dehydrogenase, α-Glucosidase und Hexokinase, wird mit zunehmender Wachstumsgeschwindigkeit reprimiert, die Bildung der Glykolyseenzyme wie Phosphoglyceratkinase, Aldolase und Pyruvatdecarboxylase dereprimiert. Der Repressionseffekt steht in enger Beziehung zu den Umsatzraten der verschiedenen Stoffwechselwege, die mit einer bestimmten aktuellen Glucosekonzentration möglich sind. Es wird dargelegt, dass Glucose nicht Effektor der Repression der oxydativen Enzyme sein kann, und gezeigt, dass dieser Typus der Kontrolle des Enzymmusters der Katabolit-Repressi on entspricht. Anhand der Analyse der intrazellulären Konzentrationen von Metaboliten und Coenzymen wird der Zusammenhang zwischen den Veränderungen des katabolischen Pools und der Kontrolle der Enzymbildung untersucht. Die geprüften Stoffe, Adenosinphosphate, Pyridinnukleotide, Glucose-6-Phosphat und Pyruvat, weisen durchwegs eine so komplexe Abhängigkeit von der spezifischen Wachstumsrate auf, dass ein einfacher Bezug zum Verlauf der spezifischen Aktivitäten der Enzyme nicht möglich scheint. Zusammenhänge erscheinen erst bei der Analyse des synchronen Wachstums bei verschiedenen Wachstumsgeschwindigkeiten. Die Abhängigkeit des Metabolit- und Coenzymmusters von der spezifischen Wachstumsrate wird auch bezüglich der Regulation der Enzymaktivitäten diskutiert. Dabei lassen sich einige Hinweise auf die für die Umstellung von Atmung auf aerobe Gärung verantwortlichen Konzentrationen von Coenzymen aufzeigen. Die Veränderung der intrazellulären Konzentrationen von NADH und NAD~ scheint sehr wichtig zu sein. Für die spezifische Bildungsrate von NAD wird gefunden, dass sie genau im Bereich der Umstellung von Atmung auf Gärung den maximalen Wert erreicht. Eine Limitierung der NAD-Bildung kann für diese Umstellung als Ursache betrachtet werden. Die Veränderungen der Konzentrationen von ATP, ADP und AMP stehen damit in Beziehung. Die Interpretation dieser Zusammenhänge wie auch die Beziehung zwischen der Kontrolle des Enzymmusters und den Veränderungen der katabolischen Pools ist beschränkt, da a) die Kompartimentierung nicht zu erfassen ist, und b) die Messungen an asynchronen Populationen erfolgten. Es wird eine Hypothese für die Ursache der Katabolit-Repression dargestellt. Dabei wird angenommen, dass die Katabolit-Repression Ausdruck der relativen Verschiebung der Sequenzen der Genaktivierung und Enzymbildung im Sprossungszyklus bei verschiedenen Stoffwechselgeschwindigkeiten ist. Je höher die Wachstumsgeschwindigkeit, d.h. je kürzer die Generationszeit, desto mehr werden die Genorte derjenigen Enzyme, die katabolischer Repression unterworfen sind, gleichzeitig aktiviert und gelesen. Dadurch müssen bei relativ zur Generationszeit geringer Stabilität der m-RNS Enzyme vermehrt zur gleichen Zeit gebildet werden. Die Repression der Bildung von Enzymen kann damit erklärt werden, dass sich eine Kompetition zwischen dereprimierten Operons bei den Synthesen einstellt. Anhand von Versuchen an synchron wachsenden Populationen von Saccharomyces cerevisiae - eine dazu entwickelte Methode der Synchronisation in kontinuierlicher Kultur wird beschrieben - konnten folgende Schlüsse gezogen werden: a) Die Enzyme werden unabhängig von der Wachstumsgeschwindigkeit in einer bestimmten Sequenz über den Sprossungszyklus gebildet. b) Die Anzahl Enzyme, die pro Fraktion der Generationszeit gebildet wird, ist je nach Wachstumsgeschwindigkeit verschieden, und somit ändert entsprechend dem aufgestellten Modell der Kompetitionsgrad zwischen dereprimierten Operons. Die Enzyme Malatdehydrogenase, a-Glucosidase, NAD-Glutamatdehydrogenase und auch Alkoholdehydrogenase, welche katabolischer Repression unterworfen sind, werden mit abnehmener Generationszeit vermehrt zur gleichen Zeit gebildet. Die Kontrolle der Genaktivierung, die je nach Wachstumsgeschwindigkeit in einem bestimmten Teil des Sprossungszyklus eine hohe oder niedrige Transkriptionsfrequenz ergibt (Anzahl aktivierter Gene pro Fraktion der Generationszeit), scheint mit den Änderungen der intrazellulären Konzentration von Metaboliten und Coenzymen zusammenzuhängen. Die Veränderungen des katabolischen Pools stehen dabei in engster Beziehung zu Änderungen der Gasumsätze QO2 und QCO2~ welche durch die Einlagerung von Reservekohlehydraten in der Einzelzellphase und deren Abbau zu Beginn der Sprossungsphase ermöglicht werden. Die Anwendung der Synchronisation zur Untersuchung der Differenzierungssequenzen der einzelnen Zelle über den Teilungszyklus unter verschiedenen Bedingungen, wofür z.B. die Katabolit-Repression ein Ausdruck ist, wird diskutiert. Es wird dargelegt, dass es für das Auffinden der Zusammenhänge zwischen katabolischem Pool und der Regulation der sequentiellen Genaktivierung und Enzymbildung notwendig ist, die räumliche Gliederung der Zellen zu erfassen. |
||||||||||||||
| Waldmeier,M. | Die Sonnenaktivität im Jahre 1968. | 114,223-243, (2) | ||||||||||||
| The present paper gives the frequency
numbers of sunspots, photospheric faculae and prominences as well as the
intensity of the coronal line 5303 Ä and of the solar radio emission
at the wavelength of 10.7 cm, all characterizing the solar activity in
the year 1968.
Die vorliegende Veröffentlichung gibt die die Sonnenaktivität
charakterisierenden Häufigkeitszahlen der Sonnenflecken, der photosphärischen
Fackeln, der Protuberanzen, die Intensität der Koronalinie 5303 Ä
und diejenige der solaren radiofrequenten Strahlung auf der Wellenlänge
10,7 cm.
The tables 1, 4 and 13 give the daily values of the relative-numbers,
of the group-numbers and of the radio emission, the tables 5, 7, 10 and
11 contain the distribution in latitude of the spots, faculae, prominences
and of the coronal intensity. Fig. 1 and 3 show the course of the relative-numbers
and of the radio emission, and by fig. 2 the distribution in latitude of
the spots, faculae, prominences and of the coronal intensity is demonstrated.
|
||||||||||||||
| Lemans, A. | Der Firnzuwachs pro 1967/68 in einigen schweizerischen Firngebieten, 55. Bericht | 114,245-254, (2) | ||||||||||||
| Mit Ausnahme des Wallis erhielten
die Alpen im Winter 1967/68 überdurchschnittliche Niederschläge,
die im Januar 1968 sogar eine ausserordentliche Intensität erreichten.
Der Sommer 1968
war gekennzeichnet durch zu tiefe Temperaturen, zu wenig Sonnenschein und häufige Niederschläge, besonders in der zweiten Hälfte. Der August war der ungünstigste Monat dieser Periode. Der Firnzuwachs, der im Herbst 1968 in den Glarner und Bündner Alpen beobachtet wurde, war stark übernormal. Ähnlich hohe Werte wurden in den letzten 50 Jahren nur 7- oder 8mal beobachtet. Gegen Westen hin traf man normalere Verhältnisse an. |
||||||||||||||
| Blankenhorn,H., Burla,H., Müller-Meyre,P. & Villiger ,M. | Die Bestände an Amphibien zur Laichzeit in drei Gewässern des Kantons Zürich. | 114,255-267, (3) | ||||||||||||
| In 3 Weihern wurden Amphibien
gefangen, markiert und am Fangplatz wieder freigesetzt. In Zeitabständen
von 2 Tagen wurden die Fänge wiederholt. Aus dem zahlenmässigen
Verhältnis der Markierten zu den Unmarkierten in den Wiederfängen
liessen sich die Bestände schätzen (Tab. 3). In jedem Gewässer
wurden auf diese Weise nur die 3 oder 4 häufigsten Amphibienarten
bearbeitet.
Für den Bergmolch (Triturus alpestris) wurden an allen 3 Gewässern grössere Bestände geschätzt, während der Kammolch (T. cristatus) nur in 2 der Weiher auftrat und dies mit kleineren Beständen. Im grössten Gewässer, dessen Wasserstand während des ganzen Jahres hoch ist, erreichte der Wasserfrosch (Rana esculenta) als einziger Froschlurch einen grossen Bestand. In weitaus kleinerer Zahl war er auch in den 2 anderen Weihern vertreten. |
||||||||||||||
| Heusser,H. & Meisterhans,K. | Zur Populationsdynamik der Kreuzkröte, Bufo calamita Laur. | 114,269-277, (3) | ||||||||||||
| In den Laichzeiten 1967 und 1968
wurden 2394 markierte Kreuzkröten, Bufo calamita, aus einer Kiesgrube
bei Zürich evakuiert und in andern Biotopen angesiedelt. In den Wasserstellen
waren die ww mit 17,6% an der Anzahl der Adulten, die Jungen mit 3% an
der Gruppe der Adulten + Jungen beteiligt; auf dem Trockenen betrugen der
Anteil der ww 38,4%, der Anteil der Jungen 56,1%. Nur die ovulationsbereiten
ww begeben sich zu den ?? (mm) ins Wasser; diese ?? (ww) sind durchschnittlich
grösser als ww vom Trockenen. Während der Fangzeit (18. 5.-5.
7.) wurden die Jungen durchschnittlich grösser, die mm kleiner, weil
ein Teil der Jungen in die Geschlechtsreife eintrat. Je heller die Pigmentierung
der Daumenschwielen ist, desto durchschnittlich kleiner sind die mm (Männchen)
Die Grössenfrequenzen von 1496 im Jahr 1967 gemessenen Kröten und ihrer Wiederfänge im Jahr 1968 werden interpretiert: Die meisten Jungen sind 1jährig, werden mit 1¼ resp. 1 ¾ Jahren geschlechtsreif, pflanzen sich aber meistens erst mit 2 Jahren das erste Mal fort. Die Jungen bestehen fast ausschliesslich, die Adulten vorwiegend aus einem Jahrgang. Dieses populationsdynamische Muster: frühe Geschlechtsreife, schneller Generationenwechsel und kleine mittlere Lebenserwartung wird mit der Populationsdynamik anderer Bufoniden verglichen und den Untersuchungen von Flindt und Hemmer (1968) an Bufo calamita, die andere Ergebnisse brachten, gegenübergestellt. Summary
|
||||||||||||||
| Rüst,H. | Schätzung der Amphibienbestände in einem Teich durch ein Wiederfangverfahren. | 114,279-291 | ||||||||||||
| No Abstract | ||||||||||||||
| Jung,G.P. | Beiträge zur Morphogenese des Zürcher Oberlandes im Spät- und Postglazial. | 114,293-406 | ||||||||||||
| 1. Die morphologische Ausgestaltung
der Täler und Seebecken durch glaziale Erosion wird stark beeinflusst
durch die präpleistozäne Tektonik und das Relief sowie durch
Härteunterschiede im Gestein.
2. Vorstoss- und Rückzug-Schotter konnten deutlich auseinander gehalten werden. Einige bisher als Hochterrassenschotter eingestufte fluvioglaziale Kiese konnten als Würmschotter datiert werden. 3. In den Talzügen der Glatt und der Kämt sowie in den Verbindungstälern gegen das Tösstal hin konnten alle Rückschmelzstadien (in Form von Stirnmoränen oder Ufermoränen, meistens jedoch nur als Relikte) vom Maximalstadium (Killwangenstadium) bis zum Zürichstadium gefunden werden. 4. Die Aathalfurche wurde zur Hauptsache im Würmspätglazial durch randglaziale Schmelzwässer geschaffen, und sie war es, die den Pfäffikersee anzapfte und den nordwestlichen Seeausfluss stillegte. 5. Durch Kubaturberechnungen an Schwemmkegeln und einem Delta sowie Karbonatmessungen an Bachwasser konnten quantitative Werte für die spät- und postglaziale Erosion und Akkumulation gewonnen werden. Folgende mittlere Abtragsleistungen wurden pro Jahr im Zürcher Oberland erreicht:
6. Im Tal von Bäretswil konnte ein randglazialer Stausee nachgewiesen werden. Er existierte zur Zeit des Zürich-I-Stadiums und hatte eine Ausdehnung von ca. 3 km Länge und 150-250 m Breite. Die Spiegelhöhe betrug 704 m. 7. Als Grundursache spätglazialer Seebildung kommt den glazialerosiv entstandenen, übertieften Felswannen primäre Bedeutung zu; die Stirnmoränen haben nur zeitlich beschränkte Staufunktion. 8. Die Seespiegelhöhe eines spätglazialen Sees wird in erster Linie durch die Stirnmoräne und ihre Ausflussdepressionen sowie der dortigen Erosionsintensität reguliert. 9. Die Spiegelhöhe während der postglazialen Entwicklung wird zusätzlich durch die Verlandungssedimente, wie etwa Torf, beeinflusst. 10. Toteis spielt nach den Befunden am Greifen- und Pfäffikersee bei ihrer Entstehung keine wesentliche Rolle; seine morphologische Bedeutung wurde bisher überschätzt. Es dürfte aber bei der Entstehung von Söllen mitgewirkt haben. 11. Spezielle Resultate aus den Pollenanalysen: a) Die 4 charakteristischen Maxima in der Erlenkurve, welche von WELTEN [71] 1947 beschrieben und auch von ZIMMERMANN [77] am Greifensee festgestellt wurden, konnte ich am Greifensee nochmals sowie am Pfäffiker- und Egelsee neu nachweisen. Sie entsprechen wohl Epochen starker Rodungstätigkeit. b) An Hand von Pollendiagrammen konnte die Geschwindigkeit der Bewaldung nach dem Rückschmelzen der Würmgletscher zwischen Chatzen- und Egelsee berechnet werden. Die Waldfront rückte zwischen dem mittleren Alleröd und dem Ende der Jüngeren Dryaszeit aus NW Richtung mit einer mittleren Geschwindigkeit von 22 m pro Jahr vor. c) Der Rückschmelzprozess des Pfäffikerseelappens des Linth-Rhein-Gletschers im Spätglazial erfolgte mit einer mittleren Geschwindigkeit von 18 m pro Jahr. d) Die Zeitspanne zwischen dem Eisfreiwerden eines Gebietes und dessen Bewaldung (mit einem mehr oder weniger geschlossenen Wald) beträgt im Zürcher Oberland im Spätglazial 1000-1100 Jahre. e) Die Seebodenlehmsedimentation wird in der Regel mit dem Abklingen des Gletscherschmelzwassers eingestellt, oft aber erst im Zeitpunkt einer dichteren Bewaldung, was in den Pollendiagrammen durch das Vorkommen von mindestens 40% Baumpollen angezeigt wird. 12. Die Seekreidebildung hängt vorwiegend vom Karbonatgehalt der Zuflüsse ab sowie vom Grad der Eutrophierung des Sees. Sie gehört nicht zum obligatorischen Inventar postglazialer Seesedimente. 13. Durch Vergleich der berechneten Sedimentmenge aus Abtrag und Karbonatlösung mit den stereometrisch bestimmten Volumina ergab sich ein Volumenschwund der Sedimente durch Konsolidierung seit den letzten 12000 Jahren um 24-30%. 14. Die Bildung der Moränenstadien Zürich IV konnte datiert werden; sie fällt ins 12. Jahrtausend vor Chr.; die Eistransfluenz über die Schwelle von Hombrechtikon-Dürnten wurde im 11. Jahrtausend eingestellt. 15. Der Greifenseespiegel sank seit dem Alleröd mehr oder weniger kontinuierlich ab, ohne dazwischenliegende Wiederanstiege des Seespiegels. Die neolithischen Pfahlbauten am Rietspitz standen im Wasser (bei einer Wassertiefe von 2-3 m) und sind somit als echte Wasserbauten zu taxieren. 16. Der Pfäffikerseespiegel sank im Spätglazial auf ein tiefstes Niveau von 537 m ab und hob sich seit dem Atlantikum wieder durch Stau der Verlandungssedimente (Torf) auf 539-540 m, um im Subatlantikum wieder auf das Niveau von 538 m abzusinken. Die Pfahlbauten am Pfäffikersee müssen wie jene am Greifensee im Wasser gestanden haben, da zur Bronzezeit im Pfahlbaugebiet mit einer Wasser-tiefe von 2,5-3,0 m gerechnet werden muss. 17. Beide, Greifen- und Pfäffikersee, hatten im Spätglazial ihre maximale Ausdehnung, welche ungefähr der doppelten heutigen Fläche entsprach. 18. Klimatische wie tektonische Steuerung im Sinne von GAMS-NORDHAGEN [21] für postglaziale Seespiegelschwankungen muss abgelehnt werden. Geomorphologisch-hydrologische Faktoren und jene der Verlandung durch phytogene Sedimente spielen die Hauptrolle bei der Spiegelregulierung. |
||||||||||||||
| Bachofen,R. | Die Ausstellung ,Das wissenschaftliche Pflanzenbild'. Zoologisches Museum der Universität Zürich. | 114,408, (4) | ||||||||||||
| Die Seiten 408 bis 453 sind der "Führer" durch die Ausstellung. Keiner der Beiträge hat ein Abstract. | ||||||||||||||
| Bolliger,R. | Alte Kräuterbücher. | 114,408-419, (4) | ||||||||||||
| Eller,B.M. | Metall- und Steindruck in der botanischen Illustration. | 114,419-428, (4) | ||||||||||||
| Specht-Jürgensen,I. | Ueber die Gartenkunst. | 114,428-432, (4) | ||||||||||||
| Neeracher,H. | Die Abbildungen in Werken der botanischen Anatomie, Morphologie, Systematik und Physiologie. | 114,432-438, (4) | ||||||||||||
| LaRoche,B. | Zu den Techniken des Holzschnittes, des Kupferstiches und der Lithographie. | 114,439, (4) | ||||||||||||
| Hagemann,P. & Lutz,H. | Moderne Methoden zur Herstellung wissenschaftlicher Bilder. | 114,440-450, (4) | ||||||||||||
| Schweizer,D. | Wissenschaftliches Zeichnen im Dienste der Botanik. | 114,450-453, (4) | ||||||||||||
| Bächli,G. | Beitrag zur Kenntnis der Ueberwinterungsstätten von Insekten im Wald. | 114,455-460, (4) | ||||||||||||
| In an area of mixed forest, an
attempt was made to detect sites where insects hibernate. The forest covers
a flat hill Northeast of Zurich, Switzerland, at an altitude of 650 meters
above sea level, or 150 meters above the level of the lake of Zurich. From
February 10 to March 18, 1964, different sorts of materials, sometimes
frozen, were collected and brought to the laboratory, where they were kept
in large containers at room temperature. The material brought in included
bark from 8 species of trees, as well as material from different strata
of the soil, consisting either of decaying leaves or needles. In total,
about 9 m3 of material was collected. The adult insects hidden in the materials
could be detected as they walked or flew away, and could be harvested.
In this manner 4647 insects were collected. Table 1 shows to which systematic
groups they belong, and from which source they came.
The best yields were from the bark of spruce (Picea excelsa), the poorest yield from the bark of fir (Abies alba). Bark yielded more beetles than diptera, soil material more diptera than beetles. Soil containing conifer needles were relatively rich in beetles, while decaying leafs of deciduous trees were rich in diptera. Of a total of 1610 diptera, three were drosophilids: 2 specimens of Drosophila testacea and one specimen of D. kuntzei. |
||||||||||||||
| Lemans, A. | Der Firnzuwachs pro 1968/69 in einigen schweizerischen Firngebieten 56. Bericht | 114,461-468, (4) | ||||||||||||
| Im Winter 1968/69 erhielten die schweizerischen Alpen vorwiegend unternormale bis normale Niederschläge. Überdurchschnittliche Niederschläge wurden dagegen im Oberwallis, in Airolo und im Oberengadin registriert. Der Sommer 1969 war gekennzeichnet durch einen starken Wechsel von Monat zu Monat. Insgesamt brachte er eine normale Sonnenscheindauer und leicht überdurchschnittliche Temperaturen. Sehr warmes und trockenes Wetter herrschte vom 12. Juli bis zum 11. August. Nach einer kühlen und niederschlagsreichen Periode, die sich von Mitte August bis nach Mitte September ausdehnte, folgte ein sehr trockener und milder Herbst, der in tieferen Lagen den Firnhaushalt auch noch beeinflusste. Während man in den Glarner Alpen und im Oberengadin einen durchschnittlichen Firnzuwachs beobachtete, war der Zuwachs im Aletschgebiet wesentlich über der Norm und im Silvrettagebiet darunter. | ||||||||||||||
| Cook; Burla; Kuhn-Schnyder | Die Sammlungen im Jahre 1968 | 114,469-483, (4) | ||||||||||||
| Kein Abstract; Bild des ersten Tintenfisches vom Mt.S. Giorgio. | ||||||||||||||
| Leibundgut, H. | Naturschutz
24. Jahresbericht der Naturschutzkommission der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich für das Jahr 1968 |
114,484, (4) | ||||||||||||
| Meliorationsprojekte, der Bau
grosser Verkehrsanlagen und die Erstellung von Bau- und Zonenplänen
drängten die Naturschutzkommission hauptsächlich in die Lage
des «Verteidigers». So hatten wir uns mit dem Schutz des Klotener-Rietes
zu befassen, unterstützt durch eine Resolution der Generalversammlung
der Naturforschenden Gesellschaft. Obwohl eine schwere Gefährdung
dieses für Lehre und Forschung überaus wertvollen Objektes nicht
abgewendet werden konnte, verfügen wir wenigstens über die Zusicherung
des Regierungsrates, unsere Kommission laufend zu orientieren und mit ihr
zusammen tragbare Lösungen zu suchen.
Zu einem erfreulicheren Ergebnis führten die Bemühungen um die Erhaltung des Winiker- und Glatter-Rietes. Unser Gutachten hat zweifellos dazu beigetragen, dass die Einzonung dieser Flächen durch die Gemeinde Uster abgelehnt wurde. Ebenso zeitigten die Bemühungen um die Pflege des Neeracher-Rietes einige Erfolge. Der erforderliche Schritt kann nun voraussichtlich bald von Organen des Kantons ausgeführt werden. Neben diesen vorwiegend defensiven Massnahmen blieben die Bestrebungen, neue Naturschutzobjekte zu schaffen, nicht erfolglos. Im Reppischtal konnte das Reservat «Girstel» durch Ankauf (ETH) beträchtlich erweitert werden. Die Kommission setzt sich wie folgt zusammen: Prof. Dr. H. Leibundgut (Präsident) Dr. K. Eiberle (Sekretär) Dr. H. Graber Prof. Dr. E. Landolt Prof. Dr. K. Suter Prof. Dr. E. A. Thomas |
||||||||||||||
| Walter,E.J. | Abriss der Geschichte der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich. | 114,485-500, (4) | ||||||||||||
| Kein Abstract | ||||||||||||||
| Schüepp,M. | Robert Billwiller (1878-1969). | 114,501-502, (4) | ||||||||||||
| Siegenthaler,W. | Robert Hegglin (1907-1969). | 114,502-504, (4) | ||||||||||||
| Burckhardt,J.J. | Alfred Kienast-Steffen (1879-1969). | 114,504-507, (4) | ||||||||||||
| Känzig,W. | Paul Scherrer (1890-1969). | 114,507-509, (4) | ||||||||||||
| Ziswiler,V. | Hans Steiner (1889-1969). | 114,509-512, (4) | ||||||||||||
| Hess,R. | Ueber den Schlaf. | 114,513, (4) AR | ||||||||||||
| Der Schlaf wird gewöhnlich als selbstverständlich hingenommen und beschäftigt nur diejenigen, welche nicht schlafen können. In neuerer Zeit hat die Schlafforschung jedoch grosse Fortschritte gemacht. Alle höheren Tiere schlafen, wenn auch in verschiedener Form. Gemeinsam sind die Entspannung der Muskulatur, die Tendenz sich gegen Aussenreize abzuschirmen und entsprechend eine verminderte Reaktionsfähigkeit. Untersuchungen am Menschen zeigen, dass die meisten Organsysteme - mit einigen Ausnahmen - ihre Tätigkeit einschränken. Das Bewusstsein ist herabgesetzt, aber nicht etwa global aufgehoben, denn Weckreize werden gewertet und ihre Wirksamkeit hängt von der Art und Intensität des Reizes ab. Die Schlaftiefe hat eine Entsprechung im stark wechselnden elektroenzephalographischen Bild. Es hat sich nicht bestätigt, dass der Schlaf am Anfang der Nacht am tiefsten ist und allmählich immer leichter wird. Kleitman hat entdeckt, dass er vielmehr in Zyklen abläuft, welche durch ein periodisch wiederkehrendes, grundsätzlich anderes Schlafverhalten gekennzeichnet ist: die Muskulatur ist erschlafft, aber die Augen bewegen sich ruckartig; die Weckschwelle ist besonders hoch, aber nicht für bedeutsame Reize. Erwacht der Mensch aus diesem Stadium, erinnert er sich meist an einen Traum. Das EEG zeigt ein Bild, welches leichtestem Schlaf am nächsten kommt. Neurophysiologische Untersuchungen zeigen, dass die Zellen der Hirnrinde in diesem Zustand vermehrt tätig sind. Dieses Schlafstadium hat verschiedene Bezeichnungen erhalten (Leichtschlaf, Tiefschlaf oder paradoxer Schlaf). Versuche an Mensch und Tier zeigen, dass die paradoxen Schlafstadien wie auch der gewöhnliche Schlaf unentbehrlich sind und nach Einzelentzug auch selektiv nachgeholt werden müssen. Neurophysiologische Experimente (Jouvet) haben Einblicke in die Natur der beiden Schlafformen gestattet: Eine Kerngruppe im ältesten Teil des Gehirnes induziert den Schlaf und reguliert gleichzeitig den Serotoningehalt des Gehirnes. In weiter vorn gelegenen Abschnitten des Hirnstammes scheinen sich die Zentren für die beiden Schlafformen zu differenzieren; eines in der Brücke, welches auch mit der Regulation des Noradrenalins in Beziehung steht, ist für den paradoxen Schlaf, ein weniger gut abgrenzbares Areal im Zwischenhirn und die Grosshirnrinde sind wahrscheinlich für den normalen Schlaf notwendig. (Autoreferat) | ||||||||||||||
| Signer,P. | Das Alter der Erde, der Meteorite und des Sonnensystems. | 114,513, (4) AR | ||||||||||||
| Der Zerfall langlebiger radioaktiver
Isotope kann zur Bestimmung des Alters von Gesteinen bzw. von Mineralien
verwendet werden. Man muss dabei voraussetzen, dass die untersuchten Systeme
während des zu datierenden Zeitraumes chemisch abgeschlossen waren.
Die auf verschiedenen radioaktiven Isotopen basierenden Zerfallsalter werden
verglichen: Gleichheit zeigt an, dass diese Voraussetzung erfüllt
ist.
Die höchsten Alter, die nach solchen Methoden an irdischen Gesteinen gefunden wurden, betragen etwa 2700 Millionen Jahre. An einer Zirkonfraktion aus einem Granit von Minnesota, USA, wurde ein Alter von 3550 Millionen Jahren bestimmt. Meteorite dagegen ergeben Alter von etwa 4600 Millionen Jahren. Es stellt sich die Frage, ob durch geologische Vorgänge auf der Erde ältere Gesteine umgewandelt wurden, bzw. ob die Erde jünger ist als die «Mutterkörper» der Meteorite. Eine geschickte Variation der Altersbestimmungsmethoden erlaubt die Datierung der Erdkruste selbst und gibt so Antwort auf obige Frage: Das Alter der Erdkruste ergibt sich ebenfalls zu 4600 Millionen Jahren. Das Alter des Sonnensystems lässt sich als Summe des Alters der Meteorite und des Zeitraumes zwischen dem Ende der «Kernsynthese» und der Bildung der Meteorite bestimmen. Der letztere errechnet sich unter Zuhilfenahme astrophysikalischer Modelle über die Kernsynthese einerseits und dem in Meteoriten gemessenen Xe129-Gehalt (Tochterprodukt des 1129, Halbwertszeit 16 Millionen Jahre) andererseits zu etwa 100 Millionen Jahren. Damit ergibt sich das Alter des Sonnen-systems als der Zeit, die seit dem Ende der Kernsynthese verstrichen ist - zu 4700 +-150 Millionen Jahren. (Autoreferat) |
||||||||||||||
| Weissmann,Ch. | Vermehrung eines RNA-haltigen Virus. | 114,514, (4)AR | ||||||||||||
| Viren lassen sich in zwei grosse Gruppen auffeilen, je nach der chemischen Beschaffenheit ihres Erbmaterials: 1. DNA-haltige Viren und 2. RNA-haltige Viren. Unter den RNA-haltigen Viren eignen sich Bakteriophagen des Typs Qb besonders für biochemische Untersuchungen, da ihr gesamter Vermehrungszyklus in 20-40 Minuten abläuft. Von besonderem Interesse sind die Vorgänge, die zur Vermehrung des Erbmaterials, eines einsträngigen RNA-Moleküls, führen. Kurz nach Infektion des Bakteriums durch den Bakteriophagen Qb wird in der Wirtszelle (unter Steuerung durch ein Bakteriophagengen) ein RNA-synthetisierendes Enzym, die Replikase, gebildet. Replikase hat eine spezifische Affinität zur Qb-RNA und verwendet diese als Matrize für die Synthese einer neuartigen RNA, die zur Qb-RNA komplementär ist. Dieser Komplementärstrang verhält sich zur Qb-RNA etwa wie ein photographisches Negativ zum Positiv. In einem zweiten Schritt wird das «Negativ» verwendet, um eine grosse Anzahl «Positive», also Virus-RNA-Moleküle, enzymatisch zu synthetisieren. Diese Vorgänge können auch im Reagenzglas unter Verwendung der aus Phageninfizierten Bakterien extrahierten und gereinigten Replikase ausgeführt werden. Negativ-Stränge, die aus infizierten Zellen isoliert und gereinigt wurden, sind nicht infektiös. Sie werden aber von der Replikase in vitro als Matrize verwendet, wobei infektiöse Virus-RNA synthetisiert wird. | ||||||||||||||
| Berg,W. | Forschungsprobleme in der Wissenschaft hinter der Photographie. | 114,514AR | ||||||||||||
| Die Photographie, aufgefasst als «Sammelbegriff für alle Verfahren, die automatisch Informationen in dauerhafter Form so aufzeichnen, dass sie in einem Computer verarbeitet werden können» (Fierens 1968), hat natürliche Grenzen, die durch die Quantennatur der elektromagnetischen Strahlung gegeben sind. Ein «idealer» Empfänger, d.h. einer, der nur durch das Quanten-Rauschen gestört ist und der ein Bild der Qualität eines Fernsehempfängers liefern soll, wäre ca. lO4mal empfindlicher als ein jetziger hochempfindlicher Film. Die informationsmässig auswertbare Quantenausbeute eines Films für sichtbares Licht liegt unterhalb 1% derjenigen des idealen Empfängers. Röntgen-Registriermethoden sind so empfindlich und die Energie eines Quants ist hier so gross, dass die Grenze des Quantenrauschens erreicht ist; eine weitere Steigerung der Empfindlichkeit an sich wäre also sinnlos. Das gleiche gilt für Kernspur-Emulsionen. Ein einzelnes Korn in einer Emulsion reagiert schon auf 4 absorbierte Licht-Quanten; eine Empfindlichkeits-Steigerung auf das Vierfache wäre also im Prinzip möglich; die zufallsmässige Verteilung dieser Körner in der Schicht setzt aber die Grenze für eine mögliche Informations-Speicherung. Die Lichtstreuung und die Verteilung der Körnigkeit in der Tiefe der Emulsions-Schicht sind Gegenstand der Forschung im Photographischen Institut der ETH. | ||||||||||||||
| Schneider,W. | Das Spannungsfeld des modernen Chemikers. | 114,515AR | ||||||||||||
| Ein Kennzeichen für die
moderne Weise der Beschreibung und des Studiums chemischer Phänomene
ist die Möglichkeit, Beziehungen zwischen Eigenschaften von atomaren
Systemen - im besonderen den strukturellen Eigenschaften von ihren Elektronenhüllen
- und von chemischen Verbindungen (kleinere und grössere bis prinzipiell
unbeschränkte molekulare Systeme) aufzuzeigen und auszunützen.
Prinzipielle Aspekte der Beschreibung von Ein-Zentren-Ein-Elektronensystemen
(H, C~5, N~6 usf.), von Mehrelektronensystemen (O, Na-, Fe2- usf.) und
von kleinen Molekeln (N2, 02, F2) werden erläutert, im besonderen
Begriffe und Modelle, welche in Sprache und Vorstellungen des Chemikers
eingegangen sind. Am Beispiel der Synthese von Chlorohämin wird auf
das Problem der Komplexität von grösseren Molekeln und auf die
Bedeutung empirischer Regelmässigkeiten hingewiesen, welche besonders
für den synthetischen Chemiker wichtig sind. Molekulare Systeme wie
z. B. Myoglobin markieren beispielhaft die Berührungszone von Chemie
und Biologie. Die Gegebenheiten der sachlichen Situation stehen in engster
Verbindung mit aktuellen Fragen wie
1. Studienplanung und -gestaltung; Umfang der erforderlichen Kenntnisse im Ganzen, Verteilung der verfügbaren Zeit auf Instruktion in Mathematik, Physik und empirischer Chemie; 2. Kooperation auf der Ebene einer Forschungsgruppe; 3. Verhältnis zwischen Hochschule und Industrie und die Situation der reinen Forschung. Es wird darauf hingewiesen, dass adäquate Konzepte in diesen Problemkreisen einen integrieren- den Bestandteil der Kriterien für Modernität darstellen. |
||||||||||||||
| Wellauer,J. | Moderne Röntgendiagnostik des Herzens und der grossen Gefässe. | 114,515AR | ||||||||||||
| Das menschliche Herz erfährt durch abnorme Belastungen Form- und Lageveränderungen im Thorax. Offenbar werden diese erst erkennbar und messbar im frontalen, seitlichen und halbschrägen Thoraxröntgenbild. Dieses gewinnt an Information, sobald dem Blut einjodhaltiges, flüssiges Kontrast-mittel beigegeben wird. Die Morphologie der Herzkammern, des Blutgefässes und seines zugehörigen Strombettes wird sichtbar, wie auch die Funktion der Blutkreislaufdynamik. Beide Informationen sind notwendig zur Diagnose angeborener oder erworbener Herzfehler und der Schäden, welche Risikofaktoren im Laufe des Lebens an der Wand von Blutgefässen gesetzt haben. Es gibt mancherlei Gründe die es auch heute noch ratsam erscheinen lassen, bei Angiokardiographien und Angiographien Kontrastmittel zu sparen und gezielt zu applizieren. Ein Weg, der ohne Zweifel mit kleinsten Kontrastmittelmengen ein Maximum an Information bringt führt über die selektive Angiographie. Der andere Weg geht über die intermittierende, herzphasen-gesteuerte Injektion des Kontrastmittels. Diese setzt einen Injektor voraus, der verzögerungsfrei arbeitet, den erforderlichen Injektionsdruck in Millisekunden erreicht und selbst kleinste Kontrastmittelmengen von der Grösse eines Bolus auszustossen vermag. | ||||||||||||||
| Spörri,H. | Ueber die Bedeutung und Prinzipien biologischer Regelungssysteme. | 114,515AR | ||||||||||||
| Lebewesen sind physikalisch und chemisch von ausserordentlicher Kompliziertheit und Labilität. Dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik (Entropiesatz) entsprechend, weisen sie die Tendenz auf, in einfachere, stabilere Formen, d.h. in wahrscheinlichere Zustände überzugehen. Nur dank ständiger Energiezufuhr kann dieser instabile Zustand aufrechterhalten werden. Auch unzählige äussere Störfaktoren (Wasser- und Nahrungsmangel, inadäquate Zusammensetzung der Nahrung, hohe oder tiefe Temperaturen, Giftstoffe aller Art usw.) bedrohen die Existenz des Lebendigen. Ein faszinierendes System von nervösen und hormonalen Regelungsmechanismen lässt die Lebewesen - wenigstens eine Zeitlang - alle Angriffe parieren. Dieses Regelungssystem sorgt auch dafür, die Funktionen der vielen Organe eines Körpers harmonisch aufeinander abzustimmen und den vielgliederigen Organismus zu einem Individuum zu integrieren. An Beispielen (Konstanthaltung des «milieu interieur» (CL. BERNARD), des Blutdruckes, des Blutvolumens, der Zahl der roten Blut-körperchen; Regelung des Sexualzyklus, der Muskelkraft usw.) werden die Prinzipien und die Bedeutung der Regelungsmechanismen erläutert und auf den Unterschied zwischen den Begriffen Regelung und Steuerung hingewiesen. Die Verwandtschaft zwischen biologischen und technischen Regelvorgängen hat zu einer neuen Disziplin, der Kybernetik, geführt, auf welcher Mathematiker, Elektroniker, Physiologen und Psychologen eng zusammenarbeiten. | ||||||||||||||
| Landolt,E. | Zur Herkunft unserer Wiesenpflanzen. | 114,516AR | ||||||||||||
| Die Wiesen Mitteleuropas sind zum grössten Teil durch den Menschen geschaffen. Die darin wachsenden Pflanzen entstanden durch ökologische Differenzierung aus Pflanzen umgebender natürlicher Vegetationen, sofern sich die Bedingungen am neuen Standort nicht allzu sehr von jenen am natürlichen Standort unterschieden. Die im Tiefland hauptsächlich verbreiteten Futterwiesen, die Fettwiesen (Arrhenatherion) und die Halbtrockenrasen (Mesobromion) sind dagegen bereits derart verschieden von natürlichen Pflanzengesellschaften, dass es nur wenigen Pflanzen aus der Umgebung gelungen ist, konkurrenzfähige Ökotypen zu bilden. Die Mahd in der ersten Hälfte der Vegetationszeit erweist sich als ein schwerwiegender Eingriff in den Haushalt der Pflanze, den nicht alle Pflanzen ertragen können. Dazu kommt, dass unter den in bezug auf Nährstoff- und Wasser-haushalt des Bodens optimalen Bedingungen ein sehr grosser Konkurrenzdruck herrscht. Erst nach Erhöhung der genetischen Variabilität durch Bastardierung und der damit verbundenen Möglichkeit von neuen Merkmalskombinationen konnten erfolgreiche Wiesenpflanzen entstehen. Der Mensch benützt die Bastardierung von möglichst vielen nah verwandten Sippen zur Heranzüchtung von Kultur- und Zierpflanzen. In der Natur hängt die Bastardierung vom zufälligen Zusammenkommen nah verwandter Sippen ab. Die Möglichkeiten des Zusammentreffens nah verwandter Sippen waren in der Nacheiszeit ausserordentlich günstig. Die durch den Gletscherrückzug frei werdenden Gebiete wurden einesteils durch Gebirgspflanzen und anderenteils durch Steppenpflanzen aus südlichen und östlichen Gegenden besiedelt. Dabei entstanden Bastardschwärme zwischen nah verwandten Sippen, die sich auch während der nachfolgenden Wiederbewaldung an lokal günstigen Stellen halten konnten. Der Mensch schaffte schliesslich durch Beweidung und Bewirtschaftung waldfreier Flächen neue Bedingungen, unter denen sich Bastardabkömmlinge erfolgreich durchsetzen und über weite Gebiete Europas ausbreiten konnten. Dadurch gerieten sie aber vielfach wieder in engen Kontakt mit den ursprünglichen Eltersippen oder mit weiteren nah verwandten Sippen, und Gene wurden erneut ausgetauscht. Das macht es begreiflich, warum die meisten unserer vermutlich hybridogenen Wiesenpflanzen heute systematisch so schwierig zu umgrenzen sind. Anhand der Beispiele des Berg-Hahnenfusses (Ranunculus montanus), der Tauben-Skabiose (Scabiosa columbaria) und des Wiesen-Schaumkrautes (Cardamine pratensis) werden die Verhältnisse näher erläutert. | ||||||||||||||
| Burla,H. | Zoologische Exkursionen in das Gebiet zwischen Stammheimer- und Nussbaumersee (Stammheimertal) . | 114,516-517, (4) | ||||||||||||
| Anschliessend an die Hauptversammlung
wurde eine zoologische Exkursion durchgeführt. Das Ziel der Exkursion
vom 31. Mai war das Gebiet zwischen Nussbaumer- und Hüttwilersee im
Stammheimertal. Die Seen verbindet ein von einem Auenwald gesäumter
Kanal, neben dem ein alter Torfstich liegt. Das Gebiet beherbergt eine
reiche Fauna. Im Kanal wachsen auf Steinplatten 2 Gattungen von Moostierchen
(Bryozoa). Auf Distanz fallen die dicken, schwammigen Kolonien von Piumatella
auf, während man auf Steinen und Muscheln, die man dem Kanal entnimmt,
die zottig-filzigen Kolonien von Paludicella sehen kann. An den tieferen
Schilfteilen im Hüttwilersee sind die gallertigen Kolonien von Cristatella
mucedo, der dritten Moostierart des Gebietes, überaus häufig.
Zwischen den Steinen wachsen grosse, dünnschalige Teichmuscheln (Anodonta),
während unter den Steinen die langfühlerige Schnauzenschnecke
(Bithynia tentaculata, ein Vorderkiemer) kriecht, neben Egeln der Gattungen
Herpobdella, Helobdella und Glossosiphonia, Wasserasseln (Asellus aquaticus)
und Larven von Zweiflügler- und Köcherfliegenarten. Schwärme
von Rotfedern, Egli und Läugel wechseln durch den Kanal von See zu
See.
Im Auenwald oder im Feld beidseits des Kanals sahen oder hörten wir Nachtigall, Wiedehopf, Gartengrasmücke, Dorngrasmücke, Mönchsgrasmücke, Fitislaubsänger, Weidenlaubsänger (Zilpzalp), Pirol, Gelbspötter, Buchfink, Goldammer, Wacholderdrossel, Amsel, Mäusebussard, Schwarzer Milan, Star, Kiebitz und Feldlerche. Im Gras und Gebüsch fallen Buschschnecke (Bradybaena fruticum), Garten- und Hainschnirkelschnecken (Cepaea hortensis und C. nemoralis) auf, während am Schilf Bernsteinschnecken (Succinea putris) hängen. Pfaffenhütchen-Sträucher sind teilweise entlaubt durch den Frass einer Mottenraupe (Yponomeuta), die gesellig in Gespinsten lebt. Brennesseln am Waldrand ernähren die Raupen des Kleinen Fuchses (Vanessa urticae). Klopfen an den Sträuchern bringt grossen Ertrag an verschiedenen Käfer-, Wanzen-, Hautflügler-, Fliegen- und Mückenarten. Skorpionfliegen, zwei Arten von Florfliegen und mehrere Libellenarten lassen sich mit dem Netz fangen. In einer Kiesgrube südlich des Kanals, ausgezeichnet durch eine wärmeliebende Fauna mit Weinberg- und Heideschnecken (Helicella), demonstrierte Herr Hans Traber eine Direktübertragung vom Mikroskop auf den Fernsehschirm. Er zeigte die Flimmerbewegung auf den Tentakeln lebender Moostierchen und das Pulsieren der kontraktilen Vakuole an einem Einzeller. Die Exkursion wurde in 4 Gruppen geführt, die unabhängig voneinander zirkulierten und dabei zum Teil ganz verschiedene Tiere aufgriffen und beobachteten. An der Leitung beteiligten sich ausser dem Berichterstatter die Herren Prof. Pierre Tardent, Dr. Hans Jungen, Assistent am Zoologischen Museum und Herr Hans Balmer, Doktorand bei Herrn Dr. W. Sauter (Eidg. Techn. Hochschule). |
||||||||||||||
| Kurth,A. | Waldwiederherstellung in der Kastanienzone der Alpensüdseite. Ein Beispiel angewandter forstlicher Forschung und Planung. | 113,1-27 |
| Abstract siehe Autoreferat 112,287
Anhang: Schweizerische Bibliographie zur Kastanienwaldforschung 1950-1966 von Walter Strub. (86 Arbeiten) |
||
| Claude,C. | Das Auftreten langschwänziger alpiner Formen bei der Rötelmaus Clethrionomys glareolus (Schreber,1780), der Waldspitzmaus Sorex araneus (Linné, 1758) und der Zwergspitzmaus Sorex minutus (Linné, 1766). | 113,29-40 |
| 1. Rötelmäuse (Clethrionomys
glareolus), Waldspitzmäuse (Sorex araneus) und Zwergspitzmäuse
(Sorex minutus) von der Göscheneralp (1700 m) und von Zürich
(620 m) werden in bezug auf Schwanzlänge und Schwanzstruktur miteinander
verglichen.
2. Kleine Rötelmäuse haben in den Alpen wie im Mittelland gleichlange Schwänze. Grosse Tiere sind auf der Göscheneralp absolut und relativ langschwänziger als in Zürich. 3. Die alpinen Wald- und Zwergspitzmäuse sind in jeder Körpergrössenklasse langschwänziger. 4. Die Unterschiede in der 5chwanzlänge zwischen den Rötelmäusen von Zürich und der Göscheneralp werden im Laufe des selbständigen Lebens ausgebildet. Bei den Spitzmäusen werden die Unterschiede zwischen den beiden Mustern bereits in der Nestlingszeit festgelegt. 5. Die Tiere aller 3 Arten haben in den Bergen mehr Schwanzringel. Bei der Rötelmaus ist die Zahl der Schwanzringel weder mit dem Alter noch mit der Schwanzlänge korreliert. 6. Die alpinen Formen der Rötelmaus und der Waldspitzmaus haben durch¬schnittlich einen Schwanzwirbel mehr. 7. Die Unterschiede in den Schwanzlängen zwischen Kleinsäugern der Alpen und des Mittellandes können schon bei der Erstbesiedlung der Gebiete vorhanden gewesen sein oder haben sich seit der Eiszeit durch Einwirkung unterschiedlicher Umwelt herausgebildet. Es gibt aber keine Hypothese, die mit den bisherigen Ergebnissen widerspruchslos übereinstimmt. |
||
| Higham,C.F.W. | Patterns of prehistoric economic exploitation on the alpine foreland. | 113,41-92 |
| No Abstract (first two col. of Tab 23.)
Species Egolzwil 2 Bos taurus (domestic) L. 13.5 ±3.4 Sus scrofa (domestic) L. 8.4 ±2.6 Ovis aries L. / Capra hircus L. 9.3 ±2.8 Bos primigenius L. 5.7 Sus scrofa ferus L. 7.1 Cervus elaphus L. 27.4 Capreolus capreolus L. 8.6 Castor fiber L. 3.5 Ursus arctos L. 2.4 Meles meles L. 3.0 Martes sp. L. 0.1 Putorius putorius L. 0.0 Lutra lutra L. 0.5 Canis lupus L. 0.3 Vulpes vulpes L. 0.8 Felis sylvestris S. 0.5 Lynx lynx L. 0.3 Alces alces L. 4.2 Bison bonasus L. 1.3 Canis familiaris L. 3.0 Erinaceus europaeus L. 0.1 Sciurus vulgaris L. 0.0 Lepus europaeus Pall. 0.0 Equus caballus L. 0.0 Rupicapra rupicapra L. 0.0 Capra ibex L. 0.0 Sample size 391 (Individuals/Fragments) Inds. |
||
| Pilleri,G. | Enthemmungsphänomene im psychorganischen Abbau. | 113,93-102 |
| Kein Abstract | ||
| Güller,A. | Das "Eisloch" an der Lägern. | 113,103-118, (1) |
| Das Eisloch an der Lägern bildet somit durch seine Morphologie, durch sein lokal ausgeprägtes Kälteklima und die dadurch bedingte Vegetation eine Lokalität, die in ihrem Charakter von demjenigen des Lägernsüdhanges für jeden aufmerksamen Beobachter in auffälliger Weise abweicht. Es ist zu hoffen, dass dieses kleine Areal, das einen durchaus alpinen Anklang aufweist und zudem in forstlicher Hinsicht einen geringen Ertrag abwirft, in seiner Eigenart erhalten werden kann. Ein Anfang in dieser Richtung wurde bereits gemacht, indem die Gemeinde Otelfingen im Jahre 1932 jede Ausbeutung von Steinen aus dem Tälchen durch Gemeindebeschluss untersagte. Es wäre wünschenswert, wenn ein solcher Beschluss auch durch die Gemeinde Wettingen für den aargauischen Teil desselben ausgesprochen werden könnte. Ausser einem Schutz vor der Ausbeutung durch Entfernung der Blöcke sollte aber auch die Vegetation und Flora unter totalen Schutz gestellt werden. Nur auf solche Weise kann verhindert werden, dass immer wieder ganze Moosteppiche von den Felsblöcken gerissen oder die prachtvollen Farnwedel zu Geschäfts- und Dekorationszwecken abgeschnitten und weggeführt werden. | ||
| Domac,R. | Die Zuteilung der Arten zu den Vegetationsgürtel innerhalb der Flora Jugoslawiens. | 113,119-155, (2) |
| Platzhalter | ||
| Moser,Verena | Der Blütenbau der angeblich verwandten Gattungen Davidia und Campotheca. | 113,157-186, (2) |
| a) Davidia
Die schräg an der Achsenkeule sitzende Zwitter Blüte von Davidia kann auf Grund ihrer Entwicklungsgeschichte als terminal betrachtet werden. Wegen eines häufig ausgebildeten Gewebewulstes ausserhalb der Staubblattansatzstellen muss man wohl für Zwitter und männliche Blüten einen Überrest eines Blütenbechers annehmen, dessen Natur sich nicht eindeutig abklären liess. Unterständigkeit des Fruchtknotens kann deshalb nicht ohne weiteres ausgeschlossen werden, wenn sie auch nicht direkt beweisbar ist. Sie dürfte aber kein allzu grosses Hindernis für den Anschluss der Davidiaceen an die Actinidiaceen sein. Im synkarpen Fruchtknoten werden die anfangs offenen Ventralspalten und die zentrale Fruchtknotenhöhle später durch Aufeinanderlegen der Karpelloberseiten und durch lockere, grosse Zellen der Epidermis verschlossen. Die Samenanlagen sitzen an den miteinander verschmolzenen Querzonen der Karpelle, doch kann nicht abgeklärt werden, inwiefern die Achse am Aufbau des zentralen Gewebezapfens beteiligt ist. Der ganze Blütenstand lässt sich nicht genau analysieren. Die Vermutung, dass es sich um einen komplexen, gestauchten Blütenstand handelt, vergleichbar demjenigen von Äctinidia latifoha, liegt nahe. h) Camptotheca
|
||
| Waldmeier,M. | Die Sonnenaktivität im Jahre 1967. | 113,187-207, (2) |
| The present paper gives the frequency
numbers of sunspots, photospheric faculae and prominences as well as the
intensity of the coronal line 5303 Å and of the solar radio emission
at the wavelength of 10.7 cm, all characterizing the solar activity in
the year 1967.
Die vorliegende Veröffentlichung gibt die die Sonnenaktivität charakterisierenden Häufigkeitszahlen der Sonnenflecken, der photosphärischen Fackeln, der Protuberanzen, die Intensität der Koronalinie 5303 Å und diejenige der solaren radiofrequenten Strahlung auf der Wellenlänge 10,7cm. Mean daily sunspot relative-number Mittlere tägliche
Sonnenflecken-Relativzahl 93,8 (47,0)
The tables 1, 4 and 14 give the daily values of the relative-numbers, of the group-numbers and of the radio emission, the tables 5, 7, 11 and 12 contain the distribution in latitude of the spots, faculae, prominences and of the coronal intensity. Fig. 1 and 3 show the course of the relative-numbers and of the radio emission, and by fig. 2 the distribution in latitude of the spots, faculae, prominences and of the coronal intensity is demonstrated. Tabellen 1, 4 und 14 enthalten die Tageswerte der Relativzahlen, der Gruppenzahlen und der Radioemission, die Tabellen 5, 7, 11 und 12 die Breitenverteilung der Flecken, Fackeln, Protuberanzen und der Koronahelligkeit. In Abb. 1 und 3 ist der Verlauf der Relativzahlen und der Radioemission dargestellt, in Abb. 2 die Breitenverteilung der Flecken, Fackeln, Protuberanzen und der Koronahelligkeit. |
||
| Hofmann,Ursula | Untersuchungen an Flora und Vegetation der Ionischen Insel Levkas. | 113,209-256, (3) |
| Kein Abstract | ||
| Heusser,H. | Die Lebensweise der Erdkröte, Bufo bufo (L.); Laichzeit: Umstimmung, Ovulation, Verhalten. | 113,257-289, (3) |
| Die Erdkröten, Bufo bufo
(L.), die im Frühjahr im Laufe von 2 3 Wochen den Laichplatz erreichen,
haben eine Vorlaichzeit (vom Eintritt ins Wasser bis zur Ovulation), die
meistens 6 - 14 Tage dauert.
In dieser Vorlaichzeit machen die Kröten eine Umstimmung durch, die sich bei den Männchen darin äussert, dass die Schwelle für das Paarungsverhalten sinkt, für die Flucht steigt und darin, dass sie tag- und nachtaktiv werden. In zeitlich gestaffelten, standardisierten Verfrachtungsversuchen («Stimmungsbarometer») verlieren sie zudem um die Zeit, da die Weibchen der gleichen Population ovulieren, den Trieb, zum Laichplatz zu wandern. Beim Weibchen lösen vor allem die Reizkomplexe Licht und Wasser nach einer Inkubationszeit von gewöhnlich 6-14 Tagen die Ovulation und das damit starr gekoppelte Laichverhalten aus. Am fremden Ort ist die das Laichen auslösende Reizsumme etwas erniedrigt; der Amplexus kann sie unter suboptimalen Bedingungen etwas erhöhen. Vom Beginn der Wanderung an steigt zudem die innere Ovulationsbereitschaft an, so dass spät am Laichplatz erscheinende Weibchen die deutlich kürzere Inkubationszeit haben als früh anwandernde, was zur Folge hat, dass die effektive Laichzeit bei Bufo bufo sehr kurz ist. Der schrittweise Abbau der natürlichen Situation bei den Ovulationsversuchen deckte ausserdem verschiedene Laboreffekte auf, die zu Fehlinterpretationen führen können. Das Paarungs- und Laichverhalten werden beschrieben. Auch das Weibchen hat den vollständigen männlichen Verhaltenssatz der Paarung und Befruchtung. Unmittelbar nach dem Laichen machen die Weibchen eine erneute Umstimmung durch, die sie veranlasst, in der folgenden Nacht den Laichplatz zu verlassen. Klammernde Männchen werden mit spezifischen Bewegungen abgewiesen. Einige Tage später verlassen auch die meisten Männchen den Laichplatz; nur einzelne bleiben bis im Mai am Laichplatz zurück (Nachlaichzeit). Summary
|
||
| Schwarzenbach,F.H. | Die Beziehungen zwischen Gewichtsverlust und Ueberlebensdauer bei bestrahlten Mäusen (einmalige Ganzkörperbestrahlung mit 700 oder 800 rad). | 113,291-303, (3) |
| 1. In vier Versuchsserien mit
Serien zu 24-35 Tieren wurde nach einmaliger Ganzkörperbestrahlung
mit subletalen Dosen die Uberlebensdauer und der Gewichtsverlust zwischen
Bestrahlungs- und Todestag bestimmt.
2. Die beiden ersten Gruppen wurden einer Strahlendosis von 700 rad ausgesetzt; die Tiere der ersten Serie erhielten vor Bestrahlung eine Beifütterung von «Biostrath» während 95 Tagen; die zweite Serie diente als Kontrolle. Die Mäuse der dritten und vierten Gruppe wurden mit einer Dosis von 800 rad bestrahlt. Die Tiere der dritten Serie hatten vor Bestrahlung während 24 Tagen «Biostrath» erhalten; den Mäusen der vierten Gruppe wurde kein Futterzusatz verabreicht. 3. In den vier Gruppen berechneten wir die einfache lineare Korrelation zwischen Überlebensdauer und Gewichtsverlust, wobei zur Vereinfachung der numerischen Berechnungen die Originaldaten transformiert wurden (LINDER 1964, DOCUMENTA GEIGY 1960). Die Auswertung ergab, dass nur in der Gruppe D (Dosis 800 rad, Vorfütterung mit «Biostrath» während 24 Tagen) die Korrelation mit P <0,05 gesichert erscheint. 4. In der Gruppe B (Vorfütterung mit «Biostrath» während 95 Tagen, Bestrahlung 700 rad) ist gegenüber der Kontrolle A die Überlebensdauer um 1,24 Tage verkürzt, der durchschnittliche Gewichtsverlust um 2,24 Rechnungseinheiten (= 1,12 g) vermindert. Die Unterschiede sind bei beiden Messgrössen signifikant (P <0,05 nach t-Test). 5. Der Vergleich zwischen den einfachen linearen Regressionen der Gruppen A und B (Überlebensdauer als unabhängige, Gewichtsverlust als abhängige Variable) ergibt, dass die beiden Geraden als parallel betrachtet werden können. Der tägliche Gewichtsverlust nach Bestrahlung wird somit durch Vorfütterung mit «Biostrath» nicht beeinflusst. Dagegen verlieren die Tiere der Versuchsserie im Mittel 1,64 Einheiten (-- 0,82 g) weniger an Gewicht als die Kontrollen. Die Differenz ist mit P <0,001 statistisch gesichert. 6. Der Vergleich der Regressionen in den Gruppen C und D (24d Vorfütterung mit «Biostrath», Bestrahlung mit 800 rad) ergibt keine signifikanten Unterschiede in Steigung und Lage, auch wenn sich eine gleichsinnige Lageverschiebung wie im ersten Versuch (A, B) abzeichnet. 7. Aus den Ergebnissen der Analyse wird geschlossen, dass eine langdauernde Vorfütterung mit «Biostrath» die Gewichtsverlust-Funktion nach Bestrahlung beeinflussen kann. |
||
| Stauffer,H.U. | Spirogardnera, eine neue Santalaceen-Gattung aus West-Australien. | 113,305-309, (4) |
| Spirogardnera rubescens STAUFFER
nov. genus et species
Frutex semiparasiticus parvus, glaber, sympodiah modo ramificatus. Rami et ramuli teretes. Folia iuvenilia parva, linearia, mox decidua, adulta squamiformia, exstipulata. Inflorescentiae terminales, spicatae, e glomerulis spiciformibus parvifloris, conspicue spiraliter distributis compositae, Flores hermaphroditi, sessiles, ad axem articulati. Tepala (4- )5, sine articulatione tubo florali inserta, valvata, extus glabra, intus pilis poststaminalibus munita. Stamina (4-)5, epitepalia; filamenta brevia, prope basin petalorum inserta; antherae introrsae, dorsifixae, dithecicae; loculamenta bina superposita et separatim dehiscentia (modo Choretri et Leptomeriae). Discus epigynus, carnosus, distincte lobatus, lobi cum tepalis alternantes. Gynaeceum receptaculo conico immersum; stylus brevissi mus; stigma truncatum, apice 5-gibbosum, gibbis epitepalibus; ovanum 5-loculare; ovula pendula, in quoque loculo solitaria, funiculo indistincto apici placentae centralis affixa. Fructus sessilis, drupaceus, ellipsoideus, monospermus, basi carpo podio crasso instructus (modo Thesii), tepalis, disco styloque persistentibus coronatus; exocarpium laeve, membranaceum, mesocarpium carnosum, endocarpium crustaceum, tenue, extus et intus laeve. Semen endocarpio conforme; endospermium copiosum; embryo ad apicem situs, parvus, centralis, inversus. West-Australien: Perth, 7 Meilen östlich Wannamal (ca. 1 Meile von der Hauptstrasse), in Hartlaubwald aus Eucalyptus redunca mit Santalum acuminatum, auf lateritisch-granitischem Boden, häufig. - Strauch bis 160 cm, Blüten weiss, junge Früchte rot. 8.Nov.1963, n. 5385, leg. H. U. STAUFFER, C. R. GARDNFR, A. 5. GEORGE. - Holotypus in Herb. Z. Ergänzende Beobachtungen: Keimpflanzen mit 2 (einmal 3) Keimblättern und mit Kotyledonarknospen. Blütenstände: Nachdem die terminalen Blütenstände abgestorben sind, setzt sich die Verzweigung sympodial fort wie bei Choretrum und Leptomeria. An den Blüten-trieben sitzen kahle, rötlich überlaufene, am Rande fein gezähnelte Schuppenblätter, die artikuliert und daher abfällig sind. Die Infloreszenzachse ist kahl, ½ rund, ohne Rippen, sukkulent, hellgrün bis oliv-braungrün. An ihrer Basis sitzen einige Schuppenblätter. Die Brakteen, die beim Auf blühen mehr oder weniger abfallen, sind am Rande gezackt, hyalin-hellgrün, ½ rötlich überlaufen. Die Infloreszenzachse endet mit einem Stumpf (nur einmal wurde eine Endblüte gesehen). Die Blütenknäuel bestehen meist aus einer Mittelblüte und 2 Seitenblüten, oft kommt noch eine dorsale vierte Blüte hinzu; alle kehren ihrer Tragblattschuppe einer Lücke zwischen zwei Tepalen zu. (Daraus lässt sich ihre racemöse Anordnung erschliessen.) ... |
||
| Burla,H. & Bächli,G. | Beitrag zur Kenntnis der schweizerischen Dipteren, insbesondere Drosophila-Arten, die sich in Fruchtkörpern von Hutpilzen entwickeln. | 113,311-336 |
| A total of 1246 mushrooms were
brought to the laboratory, where the insect larvae contained in them were
allowed to develop. The mushrooms were collected in a mixed forest covering
the hillside Northeast of Zurich, Switzerland. A pilot survey was made
in August of 1963. A larger collection followed in 1964, from end of July
to end of October. Table 1 contains a list of 121 mushroom species brought
in the course of the two periods, together with the number of mushrooms
per species.
A total of 7118 insects were skimmed off, 97,8% of which were diptera (table 2). Among them, Mycetophilidae were predominant, while Drosophilidae, Phoridae and Limnobiidae were less abundant. Several single mushrooms were host to more than one dipteran family. Table 16 shows the combinations observed, the number of mushrooms per combination as well as the expected number of mushrooms per combination, computed on the assumption of random association. It is noteworthy that joint occurrence of drosophilids with other dipteran families in the same individual mushroom was, as a rule, more frequent than expected, while the reverse is true for Mycetophilidae. Drosophilidae and Mycetophilidae seem to avoid each other, a conclusion which can also be drawn from figure 4. This figure shows the relative frequency of 4 dipteran families in the course of the second collecting period. The survey was made to get hold of fungus-dwelling species of Drosophila. Actually, 2454 of the flies harvested were drosophilidae, all belonging to the genus Drosophila. The 8 species obtained are listed in table 6, along with the names of their host mush-rooms. With the exception of D. funebris, all of the Drosophila species listed were known, or suspected, to be fungus dwellers. In this country, D. funebris is a general scavenger, known to breed in mushrooms occasionally. Tables 7 to 9 list the main host mushrooms for 4 of the Drosophila species. In every instance, the association was more frequent than expected on the base of random occurrence. In several individual mushrooms, from 2 to 5 Drosophila species developed side by side (table 12). These occurrences were not distributed randomly. Mushrooms with 1 host species were less frequent than expected, while mushrooms with 2 to 4 host species were more frequent than expected. |
||
| Hünermann,K.A. | Der Schädel eines Auerochsen (Bos primigenius Bojanus 1828) von OberIllnau, Kt.Zürich. | 113,337-345 |
| Kein Abstract | ||
| Rohweder; Burla; Laves; Kuhn-Schnyder; Henking | Die Sammlungen im Jahre 1967 | 113,347-363 |
| Kein Abstract, aber folgende Berichte
Botanischer Garten und das Botanische Museum der Universität Zürich Zoologisches Museum der Universität Zürich mineralisch-petrographische Sammlung der ETH Paläontologisches Institut und Museum der Universität Zürich Sammlung für Völkerkunde der Universität Zürich die medizinhistorische Sammlung fehlt |
||
| Lemans, A. | Der Firnzuwachs pro 1966/67 in einigen schweizerischen Firngebieten. 54. Bericht | 113,364-371 |
| In den meisten Gebieten der Alpen brachte der Winter 1966/67 stark übernormale Niederschläge. An einigen Stellen des Alpennordhanges wurden neue Rekordwerte erreicht. Obwohl der Hochsommer 1967 sonnig und ziemlich warm war, blieb im Herbst ein überdurchschnittlicher Firnzuwachs übrig, auch wenn strichweise die Zuwachswerte des Vorjahres nicht wieder erreicht wurden. | ||
| Leibundgut, H. | 23. Jahresbericht der Naturschutzkommission der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich für das Jahr 1967 | 113,372 |
| Eine erfreuliche Zusammenarbeit
mit verschiedenen Amtsstellen des Kantons und dem Zürcher Naturschutzbund
beschränkte auch im Berichtsjahr die Aufgaben unserer Naturschutzkommission
auf die Beantwortung zahlreicher Anfragen, welche an die zuständigen
Institute der Universität oder der ETH überwiesen werden konnten.
Dagegen musste sich die Kommission eingehender mit der Frage nach einer
zweckmässigen Betreuung der Naturschutzreservate befassen. Insbesondere
das Neeracherriet steht in der Gefahr, infolge ungenügender Aufsicht
und mangelhafter Pflege zunehmend beeinträchtigt zu werden. In unseren
Bemühungen zur Verbesserung der Verhältnisse unterstützte
uns namentlich Frl. Dr. Julie Schinz in wertvoller Weise. Ebenso bereitete
uns die Gefährdung anderer, für den Unterricht und die Forschung
in Botanik und Zoologie nützlicher Teich- und Rietflächen Sorgen.
Wir bemühen uns um einen wirksamen Schutz der wichtigsten Objekte.
Die Naturschutzkommission setzt sich aus folgenden Mitgliedern zusammen: Prof. Dr. H. Leibundgut (Präsident) Forsting. Dr. K. Eiberle Prof. Dr. H. Graber Prof. Dr. E. Landolt Prof. Dr. K. Suter Prof. Dr. E. A. Thomas |
||
| Müller, Emil | Resolution betr. Klotenerriet | 113,372 |
| Hauptversammlung der NGZ, 18. Mai 1968:
Resolution betr. Klotenerriet
Das Klotenerriet ist heute durch Flugplatzerweiterungen bedroht. Obwohl
es nur noch ein kleiner Rest einer ehemals ausgedehnten, zusammenhängenden
Sumpflandschaft im mittleren und unteren Glattal ist, gehört es zu
den vielseitigsten und artenreichsten Landschaften des Kantons Zürich.
Botanische, ornithologische und entomologische Gutachten geben Zeugnis
vom hervorragenden Wert dieses Gebietes. In über 26 verschiedenen,
zum Teil im Kanton sehr seltenen Pflanzen-Gesellschaften wurden 550 Arten
von Gefässpflanzen, 150 Vogelarten und eine fast unüberblickbare
|
||
| Zeller,W., Zuber,E. &Klötzli,F. | Das Schutzgebiet Mettmenhaslisee, Niederhasli. | 113,373-405 |
| Das Schutzgebiet am Mettmenhaslisee wurde im Hinblick auf die geologischen Verhältnisse, den Wasserhaushalt, die Standorts- und Vegetationstypen und den menschlichen Einfluss beurteilt. Dabei hat sich ergeben, dass der Mettmenhaslisee allein schon als einer der schönsten Zeugen der letzten Eiszeit schützenswert ist. Sein besonderer landschaftlicher Reiz liegt jedoch im mosaikartigen Ineinandergreifen verschiedener Standorte und Pflanzengesellschaffen auf kleinstem Raum begründet, das weitgehend durch die Wiederverlandung und Verstrauchung früher abgetorften Areals zustande gekommen ist. Damit bietet es heute einer mannigfaltigen Tierwelt Rast-, Brut- und Nahrungsraum. Abschliessend wurden Vorschläge für die Gestaltung des Schutzgebietes, vorab im Hinblick auf seine künftige Einbeziehung in ein stark besuchtes Erholungsgebiet, gemacht. | ||
| Schaeppi,H.J. | Alfred Ernst (1875-1968). | 113,417-418 |
| Markgraf,F. | Werner Lüdi (1888-1968). | 113,418-421 |
| Koch,H. | Wolfgang Herz (1901-1968). | 113,421-422 |
| Wanner,H. | Alfred Rutishauser (1906-1967). | 113,422-424 |
| Vogt,B. | Die Bedeutung der Gefässchirurgie in der Traumatologie. | 113,425AR |
| Es wird einleitend darauf hingewiesen,
dass sich das Schicksal gefässverletzter Patienten seit der Anwendung
der rekonstruktiven, gefässchirurgischen Möglichkeiten enorm
verbessert hat. Während noch vor der Ära der Gefässchirurgie
die Amputationsquote, insbesondere von Gefässverletzungen, bei denen
eine Unterbindung notwendig war, durchschnittlich 50% betrug, konnte sie
dank der Gefässchirurgie auf rund 10 % gesenkt werden.
Anhand einer Reihe von Beispielen wird gezeigt, wie sich die Gefässchirurgie bei leichten, mittelschweren und schwersten Verletzungen gliederhaltend auswirkt. Die Traumatologie hat dadurch eine ganz besondere Erweiterung und Bereicherung erfahren. |
||
| Burla,H. | Die Chromosomen in Raum und Zeit. | 113,425AR |
| Drosophila subobscura, eine paläarktisch verbreitete Fliegenart, zeichnet sich aus durch einen reichen chromosomalen Inversions-Polymorphismus. In natürlichen Populationen der Art kommen alle fünf Chromosomen in mehreren Strukturtypen vor. Strukturtypen entstehen auseinander durch Inversion (Stückumkehr) oder Stückaustausch. Bis heute wurden 54 Inversionen nachgewiesen, die zusammen mit 13 Stückaustauschvorgängen 67 verschiedene Strukturtypen hervorbrachten. Je Autosom - und beim ? auch in Geschlechtschromosomen - sind in jeder Fliege 2 Strukturtypen kombiniert: entweder zwei verschiedene, was sich im mikroskopischen Bild als mehr oder weniger komplizierte Schlinge äussert, oder zwei gleiche. Im ersten Fall spricht man von Heterokaryotypen, im zweiten Fall von Homokaryotypen. Zur Charakterisierung einer natürlichen Population wird in einer Stichprobe bestimmt, welche Strukturtypen vorkommen, wie häufig sie sind und wie häufig die möglichen karyotypischen Kombinationen auftreten. Bisher wurden von mehr als 50 Plätzen im Verbreitungsareal der Art Stichproben gesammelt, eine Arbeit, in die sich Institute verschiedener Länder teilten. So wurde vom Zoologischen Museum der Universität Zürich aus in verschiedenen Teilen der Schweiz gesammelt, ferner in Tanger, Tunesien, Kleinasien und Persien. Alle Daten zusammengenommen ergeben sich für einzelne Strukturtypen geographische Verbreitungen, die vom Überleben in Glazialrefugien und vom postglazialen Ausbreitungsgeschehen geprägt sind. Das Vorkommen von acht endemischen Strukturtypen im tunesischen Material belegt eine Isolation dieses Arealteils während langer Zeit. Die nördlichen Mittelmeerländer scheinen der Art optimale Lebensbedingungen zu bieten und werden als ökologisches Arealzentrum gewertet. Von da aus verlieren einige Strukturtypen nach Norden hin kontinuierlich an Häufigkeit. Im nördlichen Teil des Areals nehmen Homokaryotypen überhand als Folge des Überwiegens einiger weniger Strukturtypen, während in mediterranen Populationen Heterokaryotypen das Bild bestimmen: eine Folge der Koexistenz mehrerer Strukturtypen und ihrer ausgeglichenen Häufigkeiten. Um die tieferen Unterschiede zwischen nördlichen und südlichen Populationen zu verstehen, wird Zuflucht genommen zu evolutionstheoretischen Modellvorstellungen. So wird angenommen, dass im Norden und im Alpengebiet, den ökologischen Kampfzonen, Anpassung von Homokaryotypen an Härtebedingungen populationsgenetisch wirksam sind, während im optimalen Milieu der nördlichen Mittelmeerländer Heterosis im Sinn überlegener Fortpflanzungsleistung der Heterokaryotypen den Ausschlag gibt. (Autoreferat) | ||
| Krayenbühl,H. & Yasargil,M.G. | Der neurochirurgische Beitrag zum Hirnschlag. | 113,426AR |
| Dank der erst vor 40 Jahren eingeführten zerebralen Angiographie können heutzutage mehr als 30 verschiedene Gefäss-Krankheiten des Gehirns diagnostiziert werden, welche früher unter dem Sammelnamen «Hirnschlag» unspezifiziert bleiben mussten. Die differenzierte rechtzeitige Erfassung der Hirn-Gefäss-Krankheiten ermöglichte die Entwicklung der entsprechenden differenzierten chirurgischen Massnahmen in den letzten 30 Jahren. Eine bedeutende neue Errungenschaft stellt die Anwendung des binokularen Mikroskopes bei Hirn- und Rückenmarks-Operationen dar. Anhand von Diapositiven werden einige Beispiele von 100 Mikrooperationen erläutert, welche innerhalb der letzten 10 Monate in der Neurochirurgischen Universitätsklinik Zürich vorgenommen wurden. | ||
| Dütsch,H.U. | Globale Atmosphärenforschung und langfristige Wettervorhersage. | 113,426-427AR |
| Mit der Entwicklung von elektronischen
Rechenautomaten in den letzten Jahren wurde ein alter Traum, nämlich
die numerische Wettervorhersage, möglich gemacht. Es muss zu diesem
Zweck ein in sich konsistentes mathematisches Modell der Atmosphäre
aufgestellt werden, um kleine Störungen, wie Gravitationswellen, auszuschliessen,
die im allgemeinen Gleichungssystem auch enthalten, aber für die wirkliche
Entwicklung in der Atmosphäre unbedeutend sind. Alle Vorgänge,
die kleinräumiger sind als die Maschenweite des in der numerischen
Rechnung verwendeten Netzes (diese kann aus Gründen des Rechenaufwands
nicht beliebig herabgesetzt werden) und die trotzdem für die physikalische
Entwicklung Bedeutung haben, müssen durch sogenannte «Parametrisierung»
in das mathematische Modell eingearbeitet werden. Die Einführung dieser
Zusatzglieder wird um so wichtiger, auf je längeren Zeitraum eine
Vorhersage des künftigen Strömungszustandes versucht werden soll.
Die numerischen Methoden werden nicht nur zur direkten Vorhersage, sondern zur eigentlichen Forschung in Form der sogenannten «numerischen Simulation» der allgemeinen Zirkulation verwendet. Durch Integration über den Zeitraum von einem oder mehreren Jahren werden klimatologische Mittelwerte und ihre Schwankungsbreite erhalten. Durch Variation einzelner Parameter kann man die Resultate in immer bessere Übereinstimmung mit der Beobachtung bringen und so im «numerischen Laboratorium» die Bedeutung einzelner Vorgänge im äusserst komplexen System der allgemeinen Zirkulation gegeneinander abschätzen. Das grösste Hindernis für weiteren Fortschritt ist heute die zu geringe Beobachtungsdichte, vor allem in der freien Atmosphäre, die es nicht erlaubt, den Ausgangszustand für die numerische Vorhersage mit genügender Genauigkeit festzulegen. Es wird damit schwierig, Verbesserungen in den atmosphärischen Modellen zu testen, da sich nicht mehr entscheiden lässt, ob Unterschiede zwischen vorausberechneter und beobachteter Entwicklung auf Modell- oder Beobachtungs-Fehler zurückzuführen sind. Aus diesem Grund ist im World Weather Watch (WWW) eine grosszügige internationale Anstrengung geplant, die mit Hilfe von neuartigen Methoden, wie dem Einsatz horizontal fliegender Sondierungsballone und vor allem mit von Satelliten aus durchgeführten quantitativen Messungen, die Beobachtungsdichte zunächst wenigstens für eine Versuchsperiode auf einen genügenden Wert bringen soll. Zur optimalen Konzipierung dieses aufwendigen Versuchs und zur gleichzeitigen besseren Abklärung einer Reihe von Vorgängen, welche für die Parametrisierung von Bedeutung sind, wird WWW in den Rahmen einer allgemeinen Anstrengung auf dem Gebiet der Atmosphärenforschung des «General Atmospheric Research Programs» hineingestellt. Man hofft, auf dieser Grundlage die numerische Prognose auf einen Zeitraum von ungefähr drei Wochen ausdehnen zu können. |
||
| Frey-Wyssling,A. | Ueber die Ultrastruktur des Holzes. | 113,427AR |
| Der Feinbau der verholzten Zellwand
wurde auf Grund der Ultrastrukturforschung mit indirekten Methoden mit
armiertem Beton verglichen. In diesem Modell waren die zugfesten Stäbe
durch sublichtmikroskopische Zellulosefibrillen und der druckfeste Beton
durch das inkrustierte Lignin vertreten. Im Elektronenmikroskop konnten
dann diese vorausgesagten Strukturelemente abgebildet und auch die mit
Hilfe der Polarisationsmikroskopie und der Röntgendiffraktion aufgestellten
Texturen (Faser-, Ring- und Schraubentextur als Paralleltexturen, Röhren-
und Folientextur als Streuungstexturen) bestätigt werden. Es zeigte
sich ferner, dass die zuerst niedergelegten Primärwände im allgemeinen
Streuungstextur, die durch Apposition angelagerten dicken Sekundärwände
dagegen Paralleltexturen aufweisen.
Durch das Studium der Zellwandontogenie mit Hilfe des Elektronenmikroskopes fand man nicht nur in der Primärwand, sondern auch in den für die Holztechnologie so wichtigen Sekundärwänden eine Grundsubstanz, die als Zellwand-Matrix bezeichnet wird. Sie besteht aus Hemizellulosen und Pektinstoffen und kann später durch Inkrustation mit Lignin, Polyphenolen oder Mineralstoffen verändert werden. Die Entwicklung der Zellwand geschieht daher in drei Stufen: 1. Isotope Matrix: Hemizellulosen und Pektinstoffe. 2. Fibrilläre Gerüstsubstanz: Zellulose (bei Pilzen Chitin). 3. Interfibrilläre Inkrustierung: Lignin, Polyphenole, CaCO3, Si02. Für unsere Betrachtung sind die beiden ersten Stufen
wichtig. Die Matrix wird durch Einschleusen von Golgi-Bläschen in
die wachsende Wand gebildet (Nachweis des Intussuszeptionswachstums!).
Die Golgi-Bläschen enthalten Kohlehydrate, vermutlich in oligomerer
Form, die dann in der Zellwand zu den stark quellbaren Hemizellulosen polymerisieren.
Die Gerüstsubstanz wird dagegen von der Zelloberfläche aus aufgebaut.
Die Präparationsmethode der Gefrierätzung erlaubt, Partikel auf
der Oberfläche des Plasmalemmas abzubilden, die aus einem Glykoproteid
bestehen und sich aktiv an der Zellulose-Synthese beteiligen. Die Zellulose
entsteht in Form von kristallinen Elementarfibrillen mit 35 Å Durchmesser,
die daher nur 36 Zellulosemoleküle in ihrem Kettengitterstrang aufweisen.
|
||
| Akert,K. | Hirnforschung: Interneuronale Kontaktstellen (Synapsen) bei Wirbeltieren und Wirbellosen. | 113,428AR |
| 1. Der Begriff der Synapse wurde
1897 von Sherrington eingeführt und war lange Zeit harten Bewährungsproben
ausgesetzt. Er bezeichnet die Kontaktstellen zwischen Nervenzellen, an
denen die Erregung (Information) übertragen wird. Um die Jahrhundertwende
musste er gegen die Anhänger der Kontinuitätslehre durchgesetzt
werden. Langezeit standen nur elektrophysiologische Beobachtungen zur Verfügung,
die auf eine spezifische Kontaktstelle hinwiesen. Später entstand
ein Meinungsstreit über die Natur der Übertragung: ob primär
elektrisch oder primär chemisch. Pharmakologische Experimente entschieden
schließlich zu Gunsten der chemischen Hypothese, wobei aber hinzuzufügen
ist, daß in letzter Zeit auch Stellen mit elektrischer Übertragung
bekannt geworden sind.
2. Die Ultrastrukturforschung der Synapsen hat seit 1958 ebenfalls zur Abklärung dieser Probleme beigetragen. Klassische Synapsen zeichnen sich durch eine gewisse Ähnlichkeit mit Desmosomen aus, indem der Interzellulärspalt etwas verbreitert erscheint (200-300 Å) und die synaptischen Membranen gewisse Anlagerungen von elektronendichtem cytoplasmatischem Material aufweisen. Im Gegensatz zu den Desmosomen besteht aber eine deutliche Asymmetrie, welche gleichzeitig einen Hinweis auf die Polarität vermittelt. Die präsynaptische Region ist durch ihren Gehalt an kleinen Bläschen (300-800 Å) und einen relativen Reichtum an Mitochondrien ausgezeichnet, und ferner ist die Verdichtung der präsynaptischen Membran nicht platten-, sondern pfeilerförmig. Die Verdichtung der postsynaptischen Membran ist besonders stark ausgeprägt. 3. Über die Herkunft der präsynaptischen Bläschen sind die Meinungen geteilt; teilweise mögen sie vom Golgiapparat des Perikaryons abstammen. Gesichert erscheint dagegen die Tatsache, dass sie biogene Amine enthalten, welche entweder direkt als Transmittoren wirken oder indirekt den Vorgang der Erregungsübertragung beeinflussen. Vom Inhalt dieser Bläschen hängt es grösstenteils ab, ob eine Synapse exzitatorische oder inhibitorische Funktionen hat. Morphologisch lassen sich verschiedene Arten von Transmitterbläschen unterscheiden, und in letzter Zeit liefern auch histochemische und mikrochemische Untersuchungen präzisere Angaben über die molekulare Zusammensetzung ihres Inhalts. 4. Zum Schlusse wird auf die weitgehende Übereinstimmung der Synapsen bei Wirbeltieren und Wirbellosen (speziell bei Ameisen) hingewiesen. Ferner werden einige Sondertypen behandelt: die sog. Kammsynapsen mit Kugelgitter, die Sandwich- und die Glomeruli-Synapsen. Schliesslich wird die Struktur der elektrischen Synapsen einiger Invertebraten derjenigen der chemischen gegenübergestellt und mit sog. tight junctions in der Muskulatur verglichen. Auch die Rolle der Gliazellen im Synapsenbereich als mögliches Reservoir für den Elektrolyt-Austausch wird erwähnt. |
||
| Kellenberger,E. | Vererbung und Entstehung der Form eines Virus. | 113,429AR |
| Acht Gene sind schon bekannt,
deren Produkte notwendig sind, um stabile T4-Phagenköpfe zu bilden.
Das Gen 23 produziert ein Protein, das den Hauptanteil des Kapsids ausmacht.
(Kapsid ist die Proteinhülle, die die Nukleinsäure eines Virus
umschliesst.) Dasselbe Protein 23 kann aber auch in verschiedenen andern
Formen zusammengebaut werden, nämlich in die tubularen sog. «Polyköpfe»
und die 7-Partikel, die beide keine Nukleinsäure enthalten, wohl aber
einen Protein-« Core». Die nukleinsäurehaltigen Köpfe
sowohl als auch die 7-Partikel können in einer länglichen («prolaten»)
und einer isometrischen Variante gefunden werden. Für diese Formvariation
ist das Gen 66 verantwortlich. Mit genetischen Methoden kann man feststellen,
welche Genprodukte obligatorisch sind und die neben dem Produkt 23 noch
wirken müssen, um jedes dieser obengenannten aberranten Partikel zu
bilden. Wahrscheinlich sind 2 Genprodukte notwendig, um die tubuläre
Form zu bauen (P 23 und P 66). Zwei andere Gene sind verantwortlich für
den Einbau der Nukleinsäure in das Phagenpartikel. Ohne P 21 oder
P 24 werden die nukleinsäurefreien 7-Partikel gebildet. Diese sind
etwas kleiner als normale Phagen. Ein interessantes Gen ist Nr.31. Dessen
Produkt ist nämlich notwendig, um das P 23 löslich zu halten.
Ohne P 31 aggregiert sich P 23 in die sog. «lumps», die an
den ZeIlhüllen haften.
Die Wirkungsmechanismen dieser morphopoietischen (formgebenden) Genprodukte ist noch nicht aufgeklärt und steht im Mittelpunkt unserer Untersuchungen. Verschiedene Methoden werden angewendet und durch Teilresultate illustriert: 1. Die fertigen Partikel werden in die Untereinheiten abgebaut und diese Untereinheiten durch Elektrophorese charakterisiert. 2. Nach Phageninfektion werden nur Proteine gebildet auf Grund der Information der Phagen-Desoxyribonukleinsäure. Man kann daher alle diese Phagenproteine mit Isotopen markieren und wiederum durch Elektrophorese, kombiniert mit Radioautographie charakterisieren. Auf diese Art kann man eine elektrophoretische Bande mit dem Produkt eines bestimmten Genes identifizieren. Nachher kann festgestellt werden, welche Genprodukte in den Partikeln sich befinden, ob im Kapsid oder im Innern. Es bestehen nämlich Hinweise von der Elektronenmikroskopie, dass die Innenproteine, die den «Core» bilden, morphopoietische Information tragen. Die theoretischen Betrachtungen wurden durch Resultate der Elektronenmikroskopie und Elektrophorese begleitet. Weitere Einzelheiten im Scientific American 215, Heft 6, p. 32, Dez.1966 |
||
| Furrer,G. | Morphologische Beobachtungen in Spitzbergen. | 113,429AR |
| Die Stauferlandexpedition nach
Ostspitzbergen im Sommer 1967 wurde vom Rektor der Universität Würzburg,
Herrn Prof. Dr. J. Büdel, geleitet. Seit 1959 hat er sich dreimal
mit seinen Schülern im wenig bekannten östlichen Teil des Spitzbergenarchipels
geomorphologischen Arbeiten in der Frostschuttzone zugewandt, um in einem
eisfreien Raum der Arktis die landformenden Vorgänge zu studieren.
Solche Studien sind deshalb wichtig, weil sich während den Kaltzeiten
des Pleistozäns in ausgedehnten Gebieten der mittleren Breiten gleiche
oder ähnliche Vorgänge abspielten und grossen Anteil an der Reliefgestaltung
in Mitteleuropa hatten. So vermögen Untersuchungen der rezenten Frostschuttzone
unser Verständnis für die Genese vieler Formen der mitteleuropäischen
Landschaft zu fördern.
Spitzbergen gehört zum Königreich Norwegen. Seine Inseln im Osten sind aus flachlagerndem Mesozoikum aufgebaut, das allenthalben von Basalt durchschossen ist. Das grosse Reliefelement dieser zu etwa 45 o/o vergletscherten Inseln bilden präglazial-fluviatil angelegte und im Eiszeitalter glazial überprägte Trogtäler. Aber diese Täler sind in der Nacheiszeit kräftig überformt worden. Die Verbreitung von weit in die Täler hinein reichenden Strandspuren, insbesondere von Strandwällen, deutet auf kräftige isostatische Landhebung, die heute abgeschlossen zu sein scheint. In ganz Spitzbergen ergibt ein Vergleich der heutigen Eisausdehnung mit Schrägaufnahmen aus dem Jahre 1936 eine generelle Abnahme der Gletscherfläche. Spitzbergen gilt seit der Exkursion des internationalen Geologenkongresses im Jahre 1910 als das klassische Land der Strukturbodenforschung, doch sind diese Frostmusterformen seit gut 100 Jahren auch in unseren Alpen nachgewiesen. Sie liegen dort in der Frostschuttstufe und entsprechen in ihrem Aufbau den arktischen Vertretern. Allerdings bieten sich im Hochgebirge - im Gegensatz zur Arktis - der Strukturbodenbildung nur selten weit ausgedehnte horizontale oder nur schwach geneigte Flächen an. Dieser Umstand ist wohl mitverantwortlich, dass die arktischen Strukturböden weit besser bekannt sind als die alpinen. Einregelungsmessungen der Längsachsen der Steine von Strukturbodenformen zeigen, dass in den Alpen wie in der Arktis die Steine bei Steinringen in erster Linie tangential, bei Steinstreifen in der Fallinie angeordnet sind. In zweiter Linie ordnen sich die Steine senkrecht dazu an, d.h. radial bei Steinringen, bzw. isohypsentreu bei Steinstreifen. Mit dieser an rezenten Strukturbodenformen gewonnenen Regel liessen sich bisher mit Erfolg im nördlichen schweizerischen Mittelland an 3 Stellen fossile, kaltzeitliche Strukturböden nachweisen. Derartige Kaltzeitrelikte liegen bei uns unter der Vegetation oder einer Kulturschicht, können aber mit Hilfe der Einregelungsmessung (Situmetrie) in Aufschlüssen (Wände von Schottergruben) aufgefunden werden. Solche fossilen Strukturbodenformen, vergesellschaftet mit fossilen Eiskeilen, erlauben beispielsweise im Rafzerfeld die Annahme eines Dauerfrostbodens, vorläufig zumindest während des Würmhochglazials. |
||
| Weibel,M. | Die Zerrkluftmineralien der Schweizer Alpen. | 113,430AR |
| Zerrklüfte sind abgeflachte,
linsenförmige Hohlräume im kompakten Gestein, die sich am Ende
der alpinen Hauptfaltungs- und Metamorphosephase ausbildeten. Neue geochronologische
Messungen weisen auf ein Alter von 10-20 Millionen Jahren. Häufungsgebiete
alpiner Zerrklüfte finden sich im mittleren Aarmassiv, im Gotthardmassiv,
im Binnatal, oberen Tessin und Domleschg (Schyn, Feldis). Die Zerrklüfte
sind manchmal mit hervorragend auskristallisierten Mineralien besetzt,
unter denen Quarz an der Spitze steht. Die Mineralbildung ist hydrothermal,
bei Temperaturen von 200-300° erfolgt, doch fand keine Stoffzufuhr
aus der Tiefe statt, sondern lediglich eine Auslaugung des Nebengesteins.
Dementsprechend sind auch die Mineralgesellschaften von ganz typischer,
eher eintöniger Art, wobei Schwefel-, Arsen-, Antimon- und Wismutverbindungen
weitgehend fehlen.
Die alpinen Zerrklüfte sind als Lieferanten hervorragend kristallisierter Mineralstufen weltberühmt. In andern Gebirgen der Erde sind derartige Bildungen eine weniger häufige Erscheinung. Die regionale Verteilung der Klüfte über die Alpen folgt nicht den Grenzen tektonischer Einheiten. Dafür geben chemische Feinheiten im Bau der beiden häufigsten Kluftmineralien Quarz SiO2 und Adular (K. Na) AlSi2Os ein Abbild der alpinen Gesteinsmetamorphose. Beim Quarz ist es der sehr geringe Wasserstoffgehalt (wenige H-Atome auf 1 Million Si-Atome), beim Adular der Natriumgehalt (0,3-1,5% Na2O), welche beide gegen die hochmetamorphe Tessiner Kulmination zwischen mittlerem Verzascatal und unterem Meratal ansteigen. |
||
| Burri,C. & Soptrajanova,G. | Petrochemie der jungen Vulkanite der Inselgruppe von Milos (Griechenland) und deren Stellung im Rahmen der Kykladenprovinz. | 112,1-27, (1) |
| Die 1923 durch R. A. Sonder gesammelten
und 1924 von ihm beschriebenen jungen Vulkanite der Inselgruppe von Milos
(Ägäisches Meer) wurden einer Revision unterzogen, wobei 26 neue
chemische Analysen angefertigt wurden. Die MilosGesteine bilden eine homogene
Serie von extrem pazifischem Typus, welche sich zwanglos in die «Kykladenprovinz»
einordnet, die sich vom Saronischen Golf bis nach Santorin erstreckt. Milos
nimmt daher innerhalb derselben keine Sonderstellung ein, wie dies bisher
angenommen wurde. In den andesitischen, dazitischen, wie auch liparitischen
Gesteinen von Milos ist deutlich ersichtlich, dass nur ein Teil der Plagioklaseinsprenglinge
mit der Grundmasse in Gleichgewicht steht. Diese sind gut idiomorph, während
andere, etwas basischere, oft in engster Nachbarschaft zu den erstem, starke
Anschmelzungs- und Resorptionserscheinungen zeigen. Sie müssen daher
anderwärts auskristallisiert und zugewandert sein.
Summary
|
||
| Benz,G. | Untersuchungen über den Nucleinsäurestoffwechsel gesunder und virusinfizierter Larven der Fichtenblattwespe Diprion hercyniae (Hartig). | 112,29-70, (1) |
| Mit Hilfe autoradiographischer,
biochemischer und histochemischer Methoden wurde der Nucleinsäurestoffwechsel
gesunder und virusinfizierter Larven von Diprion hercyniae studiert. Da
sich das Kernpolyedervirus dieser Art nur in den Kernen des Mitteldarmepithels
entwickelt, wurden in erster Linie die Mitteldärme untersucht. Die
radioaktive Markierung erfolgte mit tritiumiertem Thymidin (- TT). Nucleinsäuren
wurden nach der Methode von Ogur und Rosen zu verschiedenen Zeiten nach
der Virusinfektion aus Mitteldärmen extrahiert und durch Messung der
Extinction bei 260 und 280 nm quantitativ bestimmt. Die Untersuchungen
ergaben folgende
Resultate: 1. TT wird nur in die Zellkerne und nur in die DNS eingebaut. 2. Im 4.-5. Larvenstadium wird TT nur in die Zellkerne des Mitteldarmepithels in nennenswerter Menge eingebaut. Einen sehr geringen TT-Einbau finden wir auch in einzelnen Kernen der malpighischen Gefässe der Tracheenmatrix und der Seidendrüsen. Wir schliessen daraus, dass in den untersuchten Larvenstadien nur die Mitteldarm-Epithelzellen einen relativ hohen DNS-Metabolismus aufweisen. 3. Injiziertes TT wird zum grössten Teil während der ersten 48 Stunden nach der Injektion mit den Exkrementen ausgeschieden; 95 % davon bereits in den ersten 24 Stunden. 4. Die TT-Einbaurate der Mitteldarmzellen steigt nach der Virusinfektion an und erreicht bald doppelt normale Werte. Sie sinkt hierauf etwas ab, nimmt dann wieder gewaltig zu, um schliesslich, gegen das Ende der Krankheit, wieder rasch abzunehmen. Diese Sequenz wurde sowohl autoradiographisch, wie durch Bestimmung der spezifischen Radioaktivität extrahierter DNS ermittelt. Die Ergebnisse führen zum Schluss, dass in infizierten Mitteldärmen DNS in zwei Schüben synthetisiert wird. 5. TT wird anfänglich gleichmässig verteilt im Kernchromatin eingebaut. Nach Ausbildung des virogenen Stromas wird vor allem dort TT inkorportiert. 6. Kurz nach der Infektion nimmt die Konzentration der RNS zu, sinkt aber bald wieder auf normale bis subnormale Werte ab. 7. Gegenüber der RNS-Zunahme verzögert, steigt auch die DNS-Konzentration der infizierten Mitteldärme an. Sie erreicht relativ rasch ein Maximum und nimmt dann wieder ab. Etwas später kann sie wieder zunehmen (in zwei von drei Fällen). 8. Während der DNS-Abnahme wird einerseits Kernchromatin abgebaut; anderseits bilden sich in den Därmen feulgennegative virogene Stromata. 9. Während des zweiten DNS-Syntheseschubes werden die virogenen Stromata stark feulgenpositiv. Die TT-Einbauraten sind zu dieser Zeit ausserordentlich hoch. Leider differieren die autoradiographisch bestimmten Werte der TT-Einbauraten quantitativ von den an DNS-Extrakten bestimmten Werten. Letztere steigen nach dem ersten DNS-Syntheseschub sprunghaft in die Höhe und sind von da an dauernd rund sechsmal grösser als die entsprechenden Autoradiographiewerte. Die Differenz der beiden Methoden konnte nicht befriedigend erklärt werden, doch wird angenommen, dass die bei der Extraktionsmethode festgestellte, sprunghaffe Änderung der TT-Einbaurate, eine Änderung des DNS-Synthesemechanismus anzeige. Es besteht die Möglichkeit, dass während des zweiten DNS-Syntheseschubes nicht nur Virus-DNS, sondern zusätzlich noch eine thymidinreiche «metabolische» DNS synthetisiert wird. 10. Die 0,2 n Perchlorsäurefraktionen (nur ein Experiment) weisen im Verlaufe der Virose meist annähernd konstante Extinktionswerte bei 260 nm auf, ausgenommen zur Zeit des beginnenden Chromatinabbaues und der Bildung der virogenen Stromata, sowie zu Beginn der Polyederportein-Synthese. 11. TT kann direkt in die Viruspartikeln eingebaut werden. In dieser Beziehung ist das Virus offenbar nicht grundsätzlich auf die Wirts-DNS angewiesen. 12. Die Resultate werden wie folgt interpretiert: Durch die Infektion wird, eventuell als Abwehrreaktion der Zelle, die Synthese von Kern-DNS stimuliert (Chromosomenvermehrung mit Kernvergrösserung). Dadurch werden die zur Virusreplikation notwendigen Enzyme erzeugt. Nach kurzer Anlaufzeit interferiert das Virus mit der Chromatinsynthese. Obwohl das Virus nicht grundsätzlich von den Bausteinen der Wirts-DNS abhängig ist, wird der Abbau der WirtsDNS eingeleitet. Gleichzeitig beginnt in den virogenen Stromata die Synthese von Virus-DNS in grösserem Massstab. Kurz nachdem die Wirts-DNS vollständig abgebaut ist, hört auch die Synthese von Virus-DNS auf. Summary
|
||
| Waldmeier,M. | Die Sonnenaktivität im Jahre 1966. | 112,71-90, (1) |
| The present paper gives the frequency
numbers of sunspots, photospheric faculae and prominences as well as the
intensity of the coronal line 5303 Å and of the solar radio emission
at the wavelength of 10.7 cm, all characterizing the solar activity in
the year 1966.
Die vorliegende Veröffentlichung gibt die die Sonnenaktivität charakterisierenden Häufigkeitszahlen der Sonnenflecken, der photosphärischen Fackeln, der Protuberanzen, die Intensität der Koronalinie 5303 Å und diejenige der solaren radiofrequenten Strahlung auf der Wellenlänge 10,7cm. Mean daily sunspot relative-number Mittlere tägliche Sonnenflecken-Relativzahl 47,0 (15,1) Lowest sunspot relative-number Niedrigste Sonnenflecken-Relativzahl 0 (0) Highest sunspot relative-number Höchste Sonnenflecken-Relativzahl 130 (75) Mean daily group number Mittlere tägliche Gruppenzahl 3,8 (1,3) Total number of the northern spot-groups Gesamtzahl der nördlichen Fleckengruppen 271 (107) Total number of the southern spot-groups Gesamtzahl der südlichen Fleckengruppen 57 (27) Mean equatorial distance of the northern sunspots Mittlerer Äquatorabstand der nördlichen Flecken 22,0° (25,6°) Mean equatorial distance of the southern sunspots Mittlerer Äquatorabstand der südlichen Flecken 21,9° (26,3° Surface covered by fields of faculae on the N-hemisphere Bedeckung der N-Halbkugel durch Fackelfelder 5,3 % (2,3 0%) Surface covered by fields of faculae on the S-hemisphere Bedeckung der S-Halbkugel durch Fackelfelder 0,8% (0,4 %) Mean equatorial distance of the northern faculae Mittlerer Äquatorabstand der nördlichen Fackeln 24,2° (26,9°) Mean equatorial distance of the southern faculae Mittlerer Äquatorabstand der südlichen Fackeln 23,0° (27,0°) Mean daily profile-surface of prominences Mittlere tägliche Protuberanzenprofilfläche 3464 (2615) Mean daily value of the total emission of the coronal line 5303 Å Mitt. täg. Gesamtem. der Koronalinie 5303 Å 358,2 (150,8) Mean daily value of the radio emission at the wavelength of 10.7 cm Mittlere tägliche Radioe. auf Wellenlänge 10,7 cm 102,3 (76,0) The values put in brackets are concerning the year 1965. Die in Klammern gesetzten Werte beziehen sich auf das Jahr 1965. The tables 1, 3 and 14 give the daily values of the relative-numbers, of the group-numbers and of the radio emission, the tables 4,6, 8, 10 and 11 contain the distribution in latitude of the spots, faculae, prominences and of the coronal intensity. Fig. 1 and 3 show the course of the relative-numbers and of the radio emission, and by fig. 2 the distribution in latitude of the spots, faculae, prominences and of the coronal intensity is demonstrated. Tabellen 1, 3 und 14 enthalten die Tageswerte der Relativzahlen, der Gruppenzahlen und der Radioemission, die Tabellen 4, 6, 8, 10 und 11 die Breitenverteilung der Flecken, Fackeln, Protuberanzen und der Koronahelligkeit. In Abb. 1 und 3 ist der Verlauf der Relativzahlen und der Radioemission dargestellt, in Abb. 2 die Breitenverteilung der Flecken, Fackeln, Protuberanzen und der Koronahelligkeit. |
||
| Hantke,R. und Mitarbeitern | Geologische Karte des Kantons Zürich und seiner Nachbargebiete. | 112,91-122, (2) |
| kein Abstract
geologische Karte im Masstab 1:50000 Ausschnitt CH1903: 657500/206000 bis 717500/286000 , aufgeteilt auf zwei Blätter 4-Farbendruck vom Art. Institut Orell Füssli AG, Zürich |
||
| Higham,C.F.W. | A consideration of the earliest neolithic culture in Switzerland. | 112,123-136,(3) |
| kein Abstract | ||
| Schär,M. | Neuere Gesichtspunkte in der Epidemiologie. | 112,137-142 |
| Die Epidemiologie, ursprünglich
auf das Studium der Ausbreitung übertragbarer Krankheiten beschränkt,
wird heute als Lehre und Wissenschaft betrachtet, die sich mit der Häufigkeit
und den Ursachen von Gesundheitsstörungen in einer Bevölkerung
befasst.
Zur Ermittlung von Krankheitsursachen, besonders bei den polyätiologisch bedingten chronischen Krankheiten, dienen retrospektive und prospektive Untersuchungen. Den statistischen Verfahren bei der Planung und Auswertung von Erhebungen kommt immer grössere Bedeutung zu. Bei Langzeitbeobachtungen von Test- und Kontrollgruppen muss besonders den Ausfällen und dem Gruppenwechsel Rechnung getragen werden. Anhand eines Beispieles wird gezeigt, wie die Gruppengrösse einer longitudinalen Studie berechnet werden kann. Behandelt werden Typhus 1872 in Lausen BL, Jodmangel-Kropf, Herzkrankheiten/Bewegung |
||
| Hurter,J. | Untersuchungen über das resistente Verhalten der Gramineen Coix lacrymajobi und Imperata cylindrica gegenüber dem herbiziden Wirkstoff Simazin. | 112,143-172 |
| 3.5. Schlussfolgerung
Die gefundenen Resultate zeigen, wie die Pflanzen über Möglichkeiten verfügen, phytozide Substanzen unwirksam zu machen. Die systematische Untersuchung solcher Erscheinungen könnte einerseits einen Weg öffnen, der zu weiteren selektiven Pestiziden führt, anderseits aber auch zu Verbindungen, die anfänglich resistente Organismen zu beeinträchtigen vermögen. 4. Zusammenfassung
|
||
| Bauer,Heinz | Ultrastruktur und Zellwandbildung von Acanthamoeba sp. | 112,173-197, (3) |
| Mit verschiedenen Methoden der
Elektronenmikroskopie wurde die Ultrastruktur, insbesondere die Zellwandbildung
von Acanthamoeba sp. untersucht. Zur Feinstruktur der Zellorganelle seien
folgende Punkte rekapituliert:
1. Im nackten Zustand liegt die Amöbe als teilungsfähiger, nach aussen lediglich durch das Plasmalemma begrenzter Protoplast vor. 2. Die Mitochondrien gehören dem tubulären Typus an und zeigen off Einschlüsse von anorganischem Material. 3. Relativ grosse Vakuolen mit Inhaltsstoffen können sowohl im Dünnschnitt, wie auch mit Hilfe der Gefrierätzung nachgewiesen werden. Ebenfalls gelingt es, in diesen Vakuolen saure Phosphatase zu lokalisieren. 4. Ein eigentlicher Golgi-Apparat fehlt der Amöbe; dafür kann ausgehend von konzentrischen Lamellen des nur kurz vor der Encystierung stark aktiven ER eine Bläschengenese mit resultierendem Vesikelfeld (Art Golgi-Apparat) und meist zentral orientierter Vakuole beobachtet werden. 5. Mit Glutaraldehyd-Fixierung lassen sich im Cytoplasma bis zu einem µ dicke Bündel von durchschnittlich 50 Å messenden kontraktilen Filamenten abbilden. Die Bildung der Cystenwand lässt sich in folgende Schritte unterteilen: a) Bei zur Encystierung angeregten Amöben stellt man im Cytoplasma, dicht unterhalb des Plasmalemmas und parallel zu diesem, Membranstapel des dicht mit Ribosomen besetzten Endoplasmatischen Retikulums fest. Die daraus resultierende erhöhte Proteinsynthese wird durch autoradiographische Befunde gestützt. Zudem ist eine Verlagerung der im Mittel 600-1000 Å messenden Vesikel in die Region innerhalb des Plasmalemmas zu erkennen. b) Die Plasmamembran ist zu Beginn der Encystierung dicht mit 90-120 Å messenden Partikeln besetzt. Ausserhalb des Plasmalemmas lässt sich eine Lamellierung feststellen. c) Die Lamellen zerfallen wieder und es kommt zur Bildung der körnigen «Cuticularschicht » der entstehenden Cystenwand. d) Die Vesikel durchdringen das Plasmalemma und schütten ihr matrixbildendes Material in den Raum zwischen Plasmamembran und « Cuticularschicht ». e) Mit Hilfe der Autoradiographie kann in der Primärwand hydroxyprolinreiches Protein (« Extensin») nachgewiesen werden. f) Die globulären Plasmalemmapartikel lösen sich von der Zellmembran, wandern in die sich verfestigende Matrix und bilden dort ein dichtes Partikelfeld. Erst jetzt werden die ersten Cellulosefibrillen synthetisiert. Es kann eine direkte Verbindung der Partikel mit den entstehenden Fibrillen beobachtet werden. Die Partikel stellen wahrscheinlich Protein-Polysaccharid-Komplexe dar. g) Die Streuungstextur der Cellulosefibrillen bleibt auch bei vollständig encystierten Amöben erhalten. Eine Trennung in Primär- und Sekundärwand kann nicht mehr beobachtet werden. Das Plasmalemma ist nach Abschluss der Zellwandsynthese nahezu partikelfrei. |
||
| Lemans, A. | Der Firnzuwachs pro 1965/66 in einigen schweizerischen Firngebieten, 53. Bericht | 112,199-208, (3) |
| Mit Ausnahme des Tessins und der südlichen Ketten Graubündens erhielt das ganze Alpengebiet im Winter 1965/66 weit überdurchschnittliche Niederschläge. Die mittlere Temperatur war während des hydrologischen Jahres 1965/66 und auch während der Periode Mai-September 1966 leicht übernormal. Dagegen war der eigentliche Hochsommer 1966 (Juli und August) in den Alpen der Zentral- und Ostschweiz sowie in Graubünden sehr kühl, unbeständig und arm an Sonnenschein. Als Folge dieser Wetterverhältnisse ergab sich in den Fimregionen der nördlichen Alpenketten (Berner, Urner und Glarner Alpen) ein überdurchschnittlicher Firnzuwachs, der dem letztjährigen nicht nachsteht. | ||
| Markgraf,F. & Endress,P. | Die Keimpflanze von Berardia. | 112,209-222, (4) |
| Der Bau der Keimpflanze von Berardia
(Compositae) wird morphologisch und anatomisch beschrieben. Sie ist synkotyl.
Die ersten Laubblätter müssen durch die Basis der mehrere cm
langen Keimblattscheide durchbrechen und treten neben den langlebigen Keimblättern
über die Bodenoberfläche hervor. Lückenbildungen im Gewebe
zwischen den Keimblattleitbündeln begünstigen das Auseinanderweichen
der Scheide unmittelbar über dem sich verdickenden Hypokotyl.
Dieser Keimungstyp vor allem von einigen Ranunculaceen und Umbelliferen beschrieben war bis anhin bei den Kompositen nicht bekannt. Summary
|
||
| Hantke,R. | Die würmeiszeitliche Vergletscherung im oberen Toggenburg (Kt.St.Gallen). | 112,223-242, (4) |
| Im oberen Toggenburg können
mehrere würmeiszeitliche Gletscherstände unterschieden werden.
Der höchste Eisstand, bei dem die Oberfläche des über den
Sattel von Wildhaus ins Thurtal eingedrungenen Rheingletschers in 1460-1480
m lag, wird bekundet durch eine seitliche Schmelzwasserrinne, durch Rheinerratiker,
einen Endmoränenwall im Paralleltal des Gräppelensees sowie durch
rundhöckerartige Eisüberprägungen an der abtauchenden nördlichen
Säntiskette E von Stein. Auf Grund ganz sporadisch auftretender, noch
höher gelegener Erratiker und Eisschliffe sowie talauswärts sich
einstellender Relikte von sicher würmeiszeitlichen Seitenmoränen,
ist dieser dem Würm-Maximum zuzuordnen. Nachdem der Thur/Rheingletscher
aus dem Luterental bei Nesslau noch einen kräftigen Eiszuschuss erhielt,
floss er unterbalb Krummenau zwischen Gössigenhöchi und Köbelisberg
über die Sättel der Wasserfluh und von Oberhelfenschwil ins Neckertal
über.
Ein nächst tieferer, jüngerer Eisstand, um Wildhaus durch Anhäufung von Erratikern und undeutliche Mittelmoränenreste in 1350 m gekennzeichnet, tritt unterhalb des Thur-Durchbruches von Starkenbach/Stein durch randliche Schmelzwasserrinnen und seitliche Wallmoränenstücke immer klarer in Erscheinung. Er entspricht dem Bazenheider (-- Zürich-) Stadium, das sich im Toggenburg S von Wil durch mehrere, stellenweise prachtvoll ausgebildete Staffeln auszeichnet. Als der Thurgletscher ein letztesmal vom überfliessenden Rheingletscher unterstützt wurde, was sich in den tiefen Moränenwällen von Schönenboden-Wildhaus zu erkennen gibt, reichte das Eis thurabwärts noch bis wenig oberhalb Nesslau. Diese Randlange ist auf Grund des Eisschwundes mit dem Konstanzer (= Hurden-) Stadium des Rheingletschers zu verbinden. Aus den quartärgeologischen Untersuchungen geht ferner hervor, dass die heutige Durchtalung in der Ostschweiz weitgehend auf das Einspielen von Gleichgewichtslagen in den Gletschersystemen zurückzuführen ist. Nach dem Konstanzer Stadium war die Talbildung im wesentlichen abgeschlossen und es wurden nur noch Kleinformen modelliert. Im Spätglazial stiessen die verschiedenen Churfirstengletscher nochmals bis nahezu in die Talsohle vor, während der Säntisthurgletscher oberhalb der Thurschlucht mit einer deutlichen Stimmoräne endete. Andererseits führten die damals noch kaum bewaldeten Talflanken zu einer raschen Aufschüttung der grossen, von flachgründigen Seen erfüllten Sohlen, etwa im Thurtal und im St. Galler Rheintal, so dass dort die Gletscher-Endlagen von jüngeren Alluvionen nahezu vollständig eingedeckt wurden und sich nur an ganz bestimmten, vor Einschotterung geschützten seitlichen Bereichen noch zu erkennen geben. Abstract
|
||
| Berichte | Die öffentlichen naturhistorischen Sammlungen und die medizinhistorische Sammlung beider Hochschulen in Zürich im Jahre 1966 | 112,243-263, (4) |
| Botanischer Garten und Bot. Museum
der Universität Zürich: F.Markgraf
(Pilzkontrolle 1966 Markt 22.5 t, im Inst. 1.5 t, Details s. Berichte an Kanton und Stadt) Zoologisches Museum der Universität Zürich: V. Ziswiler mineralogisch-petrographische Sammlung: E. Eberhard geologische Sammlung: R. Hantke Paläontologisches Inst. und Museum der Universität Zürich: E. Kuhn-Schnyder (Devon-Seelilien + Askeptosaurus italicus vom Mt.S.Giorgio) Sammlung für Völkerkunde der Universität Zürich: K.H. Henking medizinhistorische Sammlung der Universität Zürich: E.H. Ackerknecht |
||
| Leibundgut, H. | 22. Jahresbericht der Naturschutzkommission der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich für das Jahr 1966 | 112,264, (4) |
| Die meisten der an die Naturschutzkommission
gerichteten Anfragen und Anregungen betrafen nicht wissenschaftliche Naturschutzprobleme
und wurden deshalb entweder an den Naturschutzbund oder an den Beauftragten
für Natur- und Heimatschutz des Kantons Zürich weitergeleitet.
Zahlreiche Besprechungen mit Behörden und Einzelpersonen verlangten dagegen die Probleme, welche Naturschutzobjekte von nationaler Bedeutung betreffen, namentlich das Gebiet AlbisketteReppischtal und das Neeracher Riet. Die Kommission setzt sich wie folgt zusammen: Prof. Dr. H. Leibundgut (Präsident) Dr. H. Graber Prof. Dr. E. Landolt Prof. Dr. K. Suter Prof. Dr. E. A. Thomas |
||
| Hardmeier,W. | Gedanken zur Geschichte der Naturwissenschaften. | 112,265-280 |
| Wanner,H. | Marthe Ernst-Schwarzenbach (l900-l967). | 112,281-282 |
| Glatthaar,E. | Wirkung und Nebenwirkungen der oralen Antikonzeptiva. | 112,283AR |
| Das Thema der hormonalen Schwangerschaftsverhütung
durch oral anwendbare Mittel (sog. Ovulationshemmer) war bereits Gegenstand
eingehender öffentlicher Diskussion. Um die Wirkungsweise dieser Hormonpräparate
zu verstehen, sind gewisse Kenntnisse über die Physiologie der Empfängnis
und die hormonale Steuerung des weiblichen Zyklus erforderlich. Die wichtigsten
Tatsachen über diese Vorgänge werden anhand von Schemata kurz
rekapituliert.
Das Prinzip der Ovulationshemmung bildet nur eine der vier Möglichkeiten der medizinischen Empfängnisverhütung; da auch die hormonale Antikonzeption noch keine ideale und allgemein anwendbare Lösung darstellt, bleiben auch die drei anderen Möglichkeiten (Verhinderung des Eintritts der Samenzellen in die Scheide, Verhinderung der Spermienaszension, Verhinderung der Einidation im Uterus) weiterhin aktuell. Das Prinzip der Ovulationshemmung durch kombinierte Anwendung der beiden weiblichen Sexualhormone (Östrogene und Progesteron) ist schon seit über 30 Jahren bekannt. Das Progesteron war aber peroral nur in sehr hohen Dosen wirksam. Erst mit der Entdeckung von peroral und in kleinen Dosen hochwirksamen Derivaten mit progesteronähnlicher Wirkung (Progestine oder Progestagene) vor etwa 15 Jahren wurde eine Anwendung in grossem Umfang medizinisch und wirtschaftlich möglich. Der antikonzeptionelle Effekt der kombinierten Östrogen-Progestinpräparate beruht nicht nur auf einer Hemmung der Ovulation, sondern auch auf gewissen Veränderungen an der Uterusschleimhaut und am Schleimpfropf im Gebärmutterhais, wodurch die Einbettung eines allfällig befruchteten Eies bzw. die Einwanderung der Spermien verhindert oder mindestens erschwert würden. Die hormonale Antikonzeption ist heute das sicherste Verfahren (nahezu 100% bei korrekter Anwendung); um so mehr ist es zu bedauern, dass es in praxi längst nicht allgemein anwendbar ist. Die Hindernisse liegen neben psychologischen Faktoren (Abneigung gegen Medikamente, konfessionelle Bedenken) vor allem in den unerwünschten Nebenwirkungen, die allen z. Z. erhältlichen Präparaten anhaften. Es sind dies schwangerschaftsähnliche Beschwerden (Übelkeit, Spannen der Brüste, Gewichtszunahme usw.), Blutungsanomalien (Zwischenblutungen bzw. sekundäre Amenorrhoe) und psychische Auswirkungen (depressive Verstimmungen, Störungen der sexuellen Erlebnisfähigkeit). Es wird geschätzt, dass nur etwa ein Drittel aller Frauen, welche die hormonale Antikonzeption überhaupt anzuwenden versuchen, diese Methode über längere Zeit durchführen können. Andererseits ist auch hervorzuheben, dass diese kombinierten Hormonpräparate nicht nur als Empfängnisverhütungsmittel, sondern auch als Medikament zur Behandlung der verschiedensten hormonalen Störungen in grossem Umfang verwendet werden. Sie haben gerade durch ihre leichte Anwendbarkeit und Wirtschaftlichkeit die ganze Hormontherapie auf eine neue Basis gestellt und neue Behandlungsmöglichkeiten eröffnet. Für die Antikonzeption bilden die Ovulationshemmer trotz ihrer hohen Sicherheit heute noch keine ideale Lösung, da ihre Verträglichkeit und damit Anwendbarkeit durch Nebenerscheinungen erheblich beeinträchtigt ist. Die pharmazeutische Forschung steht hier noch vor grossen Aufgaben, deren Bewältigung im Hinblick auf die rasch zunehmende Weltbevölkerung zu einer Existenzfrage der Menschheit werden kann. |
||
| Kuhn,E. | Die Saurier aus der Trias des Monte San Giorgio. | 112,284AR |
| Fortschritte in der Paläontologie
setzen, neben der Verbesserung der Präparations- und Untersuchungsmethoden,
ein grosses, zeitlich geordnetes Untersuchungsmaterial voraus. Ein solches
Material lässt sich nur durch systematische Grabungen gewinnen. Lagerstätten
fossiler Wirbeltiere sind jedoch selten. Denn im normalen Kreislauf der
Natur wird der Leichnam eines Tieres in anorganische Bestandteile zerlegt,
damit diese zum Aufbau neuen Lebens dienen können. Eine der reichsten
gegenwärtig bekannten Lagerstätten fossiler Wirbeltiere des Erdmittelalters
befindet sich am Monte San Giorgio im Kanton Tessin. Es ist das Verdienst
von BERNHARD PEYER 1924 klar erkannt zu haben, dass dort durch flächenhafte
Grabungen in der Grenzbitumenzone der mittleren Trias wertvollstes Untersuchungsmaterial
für die Wirbeltierpaläontologie geborgen werden kann. Seither
ist die Erschliessung der Triasfauna der Tessiner Kalkalpen zu einer der
Hauptaufgaben der Zürcher Paläontologen geworden.
Da am Monte San Giorgio Ablagerungen eines Scheifmeeres erhalten sind, dominieren in ihnen die Überreste von Reptilien, welche eine aquatische oder amphibische Lebensweise besassen. An diese Küste wurden die Leichen primitiver Fischsaurier (Ichthyosaurier) verschlagen. Reich waren die Sauropterygier vertreten, die ihre kraftvollen Gliedmassen als Ruder benützten. Zu ihnen gesellten sich die Placodontier, deren Gebiss mit stumpfen Zähnen bewehrt war, mit denen sie hartschalige Beute zerquetschten. Eine amphibische Lebensweise führten die langhalsigen Gestalten der Gattungen Macrocnemus und Tanystropheus. Ein gewandter Schwimmer war ferner Askeptosaurus. Der einzige bisher entdeckte ausgesprochen terrestrische Saurier ist Ticinosuchus. Anfänglich dienten eine Reihe erfolgreicher Grabungen in erster Linie der Beschaffung von gut erhaltenen Resten von Fischen und Sauriern. Für eine Rekonstruktion der Änderungen des Lebensbildes des Gebietes im Bereiche der Südalpen zur Triaszeit waren jedoch die dabei gemachten Beobachtungen zu ungenau und zu lückenhaft. Deshalb wurde 1950, anfänglich in Zusammenarbeit mit dem Geolog.-Paläontolog. Institut der Universität Basel, die noch laufende Grabung in der Grenzbitumenzone der mittleren Trias auf Punkt 902 am Monte San Giorgio in Angriff genommen. Neben einer statistischen Ermittlung des Vorkommens der Fossilien in jeder Schicht sowie der Sammlung biostratinomischer Daten im Gelände, wird Untersuchungsmaterial für den Paläontologen, Stratigraphen, Petrographen und Geochemiker bereitgestellt. Während die früheren Grabungen mit Hilfe der Georges und Antome Claraz-Schenkung durchgeführt werden konnten, stehen uns seit 1954 Mittel des Schweizerischen Nationalfonds zur Verfügung. Lithologisch besteht die Grenzbitumenzone aus dünnen bis mittelstarken feinkörnigen Dolomiten mit variablem Bitumengehalt. Sie alternieren mit schiefrigen Sapropeliten, einem ehemaligen Faulschlamm, mit einem Gehalt von 22-57 % organischer Substanz. Entgegen früherer Behauptungen kommen Wirbeltiere sowohl in den Bitumina als auch in den Dolomiten vor. Die bisherigen Erfahrungen sprechen für ein völlig ruhiges Wasser über dem Meeresgrund, dem jegliches höhere Leben fehlte. Über dieser lebensfeindlichen Zone erstreckte sich eine Wasserschicht, in der ein normales Leben durchaus möglich war. Die Leichen gelangten meist als Ganzes in das anaerobe Milieu. Die Bildung von Fäulnisgasen war so gering, dass es zu keinem Auftreiben der Tierkörper kam. Solche lebensfeindliche Bezirke grösserer Ausdehnung können nicht in Strandnähe oder im periodischen Auftauchbereich der Küste vorkommen. Nach den Schichtbildungen zu urteilen sind die Sedimente der Grenzbitumenzone in einer Tiefe von mehr als 70 m abgelagert worden. Die im Felde geborgenen Wirbeltierreste sind in den wenigsten Fällen für die wissenschaftliche Untersuchung geeignet. Sie verlangen eine fachmännische Präparation. Die Präparation von Wirbeltierfossilien ist in den letzten Jahrzehnten zu einer hohen Kunst entwickelt worden. Oft ist die mechanische Entfernung des Sedimentes mittels Meisseln oder zugeschliffenen Nadeln unter Verwendung eines Binokulars immer noch die einzige Arbeitsmöglichkeit. Bei karbonatischen Sedimenten hat sich die Anwendung schwacher Säuren bewährt. In jüngster Zeit haben wir einen überraschenden Erfolg mit Sandstrahlen. Eine wesentliche Hilfe für die Präparation und für die Untersuchung bilden Röntgenaufnahmen, die wir im Röntgeninstitut des Zürcher Kantonsspitales anfertigen lassen dürfen. Dafür sind wir Prof. Dr. H. R. Schinz sel. und Prof. Dr. J. Wellauer herzlichen Dank schuldig. Abschliessend wurde die wissenschaftliche Auswertung der Tessiner Saurier an zwei Beispielen gezeigt. 1. Ticinosuchus Jerox Krebs ist bisher der einzige, ausgesprochen terrestrische Vertreter unter den Sauriern vom Monte San Giorgio. Es ist ein Angehöriger der Pseudosuchier, der Wurzelgruppe der grossen Unterklasse der Archosaurier. Ticinosuchus und seine nächsten Verwandten aus der Trias von Brasilien sind die Urheber der schon sehr lange bekannten Chirotherjum-Fährten. 2. Das Problem der Euryapsida. E. H. COLBERT (1945, 1965) und A. S. ROMER (1956) vereinigen die Protorosaurier und Sauropterygier zur Subklasse der Euryapsida. Es sind dies Reptilien, deren Schädel eine einzige obere Schläfenöffnung aufweist, die aussen vom Postorbitale und vom Squamosum begrenzt wird. Eine Prüfung ihrer Vertreter ergab, dass von der Ordnung der Protorosauria Protorosaurus, Macrocnemus und Tanystropheus zu den Prolacertidae gehören. Nothosauria (sowie Plesiosauria) und Placodontia der Ordnung Sauropterygia ROMERS besitzen keine näheren verwandtschaftlichen Beziehungen. Der Schädel von Nothosaurus hat wahrscheinlich ein diapsides Stadium durchlaufen. Als einzige grössere Gruppe der Subklasse der Euryapsida sind die Placodontia zu betrachten. Die systematische Stellung von Araeoscelis und von Trilophosaurus ist erneut zu überprüfen. |
||
| Gübelin,E. | Diamantgewinnung in Südafrika. | 112,285AR |
| In einer kurzen Einführung wird über die Entdeckungsgeschichte des ersten Diamantenfundes in Südafrika berichtet und versucht, die heute geltende Hypothese über die Entstehung der Diamanten zu erklären. An Hand einer grösseren Serie von Lichtbildern wird sodann der Bergbau, die Aufbereitung sowie die letzte Ausscheidung der Diamanten dargelegt, und mit drei Beispielen von Lagerstätten werden die verschiedenen Abbaumethoden besprochen. Die primitivsten Schürfmethoden, wie sie vor 100 Jahren kurz nach der ersten Entdeckung üblich waren, werden auf den Alluviallagerstätten angewandt. Modernere Abbaumethoden trifft man auf den primären Lagerstätten; die modernsten Abbauanlagen und Verhüttungseinrichtungen aber finden sich auf den marinen Lagerstätten an der Küste Südwestafrikas. Es lässt sich so in eindrücklicher Weise der ungeheure Arbeitsaufwand für die mühsame Gewinnung von Diamanten darstellen. | ||
| Lindenmann,J. | Die Zerstörung von Tumoren durch Viren. | 112,285-286AR |
| Virus-Onkolyse, die Zerstörung
von Tumoren durch Viren, begegnet zwei Hauptschwierigkeiten. Einmal erweisen
sich jene Viren, die Tumorzellen rasch zerstören können, als
hochgradig letal für das Wirtstier. Zweitens steht für die Onkolyse
nur eine beschränkte Frist zur Verfügung, weil die
Wirtstiere eine Immunität gegen das onkolytische Virus entwickeln, die die Virusvermehrung und damit die Zellzerstörung abbremst. Durch einen Zufall wurde die Resistenz von A2G-Mäusen gegenüber Influenzavirus entdeckt. Diese Resistenz ist genetisch determiniert. Mit einem Stamm von neurotropem Influenzavirus, der an Tumorzellen adaptiert worden ist, lässt sich in A2G-Mäusen, die Ehrlich-Aszites-Tumor tragen, eine Onkolyse erzeugen, die die Mäuse überleben. Im Gefolge dieser Onkolyse entwickelt sich bei den Wirtstieren eine hochgradige Immunität gegenüber dem Tumor. Viele Argumente sprechen dafür, dass diese Immunität darauf beruht, dass Teile der Tumorzellen in das Virus eingebaut werden und auf diese Weise ein gesteigertes Immunisierungsvermögen erwerben. |
||
| Bovey,P. | Was wissen wir mehr über den Lärchenwickler nach 16 Jahren Forschungsarbeit. | 112,286AR |
| Der Lärchenwickler (Zeiruphera
diniana Gn.), dessen Raupen periodisch die Lärchenbestände in
Höhen über 1200 m ü. M. heimsuchen, ist ein Modellobjekt
für populationsökologische Untersuchungen.
Die Untersuchungen, die ohne Unterbruch seit 1950 in den Schweizer Alpen durchgeführt werden, wurden 1958 auf das österreichische, italienische und französische Alpengebiet ausgedehnt. Sie erlauben, die komplexen Mechanismen, die die Dynamik der Populationen des Lärchenwicklers in dessen Schadenzone regieren, besser zu verstehen. Die zyklische Populationsbewegung im Optimumgebiet des Lärchenwicklers auf 1700 bis 1900 m ü. M. können wir zusammenfassend folgendermaßen darstellen: Die klimatischen Bedingungen erlauben Jahr für Jahr eine Zunahme der Raupenpopulationen um das 5-15 fache, indem sowohl die Überwinterungsmortalität im Eistadium als auch die Verluste durch Inkoinzidenz beim Schlüpfen der Eiraupen in dieser Höhenlage minimal sind. Nach 4-5 Generationen wird aber eine derart hohe Populationsdichte erreicht, dass die intraspezifische Konkurrenz der Raupen in ihrer Nahrungsbasis sich progressiv verstärkt und zu katastrophaler Sterblichkeit unter den Raupen führt. Gleichzeitig mit dieser Übervölkerung kann eine epizootische Viruskrankheit fakultativ den Populationszusammenbruch beschleunigen. Als Folge der Frass-Schäden bewirken die Verschlechterung der Nahrungsqualität und die Parasiten eine zusätzliche, dichteabhängige Mortalität in verzögerter Weise. Die unmittelbar sofort wirkende intraspezifische Konkurrenz um die Nahrung leitet also die Regulation der Population bei bestimmter Populationsdichte ein, nämlich bei ca. 100 Raupen auf 1 kg Zweigmasse. Die übrigen biotischen Faktoren regulieren den Populationsverlauf während der Regressionsphase. Wenn wir aus dem Optimumgebiet auf 1800 m Höhe in niedrigere Lagen von 1200-1400 m ü. M. herabsteigen, üben die abiotischen Umweltsbedingungen einen zunehmend stärkeren Mortalitätseffekt auf das Ei und das Eiraupenstadium aus. Aus diesen Gründen wachsen die Populationen hier viel langsamer und erreichen die Kulmination ihrer Polulationsbewegung 1-2 Jahre später gegenüber den Populationen des Optimumgebietes. Ausserdem beschränkt sich die Schadenperiode in diesem suboptimalen Gebiet häufig auf ein einziges Jahr; die Schadenperiode kann sogar ganz ausfallen, so dass die regelmässige Folge des Schadenauftretens unterbrochen wird. Die zyklische Populationsbewegung des Optimumgebietes wird im suboptimalen Areal unregelmässig. Vom zyklischen Gradationstyp in Höhenlagen ausgehend, gelangen wir über den temporären Gradationstyp mit sporadischer Massenvermehrung in die Zone der Indifferenz, die bei uns alle Wälder unterhalb 1200 m ü. M. umfasst. Wo Lärchen vorhanden sind, bildet das Insekt im Tief land autochthone Populationen ohne irgendwelche Schäden zu verursachen. Ziel unserer zukünftigen Forschung ist die Bestimmung der Populationsbewegung in dieser Zone und das Verständnis ihrer Ursachen. |
||
| Kurth,A. | Waldwiederherstellung in der Kastanienzone der Alpensüdseite. Ein Beispiel angewandter forstlicher Forschung und Planung. | 112,287AR |
| Die Edelkastanie, Castanea sativa,
kommt zur Hauptsache in den untern Hanglagen der Alpen-südseite vor.
Lange Zeit hindurch spielte dieser Baum als Frucht- und Holzlieferant eine
grosse Rolle. Für die Selbstversorgung der Kleinbetriebe, der abgelegenen
Dörfer und Täler war er besonders geeignet. Heute noch zeugen
zahlreiche Terrassen, selbst an Steilhängen, von der einstmals intensiven
Bodenbenutzung. Unterdessen sind infolge Abwanderung der Bevölkerung
nicht nur landwirtschaftliche Flächen, sondern auch gepflegte Kastanienselven
und einst häufig gehauene Niederwälder sich selbst überlassen
worden und verwahrlost. Für den ständig sich vermehrenden Wald
wurde bis vor kurzem wenig Verständnis aufgebracht und damit auch
keine eigentliche Bewirtschaftung durchgeführt. Zwei Entwicklungen
vermochten das Interesse am Wald plötzlich zu wecken. In landschaftlich
bevorzugten Lagen wurde der Wald mehr und mehr als Bauland beansprucht,
und eine Epidemie, verursacht vom Kastanienrindenkrebs, Eizdothiu parasitica,
begann in den Beständen ihr Zerstörungswerk. Das Absterben ausgedehnter
Kastanienwälder und der damit verbundene ausgedehnte Holzschlag beunruhigte
Bevölkerung und Behörden; es wurde befürchtet, dass die
Entblössung des Bodens die Erosion und die Wildwasser gefährlich
vermehren könnte. Die Kantone Tessin und Graubünden entschlossen
sich mit Hilfe des Bundes zu umfangreichen Arbeiten der Waldwiederherstellung.
In das Hilfsprogramm waren zahlreiche Forschungsarbeiten eidgenössischer
Institute, vorab der Anstalt für das forstliche Versuchswesen eingeschlossen.
Phytopathologische Untersuchungen über die Lebensweise des Erregers führten, unter vielem anderen, zunächst zu einer Schätzungsmöglichkeit des Krankheitsverlaufes, was der Aufstellung eines generellen Zeitplanes für Gegenmassnahmen diente. Ferner zeigte sich, dass die Pandemie auf der europäischen Castanea sativa weit weniger rasch und zerstörend verlief als vorher auf der nordamerikanischen Castanea dentata. Dies liess erhoffen, dass durch wiederholte Impfung und vegetative Vermehrung verhältnismässig resistente Sorten selektioniert werden können. Heute sind bereits zahlreiche Klone auf verschiedenen Standorten angebaut worden und stehen hinsichtlich ihres Verhaltens in Prüfung. Ausserdem sind widerstandsfähige Hybriden von Castanea sativa und Castanea molissima vorhanden. Letztere Art, die chinesische Kastanie, ist der ursprüngliche Wirt von Endothia parasitica, die auf ihr bloss endemisch vorkommt. Angesichts des schwindenden wirtschaftlichen Wertes der Kastanienfrucht und des Kastanienholzes kann aber nicht an eine Wiederherstellung des Kastanienwaldes auf 10 bis 15000 ha Fläche gedacht werden. Andere, wertvollere Baumarten haben die Grundlage für lebensfähige forstliche Betriebe zu bilden. Dies liess mannigfache zusätzliche Versuche angezeigt erscheinen. In einem etwa dreissig Hektar umfassenden Versuchsbetrieb wurden zahlreiche einheimische und fremde Nadel- und Laubhölzer angepflanzt. Die Versuche haben Auskunft über die Eignung von Baumart und Herkunft und über die Zweckmässigkeit verschiedener Pflanz-, Düng- und Pflege-verfahren zu geben. Die gewonnenen, teilweise allerdings noch unvollständigen Erkenntnisse ergaben, zusammen mit ergänzenden Erhebungen über Waldflächen, über Holzeigenschaften und Ertragsfähigkeit, die Grundlage für ein umfangreiches Programm der Waldwiederherstellung durch den Forstdienst. Die Realisierung desselben stösst aber auf zahlreiche Schwierigkeiten, wie die weitgehende Parzellierung des Bodeneigentums, die wahllose Überbauung der Waldränder, die mangelnde Erschliessung mit Strassen und vieles andere mehr. Trotzdem darf der Zukunft zuversichtlich entgegengesehen werden. Zweifellos wird der vom Kastanienrindenkrebs zerstörte Wald durch ausgedehnte Pflanzungen wiederhergestellt und die Rodung zu Bauzwecken durch Regionalplanung sinnvoll beschränkt werden. |
||
| Biegert,H. | Die frühesten Phasen der menschlichen Stammesgeschichte. | 112,287AR |
| Durch die Entdeckung der Australopithecinen
aus dem Alt- und Ältestpleistozän von Afrika ist unsere Kenntnis
über die menschliche Stammesgeschichte erheblich erweitert worden.
Dieses neue Blatt im Buch der Menschheitsgeschichte wurde 1924 mit dem
Fund eines fossilen Kinderschädels bei Taung in Südafrika aufgeschlagen.
Die Australopithecinen zeigen uns vor allem, dass sich die für den rezenten Menschen typischen Eigenschaften nicht gleichzeitig, sondern zu verschiedenen Zeiten seiner Stammesgeschichte herausbildeten. So waren die A. zweibeinig aufrechtgehend, mit freischaffenden Händen, hatten aber gleichzeitig noch ein Gehirn, das nicht grösser als das der Menschenaffen war. Das heisst, trotz kleinem Gehirn und äffischem Schädelbau sind die A. keine Menschenaffen, sondern Menschenartige (Hominiden). Diese Tatsache wird auch durch ihre Lebensweise betont. Sie hatten den tropischen Regenwald verlassen. Ihr Lebensraum war das offene, savannenartige Gelände, wo sie sich als Jäger betätigten. Junge Säugetiere, Vögel, Schlangen und Eidechsen waren ihr Wild, das sie mit bewaffneten Händen erlegten und roh verzehrten. Den Gebrauch des Feuers kannten sie nicht. Doch waren sie nicht nur Werkzeugbenutzer, wie wir das auch von den Menschenaffen und andern Primaten kennen sondern sie haben auch Werkzeuge für einen vorausbedachten Zweck hergestellt. So hatte Australopithecus nicht nur biologisch, sondern auch kulturell wenigstens die Anfänge des Menschseins erreicht. Zweifelsfrei präpleistozäne Hominiden kennen wir heute noch nicht, auch wenn Ramapithecus und Kenyapithecus eventuell in Frage kommen. Da bisher nur Zähne und Kiefer von ihnen gehoben werden konnten, bleibt vorerst ihre systematische Einstufung umstritten. Andererseits ist der von einigen Fachleuten als hominid angesehene Oreopithecus aus dem untern Pliozän der Toskana recht vollständig erhalten, lässt aber leider keine Merkmale erkennen, die eindeutig hominid sind. Auf Grund der vorliegenden fossilen Dokumente und den an rezenten Primaten gewonnenen Ergebnissen der vergleichenden Anatomie, Physiologie und Verhaltensforschung, ist die Hypothese von der Herleitung der Hominiden aus dem Stamme der Dryopithecinae wahrscheinlicher denn je. |
||
| Grosjean, G. | Moderne Erkenntnisse über die historische Siedlungsstruktur der Schweiz | 112,264 |
| (Autoreferat nicht erhalten) | ||
| Zimmermann,H.W. | Zur postglazialen Sedimentation im Greifensee. | 111,1-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résumé
Dans les sédiments postglaciaires du Greifensee
près der Fàllanden (Zurich), la palynologie, les mollusques
et les conditions de sédimentation ont été étudiés
dans deux profiles de forage voisins. En voici les résultats principaux:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heim,P.J. | Verbreitung und Häufigkeit der Iris sibirica L. in der Schweiz von der Zeit der Meliorationen bis heute. | 111,23-45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pater Johannes Heim | Tabelle I lässt das Geschehen
betreffend Iris sibirica L. in einer Spanne von 100 Jahren einigermassen
übersehen. Von den ursprünglich 106 Beständen in 15 Kantonen
sind noch 62 Vorkommen in 7 Kantonen vorhanden. Ein viel düstereres
Bild aber zeichnet die Tatsache, dass in bezug auf die Bestandesgrösse
noch ca. 30% vorhanden sind. Einzig in der Reussebene findet man noch Grosskolonien;
während in der Linthebene noch ca. 0,5 % als kläglicher Rest
besteht, scheint im Berner Mittelland unsere Iris total verschwunden zu
sein.
Tabelle I Vorkommen der Iris sibirica L. vor der Melioration
bis 1965 in der Schweiz
Doch sehr erfreulich wirkt die Tatsache, dass 30 % der
noch bestehenden Vorkommen unter Schutz stehen, was uns veranlasst, an
dieser Stelle den betreffenden Institutionen, Privatleuten und Behörden
von Herzen zu danken. In letzter Stunde scheint die Aufstellung eines Inventares
der zu erhaltenden Landschaffen und Naturdenkmäler von rationaler
Bedeutung eine grosse Hilfe zur Erhaltung der Iris sibirica zu werden,
denn die betreffende Kommission nahm 40 % der heutigen Standorte in dieses
Inventar auf.
Tabelle II Anteil der einzelnen Kantone am Bestand der
Iris sibirica L.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kutschke,Inge | Die thermischen Verhältnisse im Zürichsee zwischen 1937 und 1963 und ihre Beeinflussung durch meteorologische Faktoren. | 111,47-124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diss. bei E.A.Thomas | Die Basis unserer Längsschnittuntersuchung
bildeten die Temperaturwerte vom Zürichsee, die von 1937 bis 1963
registriert wurden. Unser Anliegen war es, das thermische Geschehen im
See nach Zeit, Ort und Grösse zu erfassen und Variationen auf Beziehungen
zu internen und externen Faktoren zu testen. Die wesentlichen Merkmale,
die sich aus Beobachtungen in 24 Jahren ergaben, wurden beschrieben, die
rechnerischen Ergebnisse in Zahlen- und Zeittabellen, in graphischen Darstellungen
und statistischen Masszahlen dargeboten und interpretiert.
Wir befassten uns im fünften Kapitel dieser Arbeit mit den Temperaturen von sechs Messstellen entlang der Längsachse des Sees; wir diskutierten den Begriff «Oberfläche» und erläuterten die regional verschieden ausgefallenen Durchschnittsund Extremtemperaturen von der Wasseroberfläche. Alsdann zeigten wir den Jahresgang der Oberflächentemperaturen an den einzelnen Probenahmestellen auf und rechneten die monatlichen Mittel für die gesamte Oberfläche aus, um einen Annäherungswert für vertikale Vergleichsstudien und für Korrelationen mit meteorologischen Daten zu bekommen. Bei den Temperaturbeobachtungen von immer tieferen Wasserschichten konnten wir feststellen, dass der jahreszeitliche Rhythmus bis zu 40 Metern Tiefe einerseits eine Phasenverschiebung bis zu vier Monaten in bezug auf das Erreichen des Maximums erfährt und andererseits immer mehr abklingt; am ausgeprägtesten tritt er in der oberen Wasserschicht in Erscheinung, in der die durchschnittliche Jahresschwankung 17,70 C ausmacht. Diese Amplitude verringert sich mit wachsender Tiefe in dem Masse, wie es in der Verflachung der Temperaturkurve zum Ausdruck kommt. Ab 55 Metern Tiefe liegt der Betrag der Temperaturunterschiede im Jahresverlauf bei durchschnittlich 10 C und weniger. Beim Vergleich des jährlichen Temperaturganges ergab sich, dass mit wachsender Tiefe dem Erwärmungsvorgang des Sees ein immer grösserer Zeitraum zur Verfügung steht, indes sich die Abkühlung der Wassermassen um so schneller ereignet, je weiter sie von der Oberfläche entfernt liegen: Die Temperatur steigt fällt bei 0 m ab März ab September 10 m ab März ab Oktober 20 m ab März ab Dezember 30 m ab April ab Januar Thermische Differenzierungen von Schicht zu Schicht und Monat zu Monat haben sich aus klimatischen, morphologischen und hydrophysikalischen Gegebenheiten weitgehend erklären lassen. Bei den Aufzeichnungen der monatlichen Temperaturen aller Tiefenstufen haben sich Profile ergeben, die in bestimmten Zeiten eine heterotherme Zone erkennen lassen, die durch ihr grosses Temperaturgefälle auf relativ kleine Distanz zu jener bekannten physikalischen, chemischen und biologischen Zwei- oder Dreiteilung der vertikalen Wassermassen führt. Wir haben die gebräuchlichen Termini für diese Schicht diskutiert und versucht, sie grössenmässig zu erfassen und abzugrenzen um eine Basis für vergleichende Sprungschichtstudien zu schaffen. Durch Anwendung eines bestimmten Messverfahrens auf die Temperaturprofile gelangten wir sowohl zu den Angaben über Lage und Mächtigkeit der Thermoklinen als auch zu jenen über Lage und Betrag des zu einer bestimmten Zeit grössten Temperaturgradienten innerhalb dieser interessanten Schicht. Nach einer winterlichen Sprungschicht bei inversen Temperaturverhältnissen haben wir im Zusammenhang mit der Gfrörni wegen zu wenig differenzierter Temperaturangaben vergeblich gesucht. Aus den Temperaturwerten ergaben sich nach Ausführung weiterer Rechenschritte die monatlichen und jährlichen Wärmemengen des Sees, die wir im sechsten Kapitel dieser Arbeit bekannt machten. Wir veröffentlichten sie aus dargestellten Gründen auf drei Arten; als Kalorien-Total, als Seemitteltemperaturen und als cal/cm2 Seeareal über der mittleren Tiefe von 5400 cm. Durch Akzentverschiebungen bei der Betrachtung der zahlreichen Ergebnisse, konnten wir sukzessiv über das zeitliche Auftreten der Minima und Maxima informieren, über die Beträge und den Moment des durchschnittlich grössten Wärmeschubs, über die winterlichen Wärmereserven und die Höhe der Wärmeeinnahmen und -ausgaben. Um die Thermik in den einzelnen Seejahren beurteilen zu können, leiteten wir aus unseren Resultaten analog zu dem Vorgehen in der Klimatologie die monatlichen und das jährliche Mittel als Normalwert ab. Auf Grund dieser Typisierung war es möglich, eine Klassifizierung der Seejahre in warme, kalte und durchschnittliche vorzunehmen, die sie unterscheidenden Merkmale herauszuarbeiten, die Häufigkeit von Extremjahren festzustellen und der Frage nachzugehen, ob sich der Wechsel von warmen und kalten Seejahren periodisch ereignet und in Beziehung zu dem Auftreten der Sonnenfleckenzyklen gebracht werden kann. Im siebten Kapitel dieser Arbeit beschrieben wir an Hand von Abbildung 13 die Temperaturveränderungen der Gesamtwassermasse und verglichen damit Variationen der Lufttemperaturen, Sonnenscheindauer, relativen Feuchtigkeit und des Windes. Wir konnten die allgemeinen Aussagen durch die Anwendung korrelationsstatistischer Verfahren präzisieren. In Korrelationskoeffizienten und im Bestimmtheitsmass zeigten sich jahreszeitliche und monatliche Zusammenhänge zwischen den Veränderungen von Seetemperaturen bis zu 20 Metern Tiefe und den Variationen der Lufttemperaturen und Sonnenscheindauer. Die Tendenz der Abhängigkeit veranschaulichten wir in einigen Korrelationsdiagrammen. Die engsten Beziehungen zwischen dem hydrothermischen Geschehen und dem Gang der Lufttemperaturen ergaben sich für die Grenzschicht Luft-Wasser und traten um so deutlicher hervor, je mehr der Wärmelatenz des Wassers durch Zusammenfassung grösserer Zeitintervalle (Frühling, Sommer, Herbst, Winter) und dem Rhythmus der Seethermik, der sich gegenüber dem der Luft um einen Monat verzögert, Rechnung getragen wurde. Der Aussagewert dieser Ergebnisse wurde diskutiert. Die Kenntnis der Beziehungen zwischen Luft- und Seeoberflächentemperaturen führte zu dem Versuch, aus dem monatlichen Mittel der Lufttemperaturen theoretisch die Seeoberflächen- temperaturen abzuleiten. Ein anschliessender Vergleich mit vorliegenden Daten (am besten das Mittel aller Oberflächentemperaturen) zeigte, dass die Treffsicherheit hoch ist und liess sogar die Vermutung zu, dass die theoretischen Werte einem Monatsmittel näher liegen könnten als die nur einmal pro Monat wirklich registrierten. Auf die praktischen Anwendungsmöglich- keiten dieser Kenntnisse wurde hingewiesen. Im achten Kapitel haben wir die Zeit der totalen Seeoberflächenvereisung von 1963 wegen ihrer Seltenheit aus der Longitudinalstudie herausgegriffen. Soweit die vorliegenden Messresultate es ermöglichten, sind wir den Veränderungen der hydrothermischen Verhältnisse und den sie bedingenden Faktoren bis zum Eintritt der Gfrörni nachgegangen. Wir konnten den Anteil der mitwirkenden Faktoren und das Prinzip im Wechselspiel der Kräfte nicht erfassen, weil das Beobachtungsmaterial zu lückenhaft ist. Das Ereignis tritt für unser Objekt so selten und dann noch überraschend ein, dass bisher keine umfassenden Messmethoden ausgearbeitet und überprüft wurden; auch das notwendige kostspielige Spezialinstrumentarium zur Registrierung fehlt. Inge Kutsche definiert das Metalimnion als die Schicht mit einem vertikalen Temperatur- gradienten von mehr als 1° pro Meter. Bei anderen Seen fährt man mit >0.5°/m besser. Die Erklärung der Wärmebilanz hat in den letzten 40 Jahren grosse Fortschritte gemacht. Bei der Berechnung der Summen, fährt man mit der Fassregel von Kepler besser. Summary
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Widmer,B. | Ein Elefanten-Backenzahn aus der Kiesgrube Witzberg bei Pfäffikon (Kanton Zürich). | 111,125-140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zusammenfassung
In der Kiesgrube Witzberg bei Pfäffikon (Kt. Zürich) wurde 1963 ein Unterkieferfragment mit einem ausgezeichnet erhaltenen Backenzahn eines Elefanten gefunden. Es wird gezeigt, dass es sich um den letzten Molaren der linken Unterkieferhälfte handelt (M3). Das Stück wird beschrieben und vermessen. Der Vergleich mit Funden aus dem südlichen Deutschland zeigt, dass der Zahn entsprechenden Resten von ursprünglichen Vertretern des Mammuts (Mammonteus primigenius Blumenbach) sehr nahe kommt (Form der Kaufläche und der Lamellenfiguren, Lamellenzahl, Längen-Lamellen-Quotient, Längen-Breiten-Quotient). Für die Stratigraphie folgt daraus, dass die Fundschicht in der Kiesgrube Witzberg aus der Zeit zwischen Riss-Eiszeit und beginnendem Hauptwürm stammt. Résumé
Summary
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hartmann-Frick,Hanspeter | Knochenfunde aus dem "Pfahlbau" Rohrenhaabe in Obermeilen-Dollikon, Grabung 1962. | 111,141-144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die hier beschriebenen Knochen wurden beim
Ziehen eines Grabens für die zentrale Kläranlage in Obermeilen
1962 anläßlich einer Rettungsgrabung von der kantonalen Denkmalpflege
geborgen. Es ist Dr. W. Drack, Denkmalpfleger des Kantons Zürich,
zu verdanken, daß diese Knochen zur Untersuchung ins Zoologische
Museum der Universität Zürich gelangten (Drack, 1966).
Die Knochen stammen von der gleichen Stelle des Zürichsees, wo 1854 Ferdinand Keller die ersten «Pfahlbauten», wie er solche Seeufersiedlungen nannte, entdeckt hat. Die Siedlung Obermeilen-Dollikon war während der neolithischen Pfyner-, Horgener- und Schnurkeramikkultur sowie während der Frühbronzezeit besiedelt. Die vorliegenden Knochen konnten nicht nach Kulturschichten getrennt geborgen werden. Aus der Grabung 1962 waren 3 Menschen- und 350 Tierknochen bestimmbar. Die Tierknochen stellen, da es sich bei ihnen um Funde aus einer Rettungsgrabung und nicht aus einer systematischen Flächengrabung handelt, nur eine Stichprobe aus der Tierwelt der oben genannten Epochen dar. Frühere Knochenaufsammlungen von dieser Örtlichkeit ebenfalls Stichproben haben RÜTIMEYER 1860 und 1861 sowie KUHN 1935 publiziert. Bei den Menschenknochen handelt es sich um je 1 linken Oberarm- und Oberschenkelknochen vermutlich desselben noch jugendlichen Individuums (Infans II, 6-14 Jahre alt); beide Reste stammen aus Graben II bei Larse 14. Der 3. Menschenknochen ist ein Stück eines rechten Oberschenkelknochens eines wahrscheinlich adulten Individuums. Fundstelle: Depot aus der Breite (Drack, 1966). Dr. W. SCHEFFRAHN vom Anthropologischen Institut der Universität Zürich war mir bei der Bestimmung dieser Knochen in verdankenswerter Weise behilflich. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lemans, A. | Der Firnzuwachs pro 1964/65 in einigen schweizerischen Firngebieten, 52. Bericht | 111,145-154
Ende Heft 1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resumé 1964/65
Das hydrologische Jahr 1964/65 zeichnete sich am Alpennordhang durch besonders grossen Niederschlagsreichtum aus. Ausserdem war es arm an Sonnenschein und die Temperaturen im Gebirge blieben sowohl im Sommer- als auch im Winterhalbjahr bedeutend unter dem Durchschnitt. Diese Faktoren führten in den hier untersuchten Firngebieten auch unterhalb 3000 m zu einem bemerkenswerten Firnzuwachs, wie man ihn seit 1920 nur noch selten beobachten konnte. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Demmerle, Susanne | Ueber die Verschmutzung des Rheines von Schaffhausen bis Kaiserstuhl. | 111,156-224
Beginn Heft 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Susanne Doris,
genannt Susi Diss. bei E.A.Thomas |
Zusammenfassung
Der erste Teil dieser Arbeit befasst sich mit chemischen und bakteriologischen Untersuchungen im Rhein zwischen Langwiesen und Rheinau. Während eines Jahreszyklus 1963/64 wurde festgestellt, dass folgende Bestimmungen für die Sommermonate (Mai/Juni-Oktober) Tiefwerte aufweisen: Karbonathärte, P043-, Gesamtphosphor, NO3- und O2-Gehalt. In derselben Zeit zeigen der p11-Wert und NO2-Maximalwerte, während die Coli- und Keimzahlen keine typischen jahreszeitlichen Schwankungen mitmachen. Die Cl--Konzentration ist vom Dezember bis Juni am höchsten, und NH3 zeigt nur im Juni und Dezember speziell hohe Werte. Die Höchstwerte für die O2-Zehrung liegen in den Monaten März bis Mai und diejenigen für den KMnO4-Verbrauch in der Zeit von Februar bis Juni sowie im November. Diese Beobachtungen zeigen, dass der Chemismus des Rheines noch sehr stark von den biologischen Vorgängen im Boden- und Untersee abhängt. Im Verlaufe der Fliessstrecke sind in den meisten Monaten für fast alle Bestimmungen Konzentrationszunahmen zu verzeichnen, die mit Ausnahme des O2-Gehaltes - auf eine Eutrophierung des Flusses infolge Abwassereinleitung zurückzuführen sind. Für die Zunahme des O2-Gehaltes bei Neuhausen ist die grosse Turbulenz des Rheinfalles verantwortlich. Bis Rheinau kann eine gewisse Selbstreinigung des Flusses festgestellt werden. Drei Rheinuntersuchungen, die sich bis Kaiserstuhl erstreckten, beweisen, dass im weitern Verlauf des Flusses die teilweise sehr stark belasteten Zuflüsse (Thur, Töss, Glatt und Glattkanal) für eine zusätzliche Eutrophierung des Wassers verantwortlich gemacht werden müssen. Vergleiche mit einer entsprechenden Rheinuntersuchung, die vor 25 Jahren gemacht wurde, lassen erkennen, dass beispielsweise die Keimzahlen des Rheines überall gestiegen sind, an einzelnen Stellen (1-5, 8-10) sogar um ein Vielfaches. Die O2-Zehrung ist ebenfalls gestiegen, und zwar um 2,3-5,5 % des O2-Gehaltes vom Wasser. Andere Bestimmungen lassen sich nicht direkt vergleichen, da verschiedene Analysenmethoden verwendet wurden. Ein Biomassetest charakterisiert im zweiten Teil die Produktionskapazität der verschiedenen Verschmutzungsstufen und ergänzt damit die Resultate des ersten Teiles. Die Algenproduktion der Testversuche steigt wegen der Zunahme an Nährstoffen durch Abwassereinleitung im Jahresdurchschnitt um 32 % an. Der Biomassetest zeigt auch für die Rheinstrecke bis Waldshut durch eine grösser werdende Algenproduktion die steigende Verschmutzung an. Für die Testalge Raphidonema cf. spiculiforme wurden ernährungsphysiologische Untersuchungen vorgenommen, die zeigten, dass sich die Alge wahrscheinlich in hohem Masse autotroph ernähren kann, dass sie aber unter Umständen auch die Möglichkeit hat, organische Stoffe wie Pepton oder Acetat zu verwerten. Summary
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bachofen,Reinhard | Ferredoxin und die CO2-Fixierung bei Bakterien. | 111,225-246 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No Summary, no abstract,
58 Lit. references |
1. Einleitung / Introduction
Die Fixierung von Kohlendioxyd wurde lange Zeit als ein besonderes Merkmal autotropher Organismen betrachtet. Seit den Untersuchungen von Senebier und De Saussure Ende des 18. Jh. galt die Kohlendioxydassimilation als ein auf die grünen Pflanzen beschränkter, photosynthe- tischer Vorgang. Erst die Untersuchungen des Stoffwechsels der Propionsäurebakterien von WOOD und WERKMAN (1936) zeigten, dass auch heterotrophe Organismen befähigt sind, Kohlendioxyd zu fixieren. Mit Hilfe der in den letzten zehn Jahren immer häufiger angewandten Isotopentechnik konnten sowohl in autotrophen wie in heterotrophen Organismen eine ganze Anzahl neuer Kohlendioxyd-Fixierungsmechanismen gefunden werden (vergleiche die zusammenfassende Darstellung von WOOD und UTTER 1965). Für den Einbau von Kohlendioxyd in Bakterien sind die folgenden drei Wege von Bedeutung: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waldmeier,Max | Die Sonnenaktivität im Jahre 1965. | 111,247-268
Ende Heft2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The present paper gives the frequency numbers
of sunspots, photospheric faculae and prominences as well as the intensity
of the coronal line 5303 Å and of the solar radio emission at the
wavelength of 10.7 cm, all characterizing the solar activity in the year
1965. From the smoothed sunspot relativenumbers the time of sunspot minimum
has been fixed to 1964.7.
Die vorliegende Veröffentlichung gibt die die Sonnenaktivität charakterisierenden Häufigkeitszahlen der Sonnenflecken, der photosphärischen Fackeln, der Protuberanzen, die Intensität der Koronalinie 5303 Å und diejenige der solaren radiofrequenten Strahlung auf der Wellenlänge 10,7cm. Auf Grund der ausgeglichenen Sonnenfleckenrelativzahlen ist die Epoche des letzten Sonnenfleckenminimums auf 1964.7 festgesetzt worden. Mean daily sunspot relative-number Mittlere tägliche
Sonnenflecken-Relativzahl 15,1 (10,2)
The tables 1, 4 and 14 give the daily values of the relative-numbers,
of the group-numbers and of the radio emission, the tables 5,7, 9, 11 and
12 contain the distribution in latitude of the spots, faculae, prominences
and of the coronal intensity. Fig. 1 and 3 show the course of the relative-numbers
and of the radio emission, and by fig. 2 the distribution in latitude of
the spots, faculae, prominences and of the coronal intensity is demonstrated.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Borbély,F. | Toxikologische Aspekte der heutigen Umwelt. | 111,269-279
Beginn Heft 3/4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die toxikologische Gesamtsituation der Gegenwart
ist durch die zahlen- und mengenmässige Zunahme von biologisch wirksamen
Stoffen potentiellen Giffstoffen in unserer beruflichen und ausserberuflichen
Umwelt gekennzeichnet. Es ist äusserst bequem mit Hinweis auf die
verlängerte allgemeine Lebenserwartung diese neuzeitliche toxische
Gefährdung einfach zu ignorieren. Solche Bestrebungen finden in gewissen
Kreisen der chemischen Industrie, aber auch bei gewissen Behörden
Anklang. Es ist auch leicht, diese potentielle Gefährdung schwarz
auszumalen; Angst, sogar eine ausgesprochene «Chemophobie»
zu erwecken und mit steriler Sehnsucht an die guten, alten, giftfreien
Zeiten die vielleicht gar nicht so gut und gar nicht so gifffrei waren
zurückzudenken. Veröffentlichungen in dieser Richtung hätten
Aussicht, Bestseller zu werden. Schwer ist es dagegen, über diese
potentielle Gefährdung ein objektives Bild zu entwerfen.
Seit etwa 2 Jahrzehnten beschäftigen sich mit diesen Fragen verschiedene internationale und einheimische Gremien. Ich erwähne nur die WHO (World Health Organization), die FAO (Food and Agricultural Organization), beides Institutionen der UNO; ferner zum Europarat gehörend den groupe de travail sur l'emploi des substances toxiques dans l'agriculture, die Association des Centres Anti-Poisons und die Europäische Gesellschaft für Arzneimitteltoxikologie. In der Schweiz obliegt diese Sorge u. a. der IKG (Interkantonalen Giftkommission) und der FBH (Fachgruppe für die Beurteilung landwirtschaftlicher Hilfsprodukte). Botschaft: Rauchen tötet. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eggmann,H. | Untersuchungen zur Kern- und Chromosomenstruktur pflanzlicher Zellen. | 111,281-307 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Untersucht wurden meiotische Zellen von
Tradescantia virginica und die Mitose spermatogener Fäden von Chara
und Nitella
Nach chemischer Fixierung zeigen sowohl meiotische als auch mitotische Chromosomen einen fibrillären Aufbau. Mit der Gefrierätz-Methode erscheinen die Fibrillen weniger deutlich, der Kern zeigt eine ähnliche Struktur wie das Cytoplasma. Durch entsprechende Gefrierbedingungen können die Chromatinbezirke vom Kernplasma unterschieden werden. Im Verlauf der Prophase zerfällt die Kernmembran in einzelne Membranabschnitte, von denen in der Metaphase nur noch Bläschen von 0,2 0,5 µm Durchmesser übrig bleiben. In den spermatogenen Fäden der Characeen sind diese Vesikel am Aufbau der neuen Kernmembran in der Telophase wieder beteiligt. Die Spermatogenese der Characeen ist gekennzeichnet durch weitgehende Strukturveränderungen des Kerns. Während der Streckung und Schraubung besteht er nur noch aus 30~40 Å dicken Fibrillen, die eine Orientierung in der Längsachse des Kerns zeigen. In reifen Spermatozoiden sind sie zu parallelen Fibrillen von 70 Å Dicke oder zu Bändern zusammengelagert, die sich über die ganze Länge des Kerns erstrecken. In den geschraubten Spermatozoiden ist ein Mikrotubuli-System ausgebildet, dessen Zusammenhang mit der Bewegung der Spermatozoiden diskutiert wird. Die elektronenmikroskopischen Bilder ermöglichen keine offensichtliche Zuordnung zu einem der beschriebenen Chromosomenmodelle. Verschiedene Untersuchungsergebnisse deuten darauf hin, dass sich die DNS-Fibrillen nicht über die gesamte Länge des Chromosoms erstrecken, sondern in einzelnen Abschnitten, die den Chromomeren entsprechen, voneinander getrennt angeordnet sind. Ein durchgehender Proteinstrang ist verantwortlich für die lineare Aufreihung der einzelnen DNS-Moleküle, die vermutlich in Ringform vorliegen. Das Modell von Frey-Wyssling und Mühlethaler (Abb. 1 d) beschreibt eine derartige Anordnung der DNS-Moleküle und zeigt eine gute Übereinstimmung mit den elektronenmikroskopischen Bildern und mit andern experimentellen Ergebnissen. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thomas,E.A. | Phosphat-Fällung in der Kläranlage von Uster und Beseitigung des Eisen-Phosphat-Schlammes (1960 und 1966). | 111,309-318 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nach einer Mitteilung von Dipl.-lng. H. Burkhalter
(1966), Eidgenössische Anstalt für Wasserversorgung, Abwasserreinigung
und Gewässerschutz, haben Versuche der EAWAG bei «Nachfällung»
gute Resultate ergeben; nach seiner Auffassung dürfte die Eliminationswirkung
sicherer sein. Unsere für die Jahre 1960 und 1966 dargelegten Untersuchungszahlen
zeigen aber, dass das Ziel der Phosphatelimination in der Grosskläranlage
Uster mit «Simultanfällung» gut erreicht worden ist. Ebenfalls
vorzügliche Eliminationsleistungen verzeichnen wir bei der Ende 1966
in Betrieb genommenen Phosphatfällung («Simultanfällung»)
in der Kläranlage Stäfa (Zürichseegemeinde), worüber
später zu berichten ist. Die Kosten des Chemikalienaufwandes beliefen
sich in Uster 1966 auf ca. ? derjenigen einer in Deutschland betriebenen
«Nachfällungsanlage». Dass zudem die Baukosten und entsprechend
auch die Kosten für Verzinsung und Amortisation für die Nachfällung
wesentlich grösser sind als für «simultane» Fällung,
ist dem Fachmann bekannt.
4. Zusammenfassung
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bächtiger,K. | Pillow-Laven im ,Taminser Kristallin' bei Felsberg (Kt.Graubünden). | 111,319-329 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schlussfolgerungen
Auf Grund der in Relikten noch erhaltenen und kaum metamorphen Keratophyr Partien, lithologischen Vergleichen und tektonischen Untersuchungen des Verfassers (1965, 1966, 1967) müssen die aus dem «Taminser Kristallin» stammenden epidotisierten Pillow-Laven von Felsberg als Unter-Perm der Helvetischen Schubmasse in der Wurzelzone angesehen werden. Während aber von fast allen Erforschern des Helvetischen Verrucano der neueren Zeit, so z. B. Amstutz (1950, 1954, 1957), Verfasser (1960), Fisch (1961), Huber (1964), Schielly (1964), Ryf (1965) Und Trümpy (1967) eine kontinentale und fluviatile, vereinzelt limnische Ablagerung der Laven und Sedimente mit einer ihr entsprechenden Metallogenie angenommen wird, deuten die Pillow- Laven von Felsberg, die vom Verfasser (1965) kürzlich entdeckten intramagmatischen Manganerze und Dolomit-Bänke bei Saldein und das Quarz~Keratophyr-Geröll mit Mikro-Pillow- bzw. Variolith-Textur aus dem Murgtal-Sernifit der Mürtschenalp erstmals auf einen lagunären Charakter einzelner unter-permischer Eruptiva und Tuffe im «Taminser Kristallin» hin. Die zudem von Amstutz (1954), Schielly (1964) und vom Verfasser beobachtete Fliessrichtung der Laven von NW nach SE könnte zudem einem grossräumlich gleichsinnigen Gefälle im Verrucanotrog entsprochen haben, wobei eine Küste im SE eigentlich zu erwarten ist. Man könnte dabei an ein Binnenmeer im Zentrum des Verrucanotroges denken, denn erst im Südtirol ist ja nach Heritsch (1939) das Unter-Perm mann. Diese FaziesÜberlegungen würden das «Taminser Kristallin» damit auch ins Süd-Helvetikum stellen. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Widmer,R. | Statistische Untersuchungen über den Föhn im Reusstal und Versuch einer objektiven Föhnprognose für die Station Altdorf. | 111,331-375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistische Tests
Bei Annahme einer Sicherheitsgrenze von 0,01 sind die Ergebnisse aller 3 Trennverfahren als signifikant zu betrachten. Rein statistisch ist Formel (2) wesentlich besser als (1). Die Formel (3) gibt nach den durchgeführten Analysen nochmals eine bessere Trennung, die statistisch aber nicht gesichert ist. 16. Folgerungen und offene Fragen 1. Als grössten Mangel empfanden wir im Laufe der Untersuchungen das Fehlen systematischer Messungen in der freien Atmosphäre im Alpengebiet. Dass bedeutende Inversionen vorhanden sind, ist nach 9.4. zu erwarten. Zur genauen Abklärung der Temperatur- und Strömungsverhältnisse sind aber regelmässig durchgeführte Sondenaufstiege nötig. 2. Prinzipiell stellt sich die Frage, ob die Anwendung statistischer Methoden in der Synoptik sinnvoll ist oder nicht. Die in 14.2. und 15. erhaltenen Erfolgsraten können von einem erfahrenen Meteorologen ohne weiteres erreicht werden. Viel wichtiger als die momentane Erfolgsrate sind die folgenden 3 Punkte: a) Die für die Prognose wichtige Entscheidung kann auf Grund objektiver Kriterien getroffen werden. b) Die Wahrscheinlichkeit, mit der das Ereignis eintreffen wird, ist bekannt. c) Die Formeln können laufend verbessert werden. Bei der Durchsicht der fehl-klassierten Fälle kann es sich z. B. zeigen, dass noch weitere Elemente zu berücksichtigen sind. Die Formel kann neu berechnet und auf wesentliche Verbesserungen der Trennung getestet werden. Die in 14.2. und 15. angegebenen Trennformeln sind nicht als Endprodukte anzusehen, sondern als Basis für weitere Verbesserungen. 3. Die im Reusstal gewonnenen Erkenntnisse dürfen nicht ohne weiteres auf andere Föhntäler angewendet werden. Eine begonnene Untersuchung im Kt. Graubünden zeigt z. B., dass hier die thermischen Verhältnisse bei Föhn wesentlich anders sind. Nach den Untersuchungen von Bouët (1961) ist der Tagesgang der Föhnhäufigkeit im Wallis viel ausgeprägter als im Reusstal und während allen 4 Jahreszeiten deutlich nachweisbar. Eine vergleichende Studie der Föhnerscheinungen in allen bedeutenden Föhntälern der Schweiz ist erst dann möglich, wenn erste Bearbeitungen der einzelnen Täler vorliegen und Registrierungen (Wind, Temperatur, relative Feuchtigkeit) das Erstellen einer Föhnstatistik für das entsprechende Tal ermöglichen. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Markgraf. F. | Der Botanische Garten und das Botanische Museum der Universität Zürich | 111, 377-380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Forschung
Herr Prof. Markgraf untersuchte an neu entdeckten Funden die systematische Gliederung und geographische Verbreitung der südamerikanischen Gnetum-Arten. Ferner bearbeitete er die Helobiae für die Neu-Auflage von HEGIS Flora von Mitteleuropa. Herr Prof. Schlittler betrieb phylogenetische Studien an Liliaceen des Mittelmeergebiets. Herr PD. Dr. Rohweder setzte seine anatomisch-entwicklungsgeschichtlichen Untersuchungen an Centrospermen fort, wobei er besonders den Blütenbau der Caryophyllaceen erforschte. Herr Stüssi widmete sich der Auswertung seiner Sukzessionsuntersuchungen im Schweiz. Nationalpark. Frau Dr. De Mendoza untersuchte vergleichend-morphologisch einige Gattungen der Kanaren Flora. Frau Prof. Markgraf förderte weiter ihre Studien an Festuca und erforschte dabei besonders den Gesamtformenkreis der Festuca amethystina, die ostmediterranen Sippen des sulcata-Kreises und die Arten der Alpen. Herr Prof. E. Schmid kartierte Vegetationstypen der Colli Euganei. Herr Dr. Hartmann vollendete sein Manuskript über die Flora des Karakorum. 8. Pilzkontrolle
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ziswiler, V. | Das Zoologische Museum der Universität Zürich | 111, 380-383 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sammlungszuwachs
Im Herbst wurde eine Sammelaktion für einheimisches Wild gestartet, die uns helfen soll, die zum Teil sehr unansehnlichen Bestände unserer Heimatsammlung zu erneuern und zu ergänzen. Bis jetzt konnten beschafft werden: 3 Schneehasen, 2 Baummarder, 2 Steinmarder, 2 Füchse sowie 2 Schneehühner. Im Austausch gegen einen Schneehasen konnten vom Musée d'histoire naturelle in La Rochelle 2 Ginsterkatzen erworben werden. Vom Zoologischen Garten Zürich erhielten wir 49 Tiere geschenkt, davon 1 Persische Kropfantilope, 1 Puma, 2 Seehunde, 1 Baumstachler, 1 Zwergflamingo, 1 Krontaube. Von der Steinbock-Kolonie am Piz Albris erhielten wir 1 Paar Steinböcke. Dr. R. Burkard, Küsnacht, überliess uns eine wertvolle Kollektion von Vögeln aus den Philippinen. Besuch
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laves, F. | Die mineralogisch-petrographische Sammlung der ETH | 111, 384 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erstmals seit Eröffnung der Sammlung
im Oktober 1925 musste sich die Sammlung einen schweren Eingriff in ihrer
Struktur gefallen lassen. Bedingt durch die Erweiterung und den Umbau des
Naturwissenschaftlichen Gebäudes an der ETH war eine Verpackung und
Auslagerung notwendig geworden. Der grösste Teil der Magazinsammlung
und ein Teil der Schausammlung sowie die petrographische Sammlung wurden
nach Kindhausen bei Dübendorf verlagert und sind für mehrere
Jahre nicht mehr zugänglich. Der grösste Teil der Schausammlung,
zerbrechliche Stufen, die WISER-Sammlung und mindestens ein Vertreter der
vorhandenen Mineralien konnten im Hause behalten und im ehemaligen Edelsteinkabinett
zugänglich gelagert werden. Ein Teil der petrographischen Belegsammlung
konnte im Keller zugänglich untergebracht werden. Eine Anzahl grosser
Schaustufen alpiner Minerale sind in den - vom Bau nicht berührten
- Korridoren in gedrängter Form ausgestellt worden.
Zuwachs: Die Firma Gebr. GÜBELIN, Zürich und Luzern, schenkte der Edelsteinsammlung einen kostbaren, hexagonal ausgebildeten, teilweise klaren Smaragd mit Albit, Quarz und Mutter-gestein. - Im Tauschverkehr und durch Vermittlung des Geologischen Institutes der ETH konnten mehrere seltene Mineralarten aus Uganda sowie Dioptase aus dem Kongo-Brazzaville in die Sammlung aufgenommen werden. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trümpy, Rudolf | Die Geologische Sammlung der ETH | 111, 384 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Im Laufe des Berichtsjahres musste fast die
gesamte geologische Sammlung der ETH wegen des Umbaues des Naturwissenschaftlichen
Gebäudes verpackt und ausgelagert werden. Die Sammlung wurde zu Beginn
des Jahres 1966 für das Publikum geschlossen. Der grösste Teil
des Materials befindet sich in Baracken in Kindhausen bei Dübendorf;
besonders zerbrechliche Stücke und eine erweiterte Lehrsammlung konnten
im Institut behalten werden. Eine sehr umfangreiche Kollektion von Tertiärfossilien
der Sammlung MAYER-EYMAR wurde an das Naturhistorische Museum in Basel
ausgeliehen, wo sie während der nächsten Jahre bearbeitet werden
wird.
Mit der Aufstellung der Sammlung im umgebauten Naturwissenschaftlichen Gebäude kann kaum vor 1970 oder 1971 gerechnet werden. Es können weniger Stücke ausgestellt werden, doch wird sich anderseits die Möglichkeit zu einer modernen Präsentation des Materials bieten. Der Grossteil der Sammlung wird in besonderen Depoträumlichkeiten zugänglich aufgestellt sein. Über Eingänge und Publikationen wird 1967 zusammenfassend berichtet werden. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuhn-Schnyder, Emil | Das Paläontologische Institut und Museum der Universität Zürich | 111, 384- 392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbildungen: Sphenodon punctatus Gray, Paranthosaurus amsleri Peyer, Foto v. Acanus longispina Wettstein, Bergung eines Elefantenstosszahns bei Wasterkingen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Henking, Karl H. | Die Sammlung für Völkerkunde der Universität Zürich | 111, 392-396 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbildungen geschnitzte Türe aus Holz aus Senufo, Tanzaufsatz Kwonro aus Senufo, Holzfigur aus Baule | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ackerknecht, Erwin H. | Die medizinhistorische Sammlung der Universität Zürich | 111, 397 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bezüglich Geschichte und Umfang der
Sammlung verweisen wir auf diese Zeitschrift 107: 273, 1962.
Zuwachs Wir erwarben ein persisches chirurgisches Instrument (ca. 1000 v.Chr.). Durch Schenkung erhielten wir vom Roten Kreuz, Zürcher Oberland, eine eiserne Lunge; von der Universitätsaugenklinik einen Haabschen Riesenmagnet; von Herrn Dr. SCHWARZ ein Punktiergerät; von der Schweizer Anstalt für Epileptische einen Encephalograph; von Frl. H. GEHRY eine Lichtbogenmaschine; von Frl. M. ISLER eine Forelbüste; von Herrn Prof. Dr. W. R. HEss ein Viscosimeter, ein Coordimeter, Diapositive, Filme und Modelle. Besuch 1966 wurden bis August ca. 550 Besucher gezählt und über 20 Führungen abgehalten. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leibundgut, H. | 21. Jahresbericht der Naturschutzkommission der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich für das Jahr 1965 | 111, 398 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Das verflossene Jahr brachte der Naturschutzkommission
keine Geschäfte, welche Sitzungen mit sämtlichen Mitgliedern
erfordert hätten. Dagegen waren zahlreiche Einzelfragen durch den
Präsidenten in Zusammenarbeit mit der Schweizerischen Naturforschenden
Gesellschaft, dem Amt für Regionalplanung und für Landschaftsschutz
des Kantons Zürich, dem Zürcherischen Naturschutzbund, dem Aargauischen
Bund für Naturschutz und der Stiftung Pro Reusstal zu behandeln, wobei
sich die einzelnen Vorstandsmitglieder beratend zur Verfügung stellten.
So standen die Entwürfe für die Gesamtpläne Zürcher
Oberland, Zimmerberg, Furttal und Knonaueramt zur Diskussion. Den Interessen
des wissenschaftlichen Naturschutzes wird von den kantonalen Amtsstellen
ein erfreuliches Verständnis entgegengebracht.
Sehr beunruhigt waren dagegen mehrere Mitglieder unserer Gesellschaft über die Gefährdung der Bolle di Magadino, die auch für die Zürcher Hochschulen als Forschungs- und Lehrobjekt als unersetzlich bezeichnet wird. Da sich bereits die Schweizerische Naturforschende Gesellschaft und der Schweizerische Bund für Naturschutz für die Erhaltung der Bolle di Magadino eingesetzt haben, wurden diese Gesellschaften erneut in Zuschriften ersucht, auch in unserem Interesse alles zur Erhaltung des einzigartigen Mündungsgebietes zu unternehmen. Als fruchtbar erwies sich die Tätigkeit der Stiftung Pro Reusstal, die uns über ihre Bestrebungen und Massnahmen laufend unterrichtet. Mehr und mehr zeigt sich, dass sich unsere Naturschutzkommission weniger mit direkten Naturschutzmassnahmen zu befassen hat, nachdem diese in sehr initiativer Weise vom Zürcher Naturschutzbund verfolgt werden, als vielmehr mit Aufgaben der Unterstützung solcher Massnahmen, soweit sie auch eine wissenschaftliche Bedeutung erlangen. Daher ist eine auf möglichst verschiedenem Gebiete der Naturwissenschaften verteilte Zusammensetzung unserer Kommission wichtig. Diese Kommission setzte sich wie folgt zusammen: Prof. Dr. H. Leibundgut (Präsident) Prof. Dr. H. Ellenberg Dr. H. Graber Prof. Dr. E. Landolt Prof. Dr. K. Suter Prof. Dr. E. A. Thomas Prof. Dr. H. Ellenberg scheidet leider aus unserer Kommission aus, nachdem er einen Botanik- lehrstuhl an der Universität Göttingen übernommen hat. Ich bin ihm für seine überaus tatkräftige Unterstützung wie auch allen anderen Mitgliedern sehr dankbar. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhn-Ochsner,W. | Das Moorreservat Chrutzelried bei Gfenn-Dübendorf ZH. Seine Pflanzen- und Tierwelt. | 111,399-432 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rückblick und Ausblick über die
Weiterentwicklung der Flora des Chrutzelriedes
Es muss als ein besonders wertvolles Unternehmen bezeichnet werden, dass E. Neuweiler am Schlusse seiner Untersuchungsergebnisse über die pflanzlichen Fossilien in den Torfschichten des Chrutzelriedes eine vollständige Liste der damaligen Flora dieses Moores beigefügt hat. Diese umfasst 99 Arten, wovon 66 Vertreter von typischen Flachmoorgesellschaffen, 12 ausgesprochene Wasserpflanzen, 7 Hoch-und Zwischenmoorgewächse, 8 Gehölze und 11 Arten, die aus benachbarten Kultur-wiesen stammen. Aln 21. Juni 1901, unmittelbar nach Erscheinen der Arbeit von Neuweiler, hatte Otto Naegeli, der spätere Direktor der Medizinischen Klinik des Kantonsspitals Zürich, das Moor besucht. Nach seinen Aufzeichnungen konnte er 71 Arten der Liste von Neuweiler feststellen und machte dabei noch 17 Neu-funde. Gerade Naegelis Bericht bezeugt offenkundig, dass damals im Chrutzelried noch bedeutende Hochmoorbestände erhalten waren. Er erwähnt folgende Arten mit den Attributen «reichlich» und «sehr viel»: Drosera rotundijo ha, Oxycoccus quadripetalus, Andromeda polifolia, Eriophorum vaginatum, Nardus stricta. Von den letzten drei Arten ist heute keine Spur mehr vorhanden, die übrigen finden sich nur noch sehr spärlich, alles Folgen der radikalen Torfausbeute während des ersten Weltkrieges. Einen weitern Beweis für das damalige Vorhandensein bedeutender Hoch- und Zwischen- moorkomplexe liefern die Funde des Bryologen P. Culmann, der auch kurz vor 1900 hier botanisierte. Er fand folgende Torfmoosarten: Sphagnum palustre, S. subbicolor, S. magellanicum, S. subsecundum, S. contortum und S. recurvum, ferner Hypnum stramineum und H. trilanum. In den Flachmoor-Assoziationen fand O. Naegeli noch «ziemlich reichlich» die kleine Moororchide Liparis Loeselii, die heute nicht mehr gefunden werden konnte. Dafür hat in neuester Zeit die unerfreuliche Invasion der amerikanischen Goldrute (Solidago serotina S. gigantea var. leiophylla) eingesetzt, welche namentlich in die Hochstauden-Gesellschaften eindringt und durch ihren dichten Wuchs die einheimischen Florenelemente vollständig zu verdrängen vermag. Da grössere Flächen des Moores nicht mehr gemäht wurden, nahm auf diesen die Gehölzflora stark überhand (Abb. 4). Als erfreuliche Tatsache kann dafür gebucht werden, dass die Regeneration der Hochmoorreste gut vorwärts schreitet, indem an verschiedenen Stellen sich grössere schwellende Polster von Sphagnum palustre ausbreiten, was teilweise den zwei verflossenen, sehr nassen Sommern zuzuschreiben ist. Für die weitere Erhaltung der noch vorhandenen Flachmoor-Assoziationen ist der alljährliche Streueschnitt am Ende der Vegetationsperiode dringlich notwendig. Auf Grund seiner Untersuchungen, die sich auf den Zeitraum von 1961 bis 1965 erstreckten, konnte der Verfasser in diesem Moorreservat 168 Arten feststellen, inbegriffen 24 Moosarten und 29 Gehölze. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martin, P.R. | Blätter aus der Geschichte der geologischen Erforschung der Bündner und Tessiner Alpen. | 111,433-454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nach den Tagebuchnotizen Friedrich Rolles sowie bisher
unbekannten Briefen Bernhard Studers und anderen (zwei Seiten
des Texts):
... als Triaskalke. Sie mögen Recht haben, aber bis nähere Anzeigen gefunden werden, würde ich es vorziehen, sie nicht zu classificiren, sondern einfach als unbestimmte Kalke zu bezeichnen. Theobald ist mit seiner Einreihung der Trümmerfelsarten in die österreichische Formationsskala, ohne eine Spur paläontologischer Annäherung nachweisen zu können, nicht auf guter Fährte gewesen. Die Ihrer Gegend zunächst liegenden sicher bestimmten Kalksteingebirge sind die im südlichen Tessin vorkommenden Lias- und Triaskalke vom M. Generoso, Arzo, Saltrio, aber dieselben streichen südlich vom Veltlin durch die Brianza und die Thäler von Bergamo und Brescia.» Wenig glücklich verlief indes für ROLLE der für seine Zukunft entscheidende Versuch, in Zürich für dauernd Fuss zu fassen. Er mochte inzwischen auch sich selbst davon überzeugt haben, dass man in dieser Stadt mit dem doch nur geringen und auf den Sommer beschränkten Tagegeld für die Kartierung nicht leben konnte, und nachdem eine von ihm im November vor der Fakultät gehaltene Probevorlesung nicht zu dem gewünschten Erfolge geführt hatte, liess er enttäuscht wohl endgültig von seinem Plan ab. Auch der Sommer 1877 erlaubte eine erfolgreiche Geländearbeit (vgl. Abb. 2), und im Herbst hatte Rolle bereits ein gutes Stück Bündner und Tessiner Gebirgslandes kartiert. Interessant sind auch noch für uns Heutige, für die noch so manche Frage in diesem Gebiet offen geblieben ist, die brieflichen Bemerkungen und Hinweise, die Studer zu dem einen oder anderen Ergebnis dieser Kartierung anbringt. So schrieb er am 3. November 1877 unter anderem: «Der Mangel an Petrefacten macht es unmöglich, genauere Altersbestimmungen der Kalk- u. Schiefermassen festzustellen. Ich würde daher die einfache petrographische Benennung vorziehn. Die Belemniten scheinen ohnehin eher für jurassisches oder überhaupt mesozoisches Alter, als für Trias zu sprechen. Kalk- u. Dolomiteinschlüsse im Gneiss kommen auch in den obern Tessinergebirgen nicht selten vor. Ob sie stets als zusammengepresste Mulden zu denken sind lasse ich unentschieden. Einen Theil des Gneisses als Verrucano zu deuten, scheint mir gewagt. Eine ähnliche Vertretung ist in den Alpen und anderwärts noch nicht vorgekommen, und eine constante Folge der verschiedenen Gneiss oder Schieferarten wäre doch erst festzustellen, bevor man solche Folgerungen zieht. Der grüne Glimmer im Suretagneis ist alter Magnesiumglimmer, nicht Fuchsit. SANDBERGER, der vorigen Herbst die erratischen Gesteine von Hohentwyl im Höhgau untersucht hat, fragt mich, ob mir Fuchsit, den er dort gefunden, aus Bünden bekannt sei. Bis auf nähere Untersuchung meiner vor 40 Jahren geschlagenen Sammlung konnte ich aber nichts Befriedigendes antworten. Wenn Sie Ihre Rückreise über Chur nehmen, so könnten Sie in der dortigen Sammlung nachsehen, ob etwa Chromglimmer-Ähnliches aus Bünden darin ist. Ihrem Profil Biasca-Weisshorn, worin Sie den Gneiss-Glsch. [Glimmerschiefer] in einer Folge von Sätteln und Mulden darstellen, kann ich nicht beitreten. Nirgends noch hat man in unsern weit ausgedehnten Gneissgebirgen, wo meilenlange und mehrere tausend Meter hohe nackte Felswände vorkommen, etwas der Art gesehn. Wo Sedimentmassen auf liegen, lagern sie auf den Schichtenköpfen des Gneisses, oder auf einer granitisch gewordenen Gneissmasse. Die Verhältnisse des Maggia- oder Antigoriothales, vorzüglich aber das Berner Hochgebirge sind hierüber sehr belehrend, und ich habe sie in meiner G. d. Schw. 1176 usf. und 229 usf., früher auch in LEONH. Jb. 1846 sehr hervorgehoben. Es ist nach diesen Vorkommen unmöglich, die Structur des Gneisses als Schichtung anzusehn. Auch die Profile, die neulich Dr. Baltzer in Leonh. Jb., 1877 VII als Vorläufer seiner grössern Arbeit, bekannt gemacht hat, lässt darüber keinen Zweifel. Wohl stehe ich mit meiner Behauptung im Gegensatz zu der landläufigen Geologie. Ich habe sie vertheidigt gegen Lory, Favre und Heim auf der Versammlung in Bonn (deutsche geol. Zts. 1872), gegen Lory und Gosselet auf der Vers. der Soc. geol. in Genf 1875. Wenn einmal die schönen Zeichnungen von Baltzer erschienen sind, wird man kaum mehr die bisherige Ansicht festhalten wollen.» Auch die Einflussnahme auf die Darstellungsweise der angetroffenen geologischen Fakten lässt sich Studer nicht aus der Hand nehmen. Am 7.12.1877 schreibt er an Rolle: «Den frühren Ihnen mitgetheilten Bemerkungen habe ich wenig beizufügen. Auch die Commission findet, dass die Aufnahmen reine Thatsachen und nicht Hypothesen darstellen sollen, die [unleserlich] in den Text zu verweisen sind, dass also nicht Gneiss als Verrucano zu bezeichnen ist, keine Mulden und Sättel anzugeben sind, die nicht wirklich beobachtet wurden. Wichtig dagegen ist, in den Profilen das beobachtete Fallen durch Striche, den hypothetischen Zusammenhang der Schichten allenfalls durch Punkte anzugeben, z. B. [siehe Zeichnung]. Wirkliche Sättel und Mulden sind in unseren Kalkalpen oft deutlich zu sehen, während in den krystallinischen Alpen, in Gneiss, Glimmerschiefer etc., weder ich noch Andere je etwas der Art beobachtet haben. Nur am Contact zweier Steinarten zeigt sich im Gneiss zuweilen eine Biegung der Schiefer, so im Berner Oberland im Contact von Gneiss und Kalk, im Gotthard-Tunnel zwischen Gneiss und Serpentin [Zeichnung]. Es hat an der Contactgrenze offenbar Verwerfung und Rutschen stattgefunden.» Dr. Baltzer ist von uns eingeladen worden, diese Verhältnisse genau zu untersuchen und hat darüber voriges Jahr eine Arbeit in Leonh. Jahrb. eingereicht; die Figur ist aber, weil sie nicht colorirt ist, unklar und Baltzer selbst ist über die Deutung nicht mit sich im Reinen. Er hat sich jetzt, nach Anleitung von Rosenbusch, auf die Dünnschliffe geworfen; mir scheint aber, man sollte erst die Schlüsse ziehen, die sich aus der einfachen Ansicht folgern lassen. Schon Saussure sagte, ce n'est pas avec des microscopes qu'il faut observer les montagnes.» (Auszug aus Abb. 3.) Später, am 12. Januar 1878, lässt sich Studer über einige geologische Beobachtungen in den Berner Alpen aus. Es heisst hier u. a.: «Meine ersten Beobachtungen in den Berneralpen stehen mit einer Figur im Bulletin de la Soc. geol. 1831, und seitdem habe ich wiederholt darauf aufmerksam gemacht, auch meinen Freund Escher veranlasst, eine bessere Zeichnung davon zu geben, die im 3. Band der schweiz. Denkschriften 1839 erschienen ist. Eine einfache Darstellung der Thatsache lässt sich durch folgende Fig. geben [Zeichnung]. Aus der Umbiegung der Petref. führenden Kalklagen K schloss ich, dieselben seien durch den von unten aufdringenden Gneiss G gebogen und umgekippt worden; aus der gleichförmigen, beinah verticalen Schieferung des Gneisses, unter- und oberhalb dem Kalk und meilenweit fortsetzend, diese Structur könne nicht Schichtung und erst nach dem Aufsteigen des Gneisses erfolgt sein, wofür auch spricht, dass an vielen Stellen die Schieferung erst mehrere Fuss oder Klafter von dem Kalkgange entfernt hervortritt. Den Winter verbrachte Rolle wohl nur zeitweise in Homburg, vor allem wahrscheinlich einerseits als Assistent Mayers tätig in Zürich, andererseits seinen Kartierungsbericht ausarbeitend, dem die Abfassung einer kleinen Schrift «Übersicht der geologischen Verhältnisse der Landschaft Chiavenna in Oberitalien» folgte. Diese Publikation bereitete ihm neue Schwierigkeiten. Zwar hatte ihn Studer auf eine allgemein gehaltene Anfrage Rolles zunächst vor der Veröffentlichung gewarnt, ihm dann jedoch mitgeteilt: «Mein Abrathen betraf nur grössere Arbeiten, die dem später der Karte beizulegenden Text vorgreifen würden. ... Da die Aufnahme eines Blattes stets mehrere Jahre in Anspruch nimmt, so ist es oft erwünscht, einzelne Beobachtungen, oder auch allgemeine Resultate nicht verjähren zu lassen.» (7.12.1877.) Gerade das letztere dürfte Rolle allzu wörtlich genommen haben; jedenfalls brachte ihm die etwas zu unvorsichtige Veröffentlichung, deren Publikation Heer vorher abgelehnt hatte, einen unverblümten Tadel der Geologischen Kommission ein. Besonders übel vermerkte man ihm die wohl etwas scharfe Zensur, die er seinem verstorbenen Kollegen Theobald erteilt hatte. Heute allerdings darf man feststellen, dass die kleine Schrift manche wertvolle Angabe enthält, die wir, da in Rolles späterer Erläuterung zu Blatt XIX wenig davon zu finden ist, heute missen würden. Dazu gehört auch Rolles kurze, aber wichtige Meinungsäusserung über die Ursachen des Plurser Bergsturzes 12 Leider blieb seit diesem Zwischenfall das Verhältnis zwischen dem überempfindlichen Rolle und dem manchmal vielleicht etwas kleinlichen Studer gestört. Rolle verteidigte sich gegen den Vorwurf allzu selbstherrlicher Veröffentlichung «amtlichen» Materials mit dem wenig überzeugenden Vergleich mit einem Mitarbeiter der freien Presse und musste sich darauf von Studer sagen lassen, dass auch Tageszeitungen es ihren eigenen Berichterstattern kaum ohne weiteres gestatten dürften, ihre Beobachtungen anderen Blättern mitzuteilen. Zum Angriff auf Theobald meinte Studer: «Dass ich wiederholt geäussert habe, Theobald habe wohl zu schnell gearbeitet und Mehreres, das er geschrieben, dürfte bei näherer Prüfung Berichtigungen erleiden, ist ganz richtig, aber ein Anderes ist es, etwas in vertraulichen Briefen zu schreiben, ein anderes es dem grossen Publicum mitzutheilen, ohne dazu die Autorisation eingeholt zu haben. Es ist Ihnen wohl auch bekannt, in ... 12 Über Rolles Auffassung zum Plurser Bergsturz siehe Martin 1965. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gansser,Arthuro | Arnold Heim (1882-1965). | 111,455-457 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mit Bild: der 70 jährige Arnold Heim studiert einen Horizont pliozäner Pecten in Persisch-Belutschistan (Foto A.Gansser) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Markgraf, Friedrich. | Hans Ulrich Stauffer (1929-1965). | 111,457-458 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Systematische Botanik: Santalaceen, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jaag,Otto | Gottfried Huber-Pestalozzi (1877-1966). | 111,458-461 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arzt und Naturforscher (Limnologie, Phytoplankton, Seenmonographien) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jöhl,W. | Georg Widmer (1926-1966). | 111,461-462 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gründung der schweizerischen Vereinigung zur Weltraumtechnik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zuppinger,Adolf | Hans Rudolf Schinz (1891-1966). | 111,463-465 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| medizinische Radiologie (Prof. Dr. Dr. h.c. mult.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LeRoy, H.L. | Probleme der theoretischen und praktischen Züchtung nach quantitativen Methoden. | 111,467AR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die in der praktischen Züchtung nach
quantitativen Merkmalen angewandten Methoden sind im allgemeinen recht
wenig bekannt. Anhand der Probleme der Tierzucht können auf Grund
von Modellvorstellungen recht interessante Ergebnisse hergeleitet werden.
Da bei quantitativen Merkmalen nicht das einzelne Gen «verfolgt»
werden kann, sondern nur das Ergebnis der Einwirkungen vieler Gene (Enzymsysteme)
im Zusammenspiel mit den Umwelteinwirkungen erfasst wird, bedient sich
die auf die Praxis ausgerichtete Populationsgenetik variationsanalytischer
Analysen zur Charakterisierung der möglichen Genwirkungen und umweltbedingten
Merkmalsmodifikationen.
Je nach der Art der Genwirkung (additive, dominante und epistatische Geneffekte) wird die künstliche Selektion zu Züchtungserfolgen führen, die sich im Selektionserfolg pro Generation und im Ausmass des Selektionserfolges unterscheiden, wie dies auf Grund vereinfachter Modellvorstellungen recht eindrücklich gezeigt werden kann. Die Informationsquellen, die für die Beurteilung des Zuchtwertes eines Individuums zur Verfügung stehen, sind in chronologischer Reihenfolge geordnet die folgenden: Ahnenleistungen, Geschwisterleistungen, Eigenleistung und Nachkommenleistungen. Der Grad der Zuverlässigkeit der einzelnen Informationsquellen ist verschieden. Auf Grund sinnvoller Forderungen kann der Aussagewert der einzelnen Informationen und Informationskombinationen numerisch charakterisiert werden, so dass für die Praxis entsprechende Empfehlungen gemacht werden können. Da gewisse systematische Umwelteinwirkungen zusätzliche Schwierigkeiten in der Zuchtwertbeurteilung verursachen, muss einem wirkungsvollen Zuchtplan die entsprechende Planung, kombiniert mit der optimalen Organisation, vorausgehen. Es ist nicht ein einzelnes Merkmal Gegenstand der Selektion, sondern das Individuum. Diese Tatsache bedingt, dass mehrere Leistungsmerkmale gleichzeitig berücksichtigt werden müssen. Eine Kontrolle oder «Überwachung» jener Merkmale, die nicht Gegenstand der Selektion darstellen, jedoch lebenswichtig sind wie zum Beispiel die Fruchtbarkeit, ist unbedingt notwendig, da sonst unliebsame Nebenerscheinungen als Folge der natürlichen Selektion nicht ausbleiben werden. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wartenweiler,Georg | Biomechanik, die Lehre vom Ablauf menschlicher Bewegung. | 111,467AR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die ersten wissenschaftlichen Untersuchungen
und Analysen menschlicher Bewegungsabläufe verdanken wir den Physiologen,
angefangen bei Marcy, der vor ca. 100 Jahren die damals noch junge Photographie
sowie seine berühmten Druckkapseln zur Aufzeichnung und Analyse der
Geh- und anderer Bewegungen einsetzte, bis zu W. R. Hess, der bahnbrechende
Untersuchungen über die Bewegungssteuerung im Zentralnervensystem
durchführte. Im Zusammenhang der Industrialisierung wurden Arbeitsstudien
in Fabrikbetrieben (Atzler) besonders aktuell. Gelegentlich interessierte
man sich auch von der Psychologie her für die menschliche Motorik
(z. B. Krueger und Klemm in den dreissiger Jahren), und neuerdings werden
exakte Bewegungsanalysen an verschiedenen Hochschulinstituten für
Leibeserziehung und Körperkultur vor allem in Amerika und Russland
durchgeführt.
Wenn man bedenkt, wie sehr wir Menschen in und mit unseren Bewegungen leben, so muss man sich eigentlich wundern, dass die Biomechanik nicht schon lange an jeder Hochschule etabliert ist. Um so dankbarer sind wir dem Schweiz. Nationalfonds und dem Schweiz. Schulrat, die es uns ermöglicht haben ein eigenes Laboratorium an den Kursen für Turnen und Sport der ETH aufzubauen. Neben einer Zielfilmkamera der Compagnie des Montres Longines stehen uns heute verschiedene elektronische Geräte zur Verfügung, die entweder fabrikmässig erhältlich waren, oder im Physikalischen Institut der ETH, resp. in der Firma Viterra, Wallisellen, entwickelt wurden, darunter 2 Reaktionsplatten, verschiedene Accelerometer, eine Lichtschranke, ein Mehrkanal-Elektromyograph usw. Unser Hauptuntersuchungsgebiet ist z.Z. die Koordination von Teilbewegungen bei schwunghaften Bewegungsabläufen. Dabei lassen sich drei Grundformen des Bewegungsspiels unterscheiden: - Mitbewegungen (Stich mit Ausfall beim Fechten, Strecksprung), bei denen verschiedene Körperteile gleichzeitig und in gleicher Richtung beschleunigt werden, - Gegenbewegungen (Anhechten beim Wasserspringen, Gegenrotation beim Skifahren, Armschwingen beim Gehen), bei denen verschiedene Körperteile gleichzeitig, aber in entgegengesetzter Richtung beschleunigt werden, und - gestaffelte oder phasenverschobene Bewegungen, bei denen sich Phasen von Mit-und Gegenbewegungen ablösen. (Alle grossen Arbeitsbewegungen wie Sägen, Hacken, Mähen sowie auch die meisten Würfe und Stösse.) Alle diese Bewegungen haben ihr typisches Bewegungsbild, das im Bewegungsdiagramm aufgezeichnet werden kann. Unsere derartigen Diagramme vereinigen Weg- und Beschleunigungskurven mit Elektromyogrammen. Sie eignen sich zur Analyse von einfachen Bewegungsabläufen und geben Aufschluss über die Bewegungsqualität sowie Anhaltspunkte für die Bewegungsschulung. Sie zeigen z. B., dass alle Naturformen körperlicher Aktivität nach bestimmten Grundschemen aufgebaut sind und dass es zum Beispiel keinen Sinn hat, die Koordination dadurch fördern zu wollen, dass man mit Armen und Beinen möglichst verschiedenartige Bewegungen ausführt, etwa zum Gehen ein crawlartiges Armkreisen. Solche «Unabhängigkeitsübungen» lösen höchstens stereotype Bewegungsfixierungen und sind vielleicht lustige Spielereien, sie haben aber keinen Wert für die Bewegungsbildung. Hier geht es vielmehr darum, die Grundformen menschlicher Tätigkeiten zu pflegen, wie es schon Pestalozzi sah: «Schlagen, Tragen, Werfen, Ziehen, Drehen, Ringen, Schwingen usw. sind die vorzüglichsten einfachen Äusserungen unserer physischen Kräfte. Unter sich selbst wesentlich verschieden, enthalten sie alle gemeinsam und jedes für sich die Grundlage aller möglichen, auch der kompliziertesten Fertigkeiten.» (Autoreferat) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Borbély,F. | Toxikologische Aspekte der heutigen Umwelt. | 111,468AR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die toxikologische Gesamtsituation der Gegenwart
ist durch die zahlen- und mengenmässige Zunahme von biologisch wirksamen
Stoffen in unserer beruflichen und ausserberuflichen Umwelt gekennzeichnet.
Diese Stoffe können in einmaligen massiven Dosen oder wiederholt in
pharmazeutischen Mengen, aber auch ständig in Spuren aufgenommen werden.
Daher sind drei Arten von aktuellen toxischen Gefährdungen zu berücksichtigen:
1. die unfallmässige, kriminelle oder suizidale akute Vergiftung; 2. die durch Überdosierung oder durch unerwünschte Nebenwirkung bedingte iatrogene Schädigung; 3. die Gefährdung durch wiederholte Aufnahme von Wirkstoffspuren, die in unsere Nahrungsmittel, in das Trinkwasser oder in die berufliche oder ausserberufliche Atmungsluft hineingelangen. Bei den akuten Vergiftungen halten sich zwei Entwicklungen
die Waage. Einerseits erschienen in unserer täglichen Umwelt neue
hochaktive Wirkstoffe, andererseits haben sich unsere therapeutischen Möglichkeiten
stark verbessert. Die Zahl der biologisch wirksamen Stoffe, der sogenannten
Giftstoffe in unserer heutigen Umwelt, kann nur vermutet werden. Wir müssen
aber annehmen, dass es sich um etwa 10000 biologisch wirksame, beziehungsweise
hochwirksame Stoffe, also Giftstoffe handelt. Diese Wirkstoffe werden in
Zehntausenden von Präparaten formuliert und unter Phantasienamen in
den Handel gebracht. Die grossen Fortschritte in der Therapie der akuten
Vergiftungen verlangen von den Apothekern, praktischen Ärzten und
Spitalabteilungen eine neue Bereitschaft. In den Apotheken müssen
die spezifischen und unspezifischen Mittel bereitgehalten werden, und die
Ärzte und Spitalabteilungen müssen imstande sein, eine Reihe
von differenzierten Eingriffen wie künstliche Dauerbeatmung, Defibrillierung
des Herzmuskels, die Anwendung der künstlichen Niere und anderes mehr
auszuführen. In Spitalabteilungen, wo ein Anästhesiologe zur
Verfügung steht, können diese Notmassnahmen meistens gewährleistet
werden. Da es sich bei der Behandlung von akuten Vergiftungen um Eingriffe
handelt, die ein gewisses Risiko aufweisen, dürfen diese Massnahmen
nur bei richtiger Indikation durchgeführt werden. Die Voraussetzung
für eine rechtzeitige und zielgerechte Therapie der akuten Vergiftungen
ist die qualitative und quantitative Abklärung der Noxe. Nur in Kenntnis
des Wirkungsspektrums eines Stoffes kann der Arzt durch einen Eingriff
den Tod oder die Defektheilung verhüten. Da die etwa 10000 Wirkstoffe
in unserer Umwelt in nahezu Hunderttausenden von Präparaten mit Phantasienamen
in den Handel kommen, ist es notwendig, ein toxikologisches Informationszentrum
zu haben, welches fähig ist, die chemische Zusammensetzung, die toxische
Gefährdung und die optimale Therapie sofort anzugeben. Das Gerichtlich-medizinische
Institut der Universität Zürich gibt seit Jahren in toxikologischen
Notfällen telefonische Auskünfte. Mit Hilfe des Schweizerischen
Apothekervereins wurden wir in die Lage versetzt, unsere Karteien auszubauen,
und anfangs 1966 wird das Toxikologische Informationszentrum des Schweizerischen
Apothekervereins im Gerichtlich-medizinischen Institut der Universität
Zürich als Vierundzwanzigstundenbetrieb eröffnet werden. Auf
unsere Initiative hat der Apothekerverein den Beschluss gefasst, dass die
notwendigen spezifischen und unspezifischen Mittel in sämtlichen Apotheken
bereitgehalten werden.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fueter,E. | Konrad Gessner als Universalgelehrter (1516-1565). | 111,470AR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Der Zürcher Arzt, Naturforscher und
Humanist Konrad Gessner - er schrieb sich fast immer lateinisch Conradus
Gesnerus gehört zu den grössten Universalgelehrten
der Schweiz neben Johann Jakob Scheuchzer und Albrecht von
Haller sowie der Renaissance. Selten aber ist noch den Gründen
und tiefern Voraussetzungen seiner mit gründlichster Gelehrsamkeit
verknüpften Universalität nachgeforscht worden.
Gessners universale Neigungen hatten einen fünffachen Ursprung. Zunächst war es die bereits in seiner Jugend bezeugte Wissbegier und hohe Begabung. So schreibt Myconius 1532 über den sechzehnjährigen Gessner an Capito in Strassburg: «Seine grossen Anlagen darf ich dir wohl nicht mit vielen Worten rühmen, du wirst sie in kurzer Zeit selber kennen lernen... Was er nicht weiss, lernt er mit grosser Lust und was er weiss, das übt er gern.» Diese Lust des vielseitigen Lernens und freier Interessen konnte er dann während seiner Studienzeit in Paris mit 18 Jahren in angenehmster, freilich später beklagten Weise frönen. Sie legte den Grundstock zum ausgebreitetsten Wissen, das sein hervorragendes Gedächtnis lebenslang wachhielt und dem die relative Unkenntnis der Spezialisierung sie war nur in der Philologie bereits manifest wenig Schranken setzte. Die zweite Ursache ist in seinem Studiengang und in seinen beruflichen Pflichten zu suchen. Ursprünglich hatte er Theologe werden wollen, wozu ihn innere Frömmigkeit, die starke Zeitströmung der Reformation und seine Gönner, vor allem Zwingli und Bullinger, trieben. Aber vor Antritt seiner Reise nach Paris 1533 riet ihm Ammann zum Studium der Medizin, die ihn dann immer weiter auf das Gebiet der Naturwissenschaften, vor allem der Zoologie, Botanik und «pharmazeutischen Chemie» trieben. Zuvor aber sollte er durch seine frühen, ausgezeichneten Leistungen und Kenntnisse zu einem Ruf als Gräzist an die neugegründete Akademie von Lausanne gelangen und die Beherrschung griechischer Sprache und Wissenschaft eine der hervorstechenden Eigenschaften werden. Nach Zürich zurückgekehrt, erhielt er zur Erleichterung seines Lebensunterhaltes die wenig geschätzte und honorierte Stelle eines Lektors der Physik zugewiesen, wo er über die damaligen physikalischen Wissenschaften, wozu auch die Astronomie, Meteorologie und die natürliche Seelenkunde gehörten, zu unterrichten hatte. Die dritte Bedingung seiner Universalität war seine fast unbegrenzte Freundeszuneigung und -treue. Er war stets bereit, gelehrte Arbeiten oder Vorworte für seine Freunde zu schreiben. welches immer ihr Arbeitsgebiet oder ihre Zielsetzung sein mochten. Die Freundschaft war ihm der oft einzige lichte Ausblick in drängenden Sorgen; daher pflegte er sie als Gelehrter fast im Übermass. Die vierte und oft ausschlaggebende Ursache lag in seiner ökonomischen Lage, beziehungsweise in den Bedingungen des damaligen Buchhandels. Bis zum Jahre 1558 lebte Gessner in bedrückendsten Umständen vielfach als freier wissenschaftlicher Schriftsteller. Wenn dies überhaupt möglich war, so nur durch die Verbindung mit dem tatkräftigen und weitblickenden Zürcher Buchdrucker Christoph Froschauer, der die erste Blüte des Zürcher Buchdrucks begründete. Dieser verlangte aber wie Oporin in Basel grosse und oft illustrierte Werke, da nur diese praktisch vor räuberischen Nachdrucken geschützt waren und ein angemessenes, beziehungsweise lebensnotwendiges Honorar versprachen. Die fünfte Veranlassung kam aus einem tiefen geistigen Antrieb. Der Humanismus strebte darnach, den ganzen literarischen und wissenschaftlichen Schatz der klassischen Antike zu heben, vermehrt um die hebräische und in gewissen Fällen arabische Tradition. Obgleich sich Gessner in Zweifelsfällen (Weiterleben nach dem Tode, Schöpfungsgeschichte usf.) als «Melanchthon des zwinglianisch reformierten Glaubens» meist auf die biblisch-christliche Seite stellte, war sein Leben doch erfüllt vom Verlangen, die Kraft der griechischen Antike zu erneuern und zu verlebendigen, über alle Fakultäten hinweg. Der italienische «uomo universale» war ebenso Vorbild wie natürlicher Typus. (Autoreferat) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Staedtke,J. | Conrad Gessner als Theologe. | 111,471AR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Man darf sich das Verständnis für
Gessners theologische Arbeit nicht trüben lassen durch die moderne
Auffassung von der Unvereinbarkeit der Naturwissenschaft mit dem christlichen
Glauben. Es ist vielmehr zu berücksichtigen, dass die Entstehung der
modernen Naturwissenschaft nur in einer christianisierten Kultur geschehen
konnte und besonders durch die Reformation gefördert wurde. Denn erst
der christliche Glaube, vor allem in seiner reformatorischen Gestalt, vollzog
radikal die Entgötterung und Entdämonisierung der Natur, ersetzte
die statische und abstrakte Fragestellung in der Wissenschaft durch eine
geschichtliche und kinetische, trennte scharf zwischen Schöpfer und
Geschöpf, sicherte dadurch die Göttlichkeit Gottes und die Natürlichkeit
der Natur und erlaubte somit der Wissenschaft jenes leidenschaftliche Suchen
nach der Wahrheit vom Objekt her, ohne das auch die moderne Naturwissenschaft
nicht denkbar ist.
Christliches und naturwissenschaftliches Weltbild treten bei Conrad Gessner, ebenso wie bei den meisten Begründern der neuzeitlichen Naturwissenschaft bis in das 17. Jahrhundert hinein, nicht auseinander, sondern werden von ihrer Kongruenz bestimmt. Die Natur ist für ihren Erforscher wunderbare Schöpfung Gottes. So hatte es Gessner aus der Bibel gelernt, und so erfuhr er es auch durch seine naturwissenschaftlichen Entdeckungen. In seinem ganzen Werk prägt sich jener christliche Grundzug aus, der sein persönliches Leben bestimmte. Ihn konnte etwa die Betrachtung der wunderschönen Schweizer Gebirgswelt zu grundsätzlichen Gedanken über die Schöpfung Gottes anregen, ohne dass er sich in pantheistische Immanenzvorstellungen verlor. Oder nüchterne Entdeckungen natürlicher Vorgänge unterstützten seine Polemik gegen den Dämonenglauben, womit er ein genuin christliches Anliegen vertrat. Die Parallelbeschäftigung mit der Natur und den Quellen des christlichen Glaubens ist ihm selbstverständlich gewesen. Der wissenschaftliche Umgang mit dem christlichen Glauben war aber nicht nur laienhafter Versuch, sondern eine Bemühung von beachtlicher theologischer Qualität. Durch intensiven Fleiss hatte sich Gessner schon in seiner Jugend eine Kenntnis der biblischen Sprachen, des Hebräischen und des Griechischen, angeeignet, die es ihm nicht nur erlaubte die Heilige Schrift mühelos im Ur text zu lesen, sondern ihn auch dazu befähigte seine Korrespondenz in diesen Sprachen zu fuhren Das war aber nur Voraussetzung, nicht Inhalt und Ziel seines theologischen Strebens Es lag im Wesen seiner umfassenden Bildung, dass ihm ein für heutige Verhältnisse ungewöhnlicher nahezu enzyklopädischer Begriff von Theologie vorschwebte Gessner war der Überzeugung dass die Prüfung und Darstellung des christlichen Glaubens zu geschehen habe unter Benutzung aller Hilfsmittel die die Geschichte, die Philologie, die Naturwissenschaft die Philosophie und die Medizin zu ihrem Verständnis liefern. Theologie wird zur Königin der Wissenschaft Sein früher Tod hat ein ausgereiftes theologisches Lebenswerk vereitelt. Dennoch hat sich Gessner in beachtenswertem Umfang der Theologie gewidmet. In seinem Mithridates von 1555 hat er das Unservater in 22 Sprachen wiedergegeben, um so die ökumenische Bedeutung dieses Gebetes zu symbolisieren. Darunter befindet sich eine von ihm selbst verfasste Version des Herrengebetes in deutschen Hexametern. Vor allem hat sich Gessner auf theologischem Gebiet als Herausgeber lateinischer und griechischer Kirchenväter ausgezeichnet. Im ganzen liegen aus seiner Feder neun zum Teil umfangreiche patristische Ersteditionen vor. Conrad Gessners grösste theologische Leistung sind seine «Partitiones theologicae», die 1549 bei Froschauer in Zürich als letztes Buch des Pandektenbandes zu seiner grossen Bibliographie erschienen. Das Werk ist die erste, wenn nicht die einzige systematisch-theologische Enzyklopädie der Reformation überhaupt. Die enzyklopädische Erfassung und systematische Gliederung aller Disziplinen der theologischen Wissenschaft blieb im 16. Jahrhundert dem Nichttheologen Gessner vorbehalten. Man muss dem Werk nachrühmen, dass seine Disposition im grossen und ganzen noch heute der Gliederung theologischer Disziplinen entspricht. Gessner teilt die Theologie in fünf Hauptgruppen auf: 1. Bibelexegese, 2. Spekulative (heute systematische) Theologie, 3. Praktische Theologie, 4. Polemische Theologie, 5. Historische Theologie. Bei den Partitiones theologicae handelt es sich nicht in dem Sinne um eine Enzyklopädie, die auch in materieller Hinsicht das gesamte Bildungsgut zur Darstellung zu bringen hat. Das geschieht bei Gessner nur in bibliographischer Form. Insofern ist sein Werk keine Realenzyklopädie, sondern eine systematische Enzyklopädie. Ihr Zweck wird dadurch erreicht, dass der Umfang der theologischen Disziplinen abgegrenzt, gegliedert und bibliographisch aufgefüllt wird. In dieser Form ist Gessners Werk eine theologisch-wissenschaftliche Tat allerersten Ranges und behauptet einen einsamen Ehrenplatz in der Geschichte der theologischen Enzyklopädie. (Autoreferat) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Théodoridès,J. | Gessner et la Zoologie: les Invertebre's. | 111,472AR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesner a étudie' les Invertebre's
dans son ouvrage sur les animaux aquatiques (1558), dans le Nomenclator
aquatihum animantiam (1560) qui le complète et dans le De scorpione
jomt à son ouvrage posthume sur les serpents (1587).
En outre, des matériaux concernant les insectes recueillis par Gesner ont été' utilisés par Th. Moufet dans son Insectorum... theatrum (1634). Pour ce qui est des Invertebrés marins, Gesner distinguait 5 ordres (De Mollibus, De Crustatis, De Testaceis, De Insectis marinis, De Zoophytis marinis) correspondant assez bien aux cinq groupes d'Anaima d'Aristote. S'il eut le mérite de grouper ensemble les principaux types d'Echinodermes et de rapprocher l'argonaute des autres Ce'phalopodes, Gesner ignorait la morphologie interne des espèces étudiées et leurs affinités naturelles (l'hippocampe qui est un poisson est classé avec des Annelides et des Crustacés!). Quant aux scorpions, il croyait ä l'existence d'espèces ailées. L'iconographie des Invertebrés donnée par Gesner est passée en revue: certaines figures sont excellentes, d'autres très médiocres. Gesner reste un homme de son époque pour le meilleur et pour le pire, mais on reste confondu d'admiration devant l'immense labeur d'un homme disparu avant la cinquantaine. (Autoreferat) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fischer,H. | Der Arzt Conrad Gessner (1516-1565). | 111,472-473AR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conrad Gessner hatte als Archiater (Oberstadtarzt)
Zürichs neben seiner grossen literarischen und naturwissenschaftlichen
Tätigkeit und neben seiner Lehrtätigkeit am Carolinum die schwere
Aufgabe der Überwachung des Gesundheitsdienstes in einer Zeit, in
welcher die Stadt von schweren Seuchenzügen, Pest und pestähnlichen
Epidemien, Dysenterien, Malaria heimgesucht wurde. Der Pest stand man machtlos
gegenüber. Zürich mit damals etwa 7000 Einwohnern wurde durch
die Seuchen der Jahre 1564 und 1565 auf die Hälfte reduziert. Gessner
selbst wurde mit 49 Jahren durch die Pest dahingerafft.
Wie fast alle Ärzte der Renaissance war auch Gessner der hipokratisch-galenischen Medizin verpflichtet: die Wiedergeburt der Antike führte auch in der Medizin zur Herausgabe antiker Ärztetexte auf Grund griechischer Handschriften, die von Byzanz kamen und in der Ursprache oder in Latein im Druck herausgegeben wurden. Gessner war an dieser reichen editorischen Tätigkeit durch die Prolegomena zur grossen Frobenschen Galenausgabe in Basel in hervorragender Weise beteiligt. Die Editionen antiker Ärzte sollten nach Gessners Auffassung in erster Linie dazu dienen, der Medizin eine wissenschaftliche Grundlage zu geben, die im Wust und Aberglauben mittelalterlicher Medizin längst verloren gegangen war. Gessner ging über die meisten seiner Zeitgenossen dadurch hinaus, dass er, besonders in der Therapie, den Grund zur modernen naturwissenschaftlichen Medizin legte. War er auch vielfach noch der galenischen Arzneimittellehre verpflichtet, so lag sein Bestreben darin, den antiken Arzneischatz nicht nur in den Werken der Antike, eines GALEN oder eines DIOSCORIDES kennenzulernen, sondern er wandte sich der einheimischen Pflanzenkenntnis in ganz umfassender Weise zu. Um die therapeutischen Eigenschaften der einheimischen und auch fremdländischer Gewächse ganz unmittelbar zu erfahren, machte er in umfassender Weise vom Selbstversuch, vom Tier~ ersuch und von der klinischen Prüfung Gebrauch. Damit wurde Gessner der Begründer der experimentellen Pharmakologie. Seine Versuche sind nicht systematisch zusammengefasst, aber im wissenschaftlichen Briefwechsel, soweit dieser erhalten ist, eindeutig nachweisbar. Dass es dabei auch zu Selbstvergiftungen kam, zum Beispiel mit Helleborus niger (Christrose) und dem Tabakblatt, ist eindeutig belegt. Durch vielseitige Anwendung und Erweiterung der von den Arabern eingeführten Destillationsverfahren (Gessner nennt in erster Linie den bedeutenden «Chemiker» GEBER (gest. 776)) versuchte Gessner zu einer weitgehenden Reinigung der Arzneimittel zu gelangen, wobei flüchtige Stoffe, wie ätherische Öle, zyanhaltige Produkte, Senföle, flüchtige Alkaloide usw. auf diesem Wege in gereinigter und angereicherter Form gewonnen werden konnten. Gessner hat seine Darstellungsverfahren in dem Thesaurus evonymi philiatri (erstmals 1552, dann in weiteren zahlreichen Ausgaben und Übersetzungen) seinen Kollegen in liberalster Weise zur Verfügung gestellt. Gessner hatte an der grossen geistigen Bewegung der Renaissance in reichem Masse Anteil. Bei Gessner war die Liebe zum Altertum, das er als primäre Erkenntnisquelle auch in der Medizin anerkannte, mit dem Drang zur unmittelbaren realen Erfahrung durch Beobachtung der Natur verbunden. Sein Ziel war nicht die Wiederholung der Antike, sondern die mit Hilfe antiker Erfahrung aus der Beobachtung gewonnene induktive Erkenntnis. In dieser Hinsicht dürfen wir in Gessners klarer, auf das einzelne Objekt gerichteter, durch keine spekulative Theorien belasteter Forschungsarbeit, wie sie uns in seinem unvollendeten Pflanzenwerk am eindrücklichsten entgegentritt, einen Anfang der von Francis Bacon zu Beginn des 17. Jahrhunderts philosophisch begründeten induktiven Forschungsmethode erblicken, welche auch heute Medizin und Naturwissenschaft als führende Methode beherrscht. Das alles erregt unsere Bewunderung für Conrad Gessners unerhört grosse Leistung, die heute noch kaum übersehen werden kann und einer umfassenden Darstellung harrt. Was uns noch stärker bewegt, ist seine durch alles Wissen und Können hindurch spürbare Menschlichkeit, ist seine unbegrenzte Hilfsbereitschaft, sein psychologisches Verständnis dem Epileptiker und Geisteskranken gegenüber, seine Freundestreue, seine grosse Sorgfalt und Genauigkeit in der Behandlung der bei ihm Heilung Suchenden, ist sein Verantwortungsbewusstsein in literarischer und menschlicher Hinsicht, ist sein unermüdlicher, fast übermenschlicher Fleiss, ist seine echte, einfache, auf Zwinglis Protestantismus gegründete Frömmigkeit. All dies macht ihn zum grossen Menschen und Arzt. (Autoreferat) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Witmer,R. | Aktuelle Forschungsprobleme der Zürcher Augenklinik. | 111,473-474AR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einer Universitätsklinik stehen für
die klinische Forschung verschiedene Möglichkeiten offen. Die morphologische
Beobachtung der Krankheitsbilder ist mit ständig verbesserten Methoden
immer wieder aktuell. In der therapeutischen Forschung ist die Chirurgie
am spektakulärsten, in der Ophthalmologie zum Beispiel die Chirurgie
der Hornhaut (Keratoplastik) und der Netzhaut.
- Die klinisch-pharmakologische Therapie eröffnet andere Aspekte klinischer Forschung. Die dritte, vielleicht wichtigste Möglichkeit ist die pathogenetische Forschung. Sie ist wenig spektakulär, erfordert viel Geduld und Ausdauer. Aus ihr ergeben sich aber unter Umständen Richtlinien für die Therapie und - was vielleicht noch wertvoller ist - für die Prophylaxe. Aus Tradition wird an der Zürcher Klinik seit Vogt und Amsler die Netzhautablösung (Amotio retinae) und die endogene Entzündung des Auges (Uveitis) bearbeitet. 1. Die endogenen Entzündungen der Uvea fassen wir als Reaktion des Auges gegenüber einem Fremdstoff oder Antigen (Bakterien, Virus) auf. Klinische Bilder ergeben aber nur in den seltensten Fällen pathogenetische oder ätiologische Hinweise. Die neu entwickelte Fluoreszenzphotographie des Augenhintergrundes gibt wertvolle diagnostische Hinweise durch Darstellung der Gefässe in der arteriellen und venösen Phase, Aufdeckung von Durchblutungsstörungen und Anfärbung exsudativer Prozesse. Als mögliche Ursachen der endogenen Entzündung des Auges werden Streptokokken-Infektionen, Tuberkulose, Leptospirosen oder eventuell auch Autosensibilisierung angenommen. Quantitative serologische Untersuchungen erlauben in einigen Fällen die Diagnose einer spezifischen Erkrankung (Film). Experimentell hat Frl. Dr. Martenet gezeigt, dass eine Herpesinfektion an einem Auge beim Kaninchen eine heftige vordere Uveitis verursacht. Nach etwa 10 Tagen erkrankt das zweite Auge an einer hinteren Uveitis, selbst dann, wenn das erstinfizierte Auge nach wenigen Tagen entfernt wurde. Handelt es sich um eine spezifische, endogene Infektion im zweiten Auge, oder ist es eine Immunerkrankung? Wir wissen es noch nicht. Ferritin, ein Abbauprodukt des Hämoglobins, kann, ins Auge des Kaninchens injiziert, Entzündungen der Aderhaut hervorrufen. Elektronenmikroskopisch findet man dieses Antigen in Makrophagen. Diese sind ihrerseits umgeben von Lymphozyten und Plasmazellen, die als Produktionsstätte von Antikörpern in Frage kommen. Warum so viel Aufwand um die Abklärung der Uveitis? Die Statistik zeigt, dass sie an der Spitze aller Erblindungsursachen, nicht nur bei Erwachsenen, sondern auch bei Kindern steht. 2. Das zweite grosse Thema unserer klinischen Forschung ist die Netzhautablösung. Statistisch ist in den letzten Jahren eine deutliche Zunahme der Amotio nachweisbar. Ein Grund mag die Überalterung der Bevölkerung sein; sie allein aber erklärt die Zunahme um 40 % nicht. Um so mehr interessiert deshalb die Pathogenese dieses schweren Leidens. In den meisten Fällen ist die Ursache der Amotio ein Netzhautriss, der zur Lösung des Sinnesepithels vom Pigmentepithel führt. Im sub-retinalen Raum sammelt sich pathologische Flüssigkeit an, die während der Operation gewonnen und untersucht werden kann. Elektrolyte und Proteine zeigen keinen Unterschied gegenüber dem Serum. Jedoch scheint die Enzymaktivität (Lactatdehydrogenase) in der subretinalen Flüssigkeit um so stärker zu sein, je länger die Amotio besteht. Eine sehr starke Erhöhung dieser Enzymaktivität wurde in Ablösungen gefunden, die durch einen Tumor der Chorioidea bedingt sind. Elektronenmikroskopische Untersuchungen der Glaskörper-Netzhaut-Grenzschicht (Dr. GÄRTNER) zeigten eine Auflockerung der Basalmembran als senile Veränderung. An Stellen zystischer Degenerationen der Retina kommt es zu Fibrillenvermehrung und Adhärenzen, die eventuell zu Rissbildung führen können. Die Therapie der Netzhautablösung ist nur operativ. Durch Verbesserung der Technik konnten die Resultate in den letzten zehn Jahren wesentlich verbessert werden (von 63 % auf 77 % Heilungen); auch die Hospitalisationsdauer konnte von durchschnittlich 6 Wochen auf die Hälfte reduziert werden. prophylaktisch können gefährliche Degenerationen der Netzhaut unblutig, durch die sogenannte Lichtkoagulation, behandelt werden. Ein Kurzfilm erläutert deren Technik. (Autoreferat) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bosshard,H.H. | Aspekte der Alterung an Waldbäumen. | 111,474AR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Von den möglichen Alterungserscheinungen
in Waldbäumen werden nur zeitabhängige Veränderungen im
Kambium und Xylem herausgegriffen. Ausgehend von zwei Grundsätzen
der allgemeinen Gerontologie, dass erstens nämlich die Alterung die
mehrzeiligen Organismen betrifft und hier auf die funktionelle Teilung
in somatische und in zur Reproduktion befähigte Zellen zurückzuführen
ist
und dass zweitens nur dann von eigentlicher Alterung gesprochen werden kann, wenn ihre Merkmale alle Individuen betreffen, endogener Natur und progressiv sind und schliesslich zum Tod des Organismus oder der betrachteten Einheit führen, werden primäre und sekundäre Alterungseffekte unterschieden. Primäre Merkmale, die den oben genannten Voraussetzungen entsprechen, können in der Nekrobiose der Holzgewebe beobachtet werden, wobei die vorhandenen Unterschiede zwischen Festigungs-, Leit- und Speichergewebe durch die Funktionsaufteilung bedingt und nur graduell sind. Die Kernholzbildung, welche in der Regel in allen Holzarten früher oder später einsetzt, wird als Auswirkung der Baumalterung bezeichnet, unabhängig, ob das Kernholz hell oder dunkel gefärbt ist. Als Ausgangspunkt dieses Alterungsphänomens muss der Verlust der Teilungsfähigkeit der Zellkerne im Xylem gelten, was einer Qualitätsänderung der Zelle gleichkommt. Aus diesem Grunde werden die primären Merkmale der zeitabhängigen Veränderungen im Xylem als qualitative Alterung bezeichnet. Zu den sekundären Merkmalen gehören im Xylem Veränderungen der Zell-Längen und der Zellwanddicken. Darin widerspiegelt das Holz die Kambiumtätigkeit, indem es gleichermassen eine zeit-getreue Bildfolge davon gibt. - Im Kambium selber sind wiederum Dimensionsänderungen und ferner eine Verlangsamung des Teilungsrhythmus festzustellen, beides Merkmale, die eine quantitative Alterung kennzeichnen. Dabei ist allerdings zu beachten, dass durch diese Effekte keineswegs die Reproduktionskraft des Kambiums verloren geht, so dass das Kambium eigentlich als zeit-unabhängig bezeichnet werden muss. Dahin weisen auch Modifikationen des Bildungsgewebes innerhalb seiner ontogenetischen und phylogenetischen Entwicklung. (Autoreferat) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steubing,Lore | Neue Entwicklungstendenzen in der Pflanzenökologie. | 111,475AR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Ökologie gewinnt in dem Masse an
Bedeutung, wie der Bedarf der Menschheit an Wohnraum, Rohstoffen und Energie
zu immer umwälzenderen Eingriffen in die Landschaft und ihrer Biozönosen
führt. Hierdurch kann es zu erheblichen Störungen im Lebenshaushalt
(«oikos») der Organismen kommen. Aufgabe des Pflanzenökologen
ist es nun, die Einwirkung und Veränderung von Aussenfaktoren auf
die Vegetation zu untersuchen, z. B. die Bedeutung von Wasser (Niederschlag,
Be- und Entwässerung des Bodens), Wärme, Licht, von chemischen
(Mineralstoffversorgung, Luftverunreinigung) und mechanischen Faktoren
(Wind, Lawinen, Mahd) experimentell zu prüfen. Voraussetzungen für
solche Arbeiten sind ausreichende systematische, pflanzensoziologische
und physiologische Kenntnisse, sowie die immer dringender werdende Handhabung
moderner chemischer, physikalischer und mikrobiologischer Methoden.
Neuerdings konzentriert sich die pflanzenökologische Forschung vor allem auf 3 Problemkreise: 1. Studium von Stoffkreisläufen. 2. Erfassung der Primär- und Sekundärproduktion von Pflanzenassoziationen oder Ökosystemen. 3. Verfolgung des Energieflusses und der Energieverteilung. Vielfach bieten autökologische Arbeiten hierbei die Grundlage für die heute besonders aktuellen synökologischen Experimente, bei denen nicht die Einzelpflanze, sondern eine bestimmte Pflanzengesellschaft oder ein bestimmter Lebensraum (Ökosystem) analysiert werden. (Autoreferat) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eiberle,K. | Forstliche Probleme der Wildkunde. | 111,475AR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Aufgaben, die der Schweizer Wald erfüllt,
sind so vielseitig, dass er nicht nur im Hinblick auf die Holzerzeugung,
nicht allein als Schutz- oder Erholungswald, ausschliesslich als Jagdrevier,
Tierschutzareal oder als schützenswertes Landschaftselement gepflegt
werden kann. Der Wald vermag jedoch seine zahlreichen Funktionen dort dauernd
und wirksam zu erfüllen, wo die natürlichen Beziehungen zwischen
Pflanzen- und Tierleben nicht durch einseitige Baumartenwahl, schematische
Wirtschaftsmethoden oder überhegte Schalenwildbestände gestört
werden. Die durch Verbiss, Fegen und Schälen verursachte Beeinträchtigung
der Waldentwicklung schädigt nicht die forstliche Produktion; sie
wirkt sich namentlich dort verhängnisvoll aus, wo unter dem Einfluß
des Wildes widernatürliche Waldformen entstehen, die langfristig auf
den Naturhaushalt und auf die Widerstandskraft der Wälder gegen Naturgefahren
nachteilig einwirken. Hirsch- und Rehwild sind zudem in der Lage, ihre
eigene Lebensgrundlage derart ungünstig zu beeinflussen, dass in überhegten
Kulturrevieren grosse Hungersterben unter dem Wild schon öfters in
Erscheinung traten. Die zunehmende Intensität der Wildschäden
im Walde lässt sich auf zahlreiche Kultureinflüsse zurückführen.
Die Meliorationen haben manche Landschaftselemente beseitigt, welche als
Bestandteil eines optimal gestalteten Lebensraumes für das Wild unentbehrlich
sind. Zudem wurde die freie Bewegungsmöglichkeit der Wildtiere durch
Verkehrsanlagen und durch die grossen Siedlungsräume stark eingeschränkt.
Bär, Wolf und Luchs, die natürlichen Regulatoren der Schalenwildbestände,
sind in unserem Lande schon längst vernichtet. Die Jagdgesetze haben
wohl mit der Schaffung von Banngebieten und mit einem sehr weitgehenden
Schutz des weiblichen Wildes und seiner Jungtiere die Schalenwildbestände
beträchtlich vermehrt, aber die Jagd vermochte die Funktionen des
Grossraubwildes weit weniger wirksam zu erfüllen. Die Jagd sah lange
Zeit das Ziel der Hege in der zahlenmässigen Zunahme des Rot- und
Rehwildes, und sie arbeitete damit gerade so einseitig-zweckgebunden in
der Lebensgemeinschaft des Waldes wie früher der Forstmann mit den
Nadelbäumen. Die Wildschadenverhütung wurde bis anhin vor allem
mit technischen Massnahmen angestrebt, d.h. mit Zäunen und mit chemischen
oder mechanischen Vorkehrungen. Die Erfahrung lehrt jedoch, dass damit
keine harmonischeren Beziehungen zwischen Wald und Wild geschaffen werden
können. Je umfangreicher sie verwendet und benötigt werden, um
so mehr verdrängen wir das Wild aus jenen Örtlichkeiten, wo es
normalerweise seine Äsungs- und Wohnaktivität am häufigsten
ausübt. Es wird dann gezwungen, auf der übrigen Waldfläche
nicht nur Ersatz zu suchen, sondern die weniger günstigen Lebensmöglichkeiten
um so intensiver auszunützen.
Die Abwehr der Wildschäden wird künftighin auf die Anwendung biologisch sinnvoller Massnahmen angewiesen sein, wozu die moderne Wildkunde schon zahlreiche Hinweise zu geben vermag. Das Leben von Hirsch und Reh konzentriert sich trotz ihrer stetigen Bestandeszunahme immer mehr auf den Wald. Diese Tiere vermögen aber nur einen kleinen Teil der Waldfläche ihren Ansprüchen dienstbar zu machen, so dass die Zahl des Wildes derart begrenzt werden sollte, dass eine ununterbrochene Beanspruchung der günstigsten Landschaftsteile vermieden werden kann. Jede Überhege beim Schalenwild senkt auch die Widerstandskraft der Tiere. Der Versuch, diesen Qualitätsrückgang an ganzen Wildbeständen zu erfassen, erweist sich als notwendig, wenn die Gegenmassnahmen nicht dauern zu spät ergriffen werden sollen. Die Bedeutung der Landschaftsstruktur und der Landschaftspflege für das Wildtierleben kennen wir nur für das Allgemeingültige. Wertvoll sind daher besonders jene wildkundlichen Untersuchungen, die sich auf unsere Landschaftstypen und auf jene Wildarten beziehen, die nicht in allen Lebensäusserungen an den Wald gebunden sind. Die Verteilung des Wildes in der Landschaft beeinflusst in hohem Masse die Wildschäden. Überall dort, wo hinreichend klare Vorstellungen darüber bestehen, in welcher Weise die mikroklimatischen Besonderheiten des Geländes, die Äsungsflächen und die Vielzahl unterschiedlichster Waldformen das Wild an bestimmte Örtlichkeiten zu binden vermögen, da vermag die Waldwirtschaft der natürlichen Lebensweise des Wildes auch dann Rechnung zu tragen, wenn der Schutz des Jungwaldes besonders dringlich ist. Die Wildkunde hat uns auch gelehrt, dass sich die ernährungsphysiologischen Eigenheiten des Wildes von denen der Haustiere stark unterscheiden. Diese Unterschiede müssen viel stärker als bis anhin beachtet werden, wenn die künstlichen Fütterungsmassnahmen den Ansprüchen des Wildes an die Bekömmlichkeit und Verwertbarkeit des Futters entsprechen und gleichzeitig eine wildschadenprophylaktische Wirkung erzielt werden sollen. Das Studium des soziologischen Verhaltens der Wildtiere und ihrer Populationsdynamik unter dem Einfluss der natürlichen Auslese vermittelt naturgesetzlich fundierte Hinweise für die zweckmässige Gliederung, Stärke und Dauer der notwendigen Abschüsse. Auch die Pflanzenwelt beteiligt sich aktiv am Wildschaden-geschehen, da sowohl die Intensität der Schäden als auch die Regenerationskraft der forstlich wichtigen Baumarten in hohem Masse von der Wahl des Pflanzenmateriales, von Boden und Klima abhängen. Diese Zusammenhänge sind leider noch kaum erforscht, obschon sie für die forstliche Praxis sehr bedeutsam wären. Die biologisce Wildschadenverhütung bildet zwar ein spezifisch forstliches Anliegen. Die Waldwirtschaft ist aber dazu auf die Mitarbeit verschiedenster Forschungsrichtungen angewiesen, so dass Fortschritte auf diesem Gebiet nur in dem Masse zu erwarten sind, als es gelingt, alle Zweige der ,wildkundlichen Forschung zu fördern. Die Besinnung auf das Natürliche muss wegleitend sein, wo es darum geht, Wild und Landschaft im Gleichgewicht zu halten. (Autoreferat) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schouten,J.F. | Verhalten, Modell und Physiologie. | 111,477AR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wer einen Personenwagen «verstehen»
will, kann auf zwei verschiedenen Arten vorgehen. Er kann den Wagen teilweise
oder ganz auseinandernehmen, wodurch er einen Eindruck der Struktur und
der gegenseitigen Funktion der verschiedenen Teile gewinnt. Oder er setzt
sich in den Wagen und probiert was passiert, wenn er die verschiedenen
Knöpfe, Fusshebel usw. betätigt.
Die Forschung, namentlich die der lebendigen Natur, geht ähnlich vor. Die erste Methode entspricht Anatomie und Physiologie, die zweite der Verhaltensforschung. Beide Methoden sind gleichberechtigt. Die Geschichte lehrt uns, dass manchmal die erste, manchmal die zweite am schnellsten zum Ziele führt. Ein Modell, sei es begriffsmässig, mathematisch oder materiell, verwenden wir um Rechenschaft über experimentelle Befunde abzulegen. Abgesehen von Strukturmodellen (Maketten) sind Funktionsmodelle ausserordentlich wichtig. Auch die Simulierungen von bestimmten Vorgängen durch Rechenmaschinenprogramme sind als Modelle zu betrachten. Das Verhalten lebendiger Wesen ist aus dem Verband zwischen Reiz und Reaktion festzustellen. Sowohl Reiz wie Reaktion sind naturwissenschaftlichen Messmethoden zugänglich. Beim Menschen kommt ausserdem noch eine äusserst wichtige Informationsquelle dazu. Er hat nämlich die Fähigkeit, sich seiner Wahrnehmungen und Gedanken bewusst zu sein. Er kann aussagen, dass er nebst Helligkeit auch Farbe, nebst Grösse auch Tiefe sieht, dass er einen scharfen Ton aus einer bestimmten Richtung hört, dass er etwas Herbes riecht oder Saures schmeckt, dass ihm der Magen schmerzt usw. Viel schwieriger ist es bei einem Tier oder einem Baby die Fähigkeit zu Wahrnehmungen durch Verhaltensforschung (Reiz, Reaktion, Verbände) festzustellen. Diese introspektiven Aussagen sind «>objektiv». Dennoch sind sie für die Psychophysik interessant. Es werden eigene Beispiele bezüglich Farbensehen, Klangempfindung, Bewegungssehen usw. gegeben. Bei Wahrnehmungen führen die Sinnesorgane dem Gehirn Meldungen zu, und diese werden je nach Anlage und Lebenserfahrung interpretiert. Manche Sinnesmeldungen wären an sich falsch, verzerrt, unvollkommen usw., wenn nicht das Individuum seine Interpretation fortwährend überprüfte. So gelingt es ihm, aus diesen Meldungsfetzen ein annähernd gutes Bild der Aussenwelt zu formen. Manche Sinnestäuschungen sind darauf zurückzuführen, dass die Interpretation, die in üblichen Wahrnehmungsumständen gerade die richtige ist, in nicht üblichen Wahrnehmungs-Umständen versagt. Diese Fälle der Fehlinterpretation sind von grösster Wichtigkeit für die psychophysische Forschung. Verhaltensforscher, Psychophysiker, Physiologen und Modellbauer gehen verschieden vor; aus ihrer Zusammenarbeit aber sind die wichtigsten neuen Ergebnisse zu erwarten. (Autoreferat) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verschiedene | Buchbesprechungen | 111,479-488 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| René Hantke
H. Fischer E.A.Thomas Albret Pfluger W. Nowacki Reinhard Bachofen Karl Mühlethaler J. Odermatt
E.A.Thomas
|
Andreánszky, G.: On the Upper Oligocene
Flora of Hungary 479
Bamberger Rechenbuch 1483, Faksimiledruck 479 Beger, H.: Leitfaden der Trink- und Brauchwasserbiologie 480 Behnke, H. und Kopfermann, K.: Festschrift zur Gedächtnisfeier für Karl Weierstrass 480 Burckhardt, J. J.: Die Bewegungsgruppen der Kristallographie 481 Frey-Wyssling, A. und Mühlethaler, K.: Ultrastructural Plant Cytology 481 Kaja, H.: Elektronenmikroskopische Untersuchungen über die Struktur der Chloroplasten einiger niederer Pflanzen 482 Kalmus, Hans, M. D.: Genetik. Ein Grundriss 482 Kauffman, George B.: Alfred Werner, Founder of Coordination Chemistry 483 Kraut, H. und Meffert, Maria-Elisabeth: Über unsterile Grosskulturen 483 Kühn, Alfred: Grundriss der allgemeinen Zoologie 484 Landolt, Elias: Geschützte Pflanzen im Kanton Zürich 484 Leibundgut, H.: Die Waldpflege 484 Marsden, Philip: Das Wellensittich-ABC 485 Meyer, Kurt: Amanz Gressly, ein Solothurner Geologe 485 Naef, Robert: Der Sternenhimmel 1967. Kleines astronomisches Jahrbuch für Sternfreunde 486 Pólya, Georg: Vom Lösen mathematischer Aufgaben; Einsicht und Entdeckung, Lernen und Lehren 487 Thorarinsson, 5.: Surtsey; Geburt einer Vulkaninsel im Nordmeer 488 Van der Waerden, B. L.: Die Anfänge der Astronomie 488 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frey,F. | Geologie der östlichen Claridenkette. | 1:1-287 (Heft1) |
| Résumé
Cette étude représente le résultat de recherches géologiques entreprises dans la partie orientale de la chaîne des Clariden (Cantons de Clans et d'Uri). On distingue, dans la haute vallée de la Linth, quatre unités majeures (Taf. I): 40 La nappe helvétique maîtresse ou bien l'ensemble des nappes helvétiques Glaronnaises. 3 les éléments subhelvétiques. 2~ les masses glissées du Flysch et des schistes. 10 la couverture sédimentaire des massifs hercyniens externes. 1. La couverture sédimentaire des massifs Le raccord stratigraphique des terrains sédimentaires posthercyniens avec leur soubassement cristallin, houiller et permien n'est conservé que pour les couches les plus anciennes, le Trias et le Jurassique moyen. Le Jurassique supérieur, le Crétacé et le Nummulitique sont plus ou moins décollés, écaillés et pincés dans leur couverture de schistes à Globigérines. La plupart des écailles de la couverture autochtone/parautochtone consistent en calcaires du Jurassique supérieur. Il est très difficile d'y établir une stratigraphie, la tectonique presque souple des calcaires, la dolomitisation structurale et le clivage ayant effacé ou même détruit la succession originale. Du Sud au Nord l'épaisseur des terrains crétaciques décroît. Cette décroissance due à une érosion anté-éocène ou éocène précoce n'est pas tout à fait régulière à cause d'un léger plissement antélutétien. Une série plus complète du Crétacé, limitée au flanc inverse d'une petite écaille, est décrite (Altenorenstock). ARN. HEIM (1908b) et J. BOUSSAC (1912) ont démontré, dans leurs études classiques, que la transgression du Nummulitique fut oblique par rapport aux lignes isopiques du Crétacé. Au Kistenpass le Nummulitique commence par des dépôts de la partie moyenne de l'Eocène moyen. Aux alentours de la cabane des Clarîden, les couches du même âge sont assez réduites, tandis que les grès quartzitiques et marneux de la partie supérieure de l'Eocène moyen atteignent des épaisseurs considérables. Au Sud de Linthal c'est en général la partie supérieure de l'Eocène moyen qui est transgressive. Par endroits, des calcaires bleu foncé, stériles et à grain très fin, avec de minces rubans gréseux et siliceux, ont été découverts à la base des grès quartzitiques grossiers du Nummulitique. Par endroits, les schistes à Globigérines passent vers le haut à une alternance de schistes marneux et de grès calcaires micacés à granoclassement vertical. Cette mince série peut être comparée à la série plus épaisse du Kistenstôckli et aux couches clastiques se trouvant dans le toit des schistes à Globigérines de la série du Blattengrat. La relation des écailles parautochtones avec leur substratum n'est guère établie. On a même de la difficulté à préciser la continuation des différents éléments tectoniques, car la stratigraphie du Jurassique supérieur n'y est pas encore débrouillée. II. Les masses glissées du Flysch et des schistes crétacés et nummulitiques Pour la zone du Flysch et des schistes sous les éléments 'helvétiques et subhelvétiques, ARN. HEINI (1908b) a proposé le terme de «Glarner Flysch». Les différents étages que ARN. HFIM y avait reconnus, se sont révélés depuis longtemps, au moins pour les deux étages supérieurs, comme des unités tectoniques indépendantes. Les recherches de J. OBERHOLZER (1933) et surtout celles de G. STYGER (1961) ont démontré que l'unité la plus basse du «Flysch Glaronnais», le «système des grès et des ardoises», est écaillée; en effet, les écailles méridionales plongent, vers le Nord, sous des masses plus récentes. Aussi les formations des grès et des ardoises ne peuvent elles guère représenter la couverture stratigraphique normale des schistes à Globigérînes de la couverture autochtone/parautochtone. La partie principale de la zone des schistes du versant oriental de la chaîne des Clariden est attribuée au complexe du Blattengrat. Elle se trouve dans la même position tectonique que les écailles du Blattengrat. Ses calcaires à Nummulites viennent de la même zone de faciès que ceux des éléments inférieurs du Blattengrat. Les schistes à Globigérines de la série du Blattengrat subissent, vers le haut, un changement de faciès. Dans les schistes marneux s'intercalent des lames gréseuses àgrain fin, puis des minces lits de grès calcaires micacés Vers le haut, le matériel détritique devient plus important. C'est dans cette alternance plus ou moins régulière de schistes marneux, d'ardoises et de grès calcaires mîcacés que se trouvent des assises et des lentilles de schistes conglomératiques par endroits assez grossiers. Dans la partie supérieure de la série où alternent des grès calcaires micacés et des schistes marneux, apparaissent les premiers fragments de roches volcaniques basiques, débris qui sont les éléments constitutifs des grès de Taveyannaz. Une combinaison des critères sédimentologiques et pétrographiques a démontré que la composition pétrographique des grès de Taveyannaz n'a guère de valeur stratigraphique; elle est plutôt caractéristique du faciès. Le changement de faciès se produit dans la série de Taveyannaz dans la même direction que celle indiquée par les marques des courants, c'est à dire du Sud-Ouest vers le Nord-Est ou bien du WSW vers le ENE. La série de Taveyannaz passe vers le haut à une alternance de grès du Flysch et d'ardoises. Les recherches dans cette série puissante sont encore assez incomplètes. Seules des études détaillées dans la basse vallée du Schächen et dans la vallée du Sernf pourraient nous renseigner sur la stratigraphie et la tectonique de ce terme du Flysch. Puisqu'un raccord stratigraphique existe entre les schistes à Globigérines et la série de Taveyannaz, il fallait discuter la position originale des calcaires à Nummulites du type Einsiedeln. Il en résulte que les éléments inférieurs du Malor sont probablement d'origine helvétique moyenne, correspondant, plus ou moins, à la série crétacique comprise dans la nappe de l'Axen. Le bord méridional du domaine des grès à débris de roches volcaniques se trouvant plus au Sud qu'on l'admettait jusqu'ici, les éléments du «système des grès et des ardoises» ont dû glisser sur une distance assez considérable pour atteindre leur position actuelle. Intercalées dans l'alternance plus ou moins régulière de grès calcaires micacés et de schistes marneux superposée aux schistes à Globigérînes de la série du Blattengrat, se trouvent des lentilles d'un «Wildflysch» (Flysch de l'Altenoren) dont la position reste assez douteuse. En ce qui concerne la composition lithologique de ce Flysch de l'Altenoren, les quartzites clairs, les cailloux et les galets exotiques ainsi que les brèches polygéniques peuvent être comparés aux dépôts assez réduits de la partie occidentale du Flysch du Sardona. Ainsi donc, il n'est pas exclu qu'il s'agisse de lambeaux charriés du Flysch du Sardona. Mais seuls des fossiles pourraient prouver cette hypothèse. III. Les éléments subhelvétiques
de la chaîne des Clariden
Tektonische Übersicht
Da sich westlich der Linth die Bremswirkung des spätalpin aufsteigenden Aarmassivs weit stärker bemerkbar gemacht hat als im Osten, verläuft die Untergrenze der helvetischen Hauptschubmasse beidseits des Linthtales nicht im gleichen tektonischen Niveau. Während im Osten die Abfolge der Elemente in helvetischer Stellung mit der nordhelvetischen Glarner-Decke beginnt, setzt das helvetische Deckenpaket am Klausenpass erst mit der mittelhelvetischen Axen-Decke ein. Wohl haben späte Bewegungen des Aarmassivs die Überschiebungsfläche der helvetischen Decken nachträglich noch steilgestellt, lokal im östlichen Berner Oberland sogar überkippt. P. ARBENZ (1912:114, 118; 1913: 20) und P. NIGGLI (1912:16 Anm. 1) haben jedoch mit aller Deutlichkeit darauf hingewiesen, dass eine Aufwölbung des Aarmassivs schon die vorgleitenden Decken beeinflusst haben muss. Während östlich der Linth die tieferen helvetischen Elemente lediglich aus ihrer Vorschubrichtung abgedreht worden sind, hat das allmählich aufsteigende Aarmassiv die vorrückenden helvetischen Decken westlich der Linth lange Zeit abgebremst, bis schliesslich die nach-drängende helvetische Hauptmasse die steckengebliebenen Stirnabschnitte überwältigt und weit überfahren hat (R. STAUB, 1954, 1961). Die von der helvetischen Hauptmasse abgetrennten und überfahrenen alten Frontalpartien bauen heute die Claridenkette auf; sie zeigen einen völlig anderen Baustil als die im Verband mit der helvetischen Hauptmasse vorbewegten, in helvetischer Stellung verbliebenen Frontabschnitte östlich der Linth. Im hinteren Linthtal können wir somit vier tektonische
Stockwerke unterscheiden (Taf. 1):
I. Über die herzynisch verfalteten Gesteine der Kristallinaufbrüche der Sandalp und des Limmernbodens legt sich der autochthon/parautochthone Sedimentmantel. Nur die altmesozoischen Schichtglieder (Trias bis Dogger) befinden sich noch einigermassen im Verband mit ihrer kristallinen und jungpaläozoischen Unterlage. Jungmesozoische und alttertiäre Anteile der Sedimentbedeckung des nördlichen Aar- und des Erstfeldermassivs sind in eine ganze Anzahl von Schuppen aufgegliedert und in ihre eigene Globigerinenschieferhülle vorgeschoben worden. Über der Tierfehd-Aufwölbung folgen in den jähen Flanken beidseits des Limmerntobels und am Vorder-Selbsanft die Limmern-Schuppen, deren westliche Fortsetzung die Elemente der Zuetribistock/Spitzalpelistock-Kette sowie die mächtige Scholle des etwas weiter zurück gelegenen Tödi bilden. II. Im St. Galler Oberland und im östlichen Glarnerland erreichen die unter der «helvetischen Hauptüberschiebung» liegenden, in einer Frühphase vorgeglittenen Schiefer- und Flyschbildungen gewaltige Ausmasse. Während die beiden höheren Stockwerke des sogenannten «Glarner Flysches», der Sardona-Flysch und der Blattengrat-Komplex, schon östlich des Panixerpass-Querschnittes an Mächtigkeit verlieren, ist das tiefste Stockwerk des «Glarner Flysches», der Sandstein / Dachschiefer- Komplex, noch massgebend am Bau der Hausstockgruppe, aber auch der Berge südlich des Schächentales beteiligt. Im Dache des in einzelne Gleitbretter aufgelösten Sandstein/Dachschiefer- Komplexes findet sich westlich des Linthtales ein meist nur schmales Band von Tertiärschiefern und Nummulitenbildungen. Mit völlig vergleichbarem Tertiär steht die südlichste Digitation des Sandstein/Dachschiefer-Komplexes am Malor in normalstratigraphischer Verbindung. Die zum Blattengrat-Komplex gerechneten Schiefer- und Nummulitenbildungen am Ostabfall der Claridenkette befinden sich in einer tektonischen Stellung, die jener der Schuppen des Blattengrates durchaus entspricht. Sie entstammen der gleichen Fazieszone wie die tiefsten Elemente am Blattengrat selber. In den höheren Abschnitt der Abfolge des Blattengrat-Komplexes sind in der östlichen Claridenkette geringmächtige Linsen einer Wildflysch-Serie eingeschaltet. Kann dieser Altenoren-Flysch auch lithologisch mit dem Sardona-Flysch verglichen werden, so bleibt die Frage nach seiner Stellung dennoch offen, da er stellenweise recht eng mit der Blattengrat-Serie verknüpft erscheint. III. Über der Flysch- und Schieferzone liegen mit
scharfem tektonischem Kontakt die subhelvetischen Deckenelemente der Claridenkette.
Die tiefste Einheit, die Griesstock - Decke, weist am Griesstock eine vom
Quintnerkalk bis in die Nummulitenschichten reichende Serie auf. Östlich
des Klausenpasses sind die über dem Quintnerkalk folgenden Schichtglieder
abgeschert und an den Alpenrand vorgeschürft worden. Von
dieser ziemlich geschlossen gebauten Einheit durch eine Tertiärschieferzone
stark wechselnder Mächtigkeit getrennt, folgen in den Gipfelpartien
der Claridenkette einzelne Schollen und Schuppen, deren Zusammenhang nur
selten noch erhalten ist. In der Annahme, in diesen Scherben und Schubspänen
müssten Äquivalente der frontalen Abspaltungen des ostglarnerischen
Anteils der helvetischen Hauptschubmasse vorliegen, sind die Gipfelelemente
der Claridenkette, die wir als Clariden - Elemente bezeichnen können,
bisher meist zwei verschiedenen Decken zugeordnet worden. Die
sich um die Clariden-Elemente legende Schieferzone ist stellenweise mit
dem transgressiven Tertiär einzelner Schuppen und Scherben normalstratigraphisch
verknüpft. Die den verschiedenen Elementen zugehörigen Schieferserien
lassen sich jedoch gegeneinander nicht abgrenzen. Einzelne ClaridenElemente
sind vollständig von Schiefem umschlossen; in die Schiefer sind zudem
mancherorts kleine und kleinste Oberkreide/Eozän-Lamellen eingeschaltet.
Kreide/ Eozän-Lamellen und die aus ihrem ursprünglichen Verband
völlig losgerissenen Schuppen sind als «Verschürfte Kreide-Eocaen-Massen
der Claridenkette» zusammengefasst worden. Da aber mit nur wenigen
Ausnahmen in der ganzen Claridenkette verschürfte kretazische und
tertiäre Serien vorliegen, ist für diese Zone der nach den zahlreichen
Lamellen in den Bändern südlich der Klausenpasshöhe gewählte
Ausdruck Schuppenzone des Klausenpasses (R. STAUB & W. LEUPOLD, 1945)
vorzuziehen. Die Grenze der Schuppenzone des Klausenpasses gegen die einzelnen
Clariden-Elementen zugehörigen Tertiärschieferabfolgen ist meist
nicht festzulegen. Die Hauptmasse der Gesteine der Schuppenzone bilden
knorrige Schiefer unterschiedlichen Quarzgehaltes, die nach ihrem Auftreten
am Hergensattel «Hergenschiefer» genannt werden.
Mit scharfer, aber verfalteter Grenze folgen über den Schiefem
der Schuppenzone die höchsten subhelvetischen Elemente der Claridenkette.
Da der Zusammenhang des aus verscherten und verkehrtliegenden Scherben
bestehenden sogenannten «Lochseitenkalkes der Axen-Decke» mit
der Axen-Decke nicht sichergestellt ist, seien diese Schubspäne nach
ihren grössten Teilelementen Fiseten/Orthalden-Schuppen genannt.
Rückblick auf bisherige Arbeiten
4 Tafeln:
|
||
| Findenegg, Ingo | Limnologische Unterschiede zwischen den österreichischen und ostschweiz. Alpenseen u.ihre Auswirkung auf das Phytoplankton. | 110, 289-300, Heft 2 |
| kein Abstract | Drei kürzere Aufenthalte in der Schweiz,
die der Verfasser zum Studium der planktischen Primärproduktion im
Juni und September 1963 sowie Mai 1964 verbracht hat, gaben den Anlass,
neben der Messung der Assimilationsquoten und der vorhandenen Biomasse
auch den qualitativen Zustand des Phytoplanktons ins Auge zu fassen. Dabei
fielen neben vielen Ähnlichkeiten in der Zusammensetzung der planktischen
Biozönosen auch manche Unterschiede gegenüber den Verhältnissen
in den österreichischen Seen auf, welch letztere vom Verfasser schon
seit langer Zeit untersucht werden. Trotz der notwendigerweise nur flüchtigen,
auf drei Beobachtungsperioden gegründeten Kenntnis der Verhältnisse
in den Schweizerseen ergab der Vergleich mit den österreichischen
Gewässern doch so bemerkenswerte Abweichungen, dass der Versuch sich
lohnt, den vermutlichen Ursachen dieser Unterschiede nachzugehen.
In der Schweiz wurden der Pfäffiker-, der Untersee des Bodensees, der Zürich-, der Vierwaldstätter- und der Walensee untersucht. Dabei wurde der Verfasser durch die EAWAG an der Technischen Hochschule, Zürich, in zuvorkommender Weise unterstützt. Dafür sei Herrn Professor Jaag und seinem Stabe, besonders Herrn Dr. Ambühl herzlichst gedankt. Zum Vergleich sind zwei österreichische Seengebiete, jenes in Kärnten sowie das in den nördlichen Kalkalpen herangezogen. In erster Linie ist auf das Kärntner Seengebiet Bezug genommen, das in seinen physiographischen Eigenheiten in gewisser Hinsicht das Gegenteil der ostschweizerischen Gewässer darstellt, so dass diese Gegenüberstellung besonders aufschlussreiche Aspekte verspricht. In der folgenden Tabelle sind zunächst die morphometrischen Charakteristika beider Seegruppen und einiger Nordalpenseen angeführt: |
|
| Thomas,E.A. | Mikrobiologische Aspekte des Gewässerschutzes. | 110,301-319 |
| ... zusätzlich ins Abwasser gelangt;
hingegen erweist sich gerade die bloss biologische Reinigung im letzteren
Falle als absolut ungenügend hinsichtlich der Phosphatelimination.
Will man an Seen und anderen empfindlichen Vorflutern wirksamen Gewässerschutz treiben, so wäre es falsch, die dritte Reinigungsstufe auf dic lange Bank zu schieben. Selbst wenn es gelänge, die Verwendung von Phosphatprodukten in Industrie, Gewerbe und Haushalt einzuschränken, würde die Phosphatentfernung durch biologische Reinigung nicht genügen. Die Zürcher Regierung hat deshalb die Gemeinderäte der im Einzugsgebiet der Seen liegenden Gemeinden ersucht, die nötigen Massnahmen zur Ausfällung der Phosphate unverzüglich zu veranlassen. Parallel dazu ist eine Förderung der Bestrebungen erwünscht, die Verwendung von phosphorhaltigen Produkten, die teilweise ins Abwasser gelangen, einzuschränken. Vor allem sollten konzentrierte Phosphatabwässer nicht in die Kläranlagen geleitet, sondern direkt landwirtschaftlich verwertet werden. Bei einem Versuch in der Kläranlage von Küsnacht gelang am 3.14. Mai 1965 durch Zugabe von 16 mg/l Ferriion in den Ablauf der Belebtschlammanlage nach Einspielen des Verfahrens die Herabsetzung des Phosphatgehaltes von 10 mg/l auf 0,5 mg/l, also eine Entfernung von 95 % der gelösten Phosphate. Es ist beizufügen, dass die Phosphatbestimmungsmethoden, bei denen Molybdänschwefelsäure verwendet wird, dann zu hohe Gehalte an gelöstem Phosphat vortäuschen, wenn sich im Wasser ungelöste phosphorhaltige Stoffe befinden; letztere werden durch die Schwefelsäure teilweise zersetzt. Zusammenfassung
|
||
| Hugentobler,U.H. | Zur Cytologie der Kernholzbildung. | 110,321-342 |
| Die Kernholzbildung ist mit einer Vielzahl
von morphologisch und chemischphysiologischen Prozessen verbunden, u. a.
spielt auch die Nekrobiose des Speichergewebes eine entscheidende Rolle.
In der vorliegenden Arbeit werden in den einheimischen Laubhölzern Ahorn, Eiche, Esche, Hagebuche, Kirschbaum, Nussbaum und Robinie auf lichtoptischem Wege morphologische Veränderungen an Zellkernen des aktiven Strahlenparenchyms studiert. Besondere Beachtung finden dabei: die Form, die Oberfläche, das Volumen, die Struktur und die Lage der Zellkerne in der Markstrahlzelle. Die Untersuchungen ergeben prägnante Unterschiede der Abmessungen der Zellkerne in Abhängigkeit von der Zellgrösse, der Zellfunktion, vom Jahreslauf und vom zunehmenden Splintalter, die in allen untersuchten Baumarten in ähnlich charakteristischer Weise verlaufen. Die gemessenen Gestalt- und Lageveränderungen der Zellkerne werden kausal als Wirkung der vom Stoffwechselgeschehen gesteuerten cytoplasmatischen Zustandsänderungen angesehen und als brauchbare Hilfsmittel zur Beschreibung von kernholzbildenden Vorgängen gefunden. |
||
| Waldmeier,M. | Die Sonnenaktivität im Jahre 1964. | 110,343-362 |
| The present paper gives the frequency numbers
of sunspots, photospheric faculae and prominences as weil as the intensity
of the coronal line 5303 Ä and of the solar radio emission at the
wavelength of 10.7 cm, all characterizing the solar activity in the year
1964.
Die vorliegende Veröffentlichung gibt die die Sonnenaktivität charakterisierenden Häufigkeitszahlen der Sonnenfiecken, der photosphärischen Fackeln, der Protuberanzen, die Intensität der Koronalinie 5303 Ä und diejenige der solaren radiofrequenten Strahlung auf der Wellenlänge 10,7cm. Mean daily sunspot relative-number Mittlere tägliche Sonnenflecken-Relativzahl 10,2 (27,9) Lowest sunspot relative-number Niedrigste Sonnenflecken-Relativzahl 0 (0) Highest sunspot relative-number Höchste Sonnenflecken-Relativzahl 54 (87) Mean daily group-number Mittlere tägliche Gruppenzahl 1,1 (2,3) Total number of the northern spot-groups Gesamtzahl der nördlichen Fleckengruppen 84 (138) Total number of the southern spot-groups Gesamtzahl der südlichen Fleckengruppen 32 (58) Mean equatorial distance of the northern sunspots ~ alter Zyklus 8,1° (10,0°) Mittlerer Äquatorabstand der nördlichen Flecken ~ neuer Zyklus 27,5° (30,2°) Mean equatorial distance of the southern sunspots Mittlerer Äquatorabstand der südlichen Flecken 7,5° (10,5°) Surface covered by fields of faculae on the N-hemisphere Bedeckung der N-Halbkugel durch Fackelfelder 1,8 % (3,6 %) Surface covered by fields of faculae on the S-hemisphere Bedeckung der S-Halbkugel durch Fackelfelder 1,4 % (1,2 %) Mean equatorial distance of the northern faculae alter Zyklus 9,50 (12,40) Mittlerer Äquatorabstand der nördlichen Fackeln neuer Zyklus 31,30 (-) Mean equatorial distance of the southern faculae Mittlerer Äquatorabstand der südlichen Fackeln 7,3° (11,1°) Mean daily profile-surface of prominences Mittlere tägliche Protuberanzenprofilfläche 2434 (2626) Mean daily value of the total emission of the coronal line 5303 Å Mittlere tägliche Gesamtemission der Koronalinie 5303 Å 154,7 (260,7) Mean daily value of the radio emission at the wavelength of 10.7 cm Mittlere tägliche Radioemission auf Wellenlänge 10,7 cm 72,1 (80,8) The values put in brackets are concerning the year 1963. Die in Klammern gesetzten Werte beziehen sich auf das Jahr 1963. The tables 1, 3 and 11 give the daily values of the relative-numbers,
of the group-numbers and of the radio emission, the tables 4, 5, 6, 8 and
9 contain the distribution in latitude of the spots, faculae, prominences
and of the coronal intensity. Fig. 1 and 4 show the course of the relative-numbers
and of the radio emission, and by fig. 3 the distribution in latitude of
the spots, faculae, prominences and of the coronal intensity is demonstrated.
|
||
| Furrer,E. | Polyhistorie im alten Zürich vom 12. bis 18.Jahrhundert. | 110,363-394 Heft 3 |
| kein Abstract | Bericht über die von Rudolf Steiger erarbeitete Ausstellung
in der Zentralbibliothek Zürich
über Konrad von Mure , Felix Hemerli, Konrad Gessner und Johann Jakob Scheuchzer. |
|
| de Quervain,F. | Uraninit führender Turmalin-Sillimanitpegmatit aus dem Gotthardmassiv. | 110,395-400 |
| kein Abstract | Hinweis auf den "Arbeitsausschuss für die Untersuchung schweizerischer Gesteine auf Atombrennstoffe und seltene Erden." | |
| Kuhn,W. | Frühe Beiträge zur Thermodynamik der Atmosphäre. | 4:401-403 |
| kein Abstract | Clausius, Thomson, v. Hann, Wettstein, Theodor Reye | |
| Schüepp,M. | Ziele und Aufgaben der Witterungsklimatologie. | 110,405-418 |
| kein Abstract, Ende Heft 3 | ||
| Thomas,E.A. | Phosphat-Elimination in der Belebtschlammanlage von Männedorf und Phosphat-Fixation in See- & Klärschlamm. | 110,419-434, Heft 4 |
| Die Phosphatfällung in der Kläranlage von Männedorf hat sich wie in anderen Belebtschlammanlagen mit Eisenchlorid ausgezeichnet bewährt. Gegenüber dem Ablauf des Vorklärbeckens wurde eine Phosphor-Elimination von 85,1 % (gelöste Phosphate) bzw. 92,4 % (Gesamtphosphor) erreicht. Die Kosten für den Fällmittelverbrauch betragen nur ½ bis ¼ der Kosten der von Wuhrmann (1964) geprüften Verfahren. Das angewendete Verfahren verleiht dem System der Phosphatfällung eine ausgezeichnete Stabilität, weil es im «Gegenstromprinzip» arbeitet, so dass die im Tagesverlauf auftretenden Phosphatstösse weitgehend ausgeglichen werden. Während schon das Vorhandensein von Belebtschlamm die Phosphatfällung erleichtert, wirkt die Rückführung von Eisen-Phosphat-Schlamm (mit oder ohne Belebtschlamm) im Sinne einer Vor-Fällung. Die Phosphatfällung führte in der Kläranlage Männedorf zu keinem grösseren Schlammvolumen; solcher eisenreicher Schlamm lässt sich besser entwässern. Die Behauptung, dass der gefällte Eisen-Phosphat-Schlamm bei anaerober Gärung die Phosphate wieder frei setze, ist durch weitere Experimente widerlegt worden. Da diese Behauptung die Sanierungsbestrebungen an unseren Seen bereits ausserordentlich erschwerte und verzögerte, ist leider aufs neue eine Aufklärung der Bevölkerung nötig. | ||
| Furrer, Ernst | 75 Jahre Zürcherische Botanische Gesellschaft. | 110,435-486 |
| kurze Lebensbilder von: Albrecht
Huldreich, Baumann Eugen, Benz Eduard, Christ Hermann, Däniker Albert
Ulr., Ernst~Schwarzenbach Marthe , Frey~Wyssling Albert , Furrer Ernst
, Gäumann Ernst , Höhn-Ochsner Walter , Huber-Pestalozzi Gottfr.
, Jaag Otto , Jäggi Jakob , Kägi Hans , Käser Fritz , Keller
Alfred , Keller Robert , Kobel Fritz , Koch Walo , Kölliker Albert
, Landolt Elias , Lüdi Werner , Messikommer Edwin , Naegeli Otto ,
Oberholzer Ernst , Ochsner Fritz , Pfister Rudolf , Rikli Martin , Rübel
Eduard , Ruch Fritz , Schinz Hans , Schmid Emil , Schröter Carl ,
Sulger Büel Ernst , v. Tavel Franz , Thellung Albert , Tröndle
Arthur , Wanner Hans , Wilczek Ernst, Zschokke Achilles.
Was die Rolle der NGZ gewesen ist, lässt Furrer weitgehend offen, zitiert aber C.Schröters Rede von 1917: Vierhundert Jahre Botanik in Zürich. S. 509:
|
||
| Markgraf, F. und J.Schlittler | Der Botanische Garten und das Botanische Museum der Universität Zürich | 110, 487-490 |
| 5. Zuwachs
Durch Tausch erwarben wir Pflanzen vom National Herbarium in Pretoria (Südafrika), vorn Rijksherbarium Leiden (Niederl.-Neu-Guinea), Jardin Botanique de l'Etat, Bruxelles (Kongo), Universität Oulu (Finnland), Universität Bagdad (Irak), Botanisches Museum Oslo (Jan Mayen), Herbarium of South Australia, Adelaide (Australien). Als Geschenk erhielten wir Pflanzen von Herrn Ing. WAGNER (Herbarium Wagner), Herrn Dr. H. HÜRLIMANN (Brasilien und Kongo), Herrn Dr. O. DEGENER (Hawaii), Herrn PD. Dr. ROHWEDER (El Salvador), Herrn H. SEITTER (Balkanhalbinsel und Schweiz), Frau v. SCHOULTZ (Island), Herrn Dr. R. SCHMID (Elfenbeinküste), Herrn W. GREUJER (Griech. Inseln) und vorn CSIRO, Canberra (Australien). 6. Besuch
Am X. Internat. Botanischen Kongress sprach PD. Dr. ROHWEDER
über Histogenese der Commelinaceen, an der Tagung der Deutschen Botaniker
in München hielt Herr Prof. MARKGRAF, aufgefordert von den Veranstaltern,
einen Vortrag: Gedanken zur neueren systematischen Morphologie, und an
der Tagung der Schweiz. Natf. Ges. in Zürich sprachen Herr Prof. MARKGRAF
über die systematische Stellung der Gattung Davidia und Herr PD. Dr.
ROFIWEDER über die Anatomie des Gynoeciums bei Phytolaccaeen.
7. Pilzkontrolle
|
||
| Ziswiler, V. | Das Zoologische Museum der Universität Zürich | 110, 490-493 |
| Forschung
Vom Direktor, seinen wissenschaftlichen Mitarbeitern und mehreren Doktoranden und Diplomanden wurde während des Jahres 1964 auf folgenden Fachgebieten wissenschaftlich gearbeitet und zum Teil auch veröffentlicht: Populationsgenetik: «Dubinin »-Experimente betr. jahreszeitliche Schwankungen des Heterozygotiegrades von Drosophila subobscura in Freiheit. Cytologie: Cytotaxonomische Untersuchungen an Ameisen, Amphibien und am Steinbock. Entomologie: Taxonomische Untersuchungen an Ameisen, basierend auf dem Vergleich ihrer Symbionten. Die Geruchorientierung bei der schwarzen Holzameise Lasitis fuliginosus. Ornithologie: Taxonomie körnerfressender Singvogelgruppen, basierend auf dem Vergleich des hörnernen Gaumens und des Fressverhaltens. Numerisch-taxonomische Untersuchungen an Finken und Webervögeln. Genetische Analyse eines Semiletalfaktors beim Wellensittich. Mammalogie: Ökologischer Vergleich schweizerischer Steinwildkolonien. Vergleichende Studien am Nubischen Steinbock und am Alpensteinbock. Sozialmechanik beim Reh und der Gemse. Bestandesaufnahme der Kleinsäuger im Schweizerischen Nationalpark. Vergleichende Untersuchungen an Populationen der Rötelmaus im schweizerischen Mittelland und in den Alpen. Osteologie: Bearbeitung der tierischen Knochenfunde vom prähistorischen Siedlungsplatz Borst in Liechtenstein. |
||
| Bambauer, H.U. | Mineralogisch-petrographische Sammlung der ETH | 110, 493 |
| Neben einer grösseren Zahl von Einzelstufen
alpiner Minerale konnte die bekannte Sammlung SIGISMUND: «Mineralien
des Veltlins» erworben werden. Diese Sammlung umfasst ca. 1600 Einzelstücke;
einige hundert der schönsten Schaustufen wurden ausgestellt.
Der Konservator: H. U. BAMBAUER |
||
| Hantke, René | Die Geologische Sammlung der ETH | 110, 494-498 |
| Zuwachs
Neben den eigenen Fossilausbeuten Irchel, Rossberg, Mellikon - und dem Aufsammeln auf Auslands-Exkursionen - Veltlin-Adamello, Valle d'Antigorio-Lago Maggiore, Rheinisches Schiefer-gebirge, Saar-Nahe-Gebiet -, verschiedenen Einzelstücken und kleineren Handstücksammlungen erfuhr die Geologische Sammlung besonders durch die zahlreichen Samenreste aus den pliozänen Ligniten von Mizerna (S-Polen), eine Schenkung des Botanischen Institutes der Universität Krakau, eine wertvolle Bereicherung. An Einzelstücken seien hier erwähnt: - verkieselte Gymnospermen-Stammquerschnitte vom Massivrand der Maures (S-Frankreich) und aus den Drakensbergen (S-Afrika), - ein nahezu vollständiges Gebiss eines Pycnodonten aus der galar-Schicht von Dielsdorf, - Ammoniten aus den gotthardmassivischen Bündnerschiefern des Nufenenstockes sowie - Bohrkerne der Versuchsbohrung für den Gotthard-Basistunnel. Ferner sind die Belegsammlungen folgender Diplomarbeiten
und Dissertationen deponiert worden:
|
||
| Kuhn-Schnyder, Emil | Das Paläontologische Institut und Museum der Universität Zürich | 110, 498-503 |
| Die für das Jahr 1964 gesteckten Ziele
auf dem Gebiete der Lehre und Forschung konnten erreicht werden. Um mit
dem Auslande auf dem Gebiete paläontologischer Forschung Schritt zu
halten, wird es in Zukunft grosser Anstrengungen bedürfen. Während
bis vor kurzem das 1956 geschaffene Paläontologische Institut der
Universität Zürich, das Institut de Pale'ontologie der Sorbonne
in Paris und das Paläontologische Institut der Universität Wien
die einzigen selbständigen paläontologischen Universitäts-Institute
in West- und Mitteleuropa waren, beginnen Frankreich und vor allem die
Bundesrepublik Deutschland in schnellem Tempo aufzuholen. Auf Grund der
Empfehlungen des Wissenschaftsrates zum Ausbau der wissenschaftlichen Einrichtungen
(1960) sind selbständige paläontologische Institute an den Universitäten
Bonn, Göttingen, Kiel, Münsten Westf. und Tübingen errichtet
worden; in Frankfurt a. M. und Mainz stehen sie vor der Verwirklichung.
Abb. Pachypleurosaurus sp. Mt.S.Giorgio, Cyamodus rostratus (Münster) |
||
| Henking, K.H. | Die Sammlung für Völkerkunde der Universität Zürich | 110, 504-506 |
| Personal
Direktor: Prof. Dr. K. H. Henking. Konservatorinnen: Frl. Dr. Eva Stoll, Gewrrud Wildberger, Zeitweilige Hilfskräfte: Frl. cand. phil. Christine Osterwalder, Frl. cand. phil. Ruth Streiff, stud. phil. Josef Winiger. Freiwillige Mitarbeiter: Frau Lilo Bühler, Frau Dr. Elisabeth Zink. Raumverhältnisse
Die Sammlungen des Museums erweiterten sich durch Geschenke und Kauf um 150 Gegenstände. Die Geschenke stammen von Frau Konsul E. Davies-Glyn, Zürich, Herrn Dr. Schlatter, Richterswil, Herr und Frau E. und S. Jungen-Marmet, Neu-Guinea, und den Erben Kapitän Hugo, Büsingen. Bibliothek
Photo-Diapositiv- und Filmarchiv
Unterricht
Forschung
|
||
| Ackerknecht, Erwin H. | Die medizinhistorische Sammlung der Universität Zürich | 110, 506 |
| Bezüglich Geschichte und Umfang
der Sammlung verweisen wir auf diese Zeitschrift 107: 273,
1962. Sonderausstellung: Januar bis März 1965 veranstalteten wir aus unsern reichen Beständen eine Ausstellung «Ärztebriefe». Zuwachs: Wir erwarben ein altperuanisches Trepanationsmesser. Wir erhielten eine Anzahl Apparate aus der Zeit der Jahrhundertwende vom pharmakologischen und mikrobiologischen Institut sowie von Prof. Dr. D. SCHWARZ (Nachlass Dr. Hüssy). Dr. OSKAR FOREL stiftete uns zahlreiche Dokumente aus dem Nachlass seines Vaters. Ein hundertjähriger zahnärztlicher Stuhl wurde uns von Dr. A. BIGLER überlassen. Besuch: 1965 wurden bis August ca. 500 Besucher gezählt und über 20 Führungen abgehalten. |
||
| Leibundgut, H. | 20. Jahresbericht der Naturschutzkommission der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich für das Jahr 1964 | 110, 507 |
| Der Naturschutzkommission wurden von Gemeindebehörden
und Privaten zahlreiche Anträge für die Schaffung von Reservaten
gestellt, wobei jedoch nicht wissenschaftliche Gesichtspunkte im Vordergrund
standen, sondern vielmehr ideelle Bestrebungen und Fragen des Landschaftsschutzes.
Alle diese Anregungen wurden deshalb an den Zürcher Bund für
Naturschutz weitergeleitet.
Der Entwurf eines Bundesgesetzes über Natur- und Heimatschutz mit einem erläuternden Bericht zirkulierte bei den Mitgliedern der Kommission und gab zu keinen Änderungs- oder Ergänzungsvorschlägen Anlass. Vom Amt für Regionalplanung wurde unsere Kommission eingeladen, Vorschläge für die eventuelle Schaffung von Naturschutzobjekten auszuarbeiten, welche bei der Regionalplanung «Zürcher Unterland» berücksichtigt werden sollten. Die von uns vorgeschlagene Liste der Naturschutzobjekte von nationaler wissenschaftlicher Bedeutung wurde bereinigt und ist nun im «Inventar der zu erhaltenden Landschaften und Naturdenkmäler von nationaler Bedeutung» vollständig enthalten. Bei der Organisation und Leitung der Naturschutz-Exkursionen der Zürcher Schulsynode wirkten mehrere Mitglieder unserer Kommission mit (Graber, Landolt, Leibundgut, Thomas). Die Exkursionsführer konnten in der «Vierteljahrsschrift» veröffentlicht und den Teilnehmern als Sonderdrucke abgegeben werden. |
||
| Honegger,Ernst | 200 Jahre Mathematisch-Militärische Gesellschaft. | 110,509-510 |
| Hochgeehrter Herr Präsident,
Hochgeehrte Herren der Mathematisch-Militärischen Gesellschaft, Hochgeehrte
Gäste,
Es bedeutet für den Sprechenden eine wohl einmalige Auszeichnung, einem ehrwürdigen, zweihundert Jahre alten Geburtstagskind die Grüsse und Wünsche einer ebenso ehrwürdigen Schwester - zum mindesten was das Alter anbetrifft -, nämlich der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich überbringen zu dürfen. Diese noch ein wenig ältere Schwester wurde im Jahre 1746 gegründet; sie hat damals ihre Mitglieder alle 14 Tage, jeweils am Montag um 16.30 Uhr zu Sitzungen zusammengerufen. Dieselbe Naturforschende Gesellschaft siedelte 1757 von der Limmatburg in das neue Zunfthaus zur Meise über, wo die beiden Säle der Südfront (die jetzigen Zunftsäle), die dazwischenliegende Küche, ein Zimmer in der Winde (als Aufbewahrungsraum) und ein Observatorium im obersten Dachboden gemietet wurden. Die Sitzungen Ihrer im Jahre 1765 gegründeten M. M. G. wurden vorerst in den Privathäusern der Gesellschafter abgehalten. Die dauernde Platznot und - wer wollte es ihnen allzu sehr übelnehmen - die den Hausfrauen der Gastgeber auf die Dauer eher lästigen Umtriebe liessen auch bei Ihrer Gesellschaft den Wunsch nach einem ständigen Lokal wach werden; er zielte auf die schönen Räume im zweiten Stock der Meise. Es gereicht den beiden Gesellschaften, der NGZ und der M. M. G. unter dem Aspekt des Teamworks zur Ehre, dass man sich rasch einig wurde. Am 5. August 1768 konnte die MMG. zum ersten Male am neuen Ort zusammentreten. Das gegenseitige Verhältnis der beiden Gesellschaften wurde festgelegt wie folgt: Jedes Mitglied der M.M.G. soll gleich nach seiner Aufnahme auch Mitglied der NGZ werden. Die M.M.G. zahlt für jedes ihrer Mitglieder an die Kasse der Naturforschenden einen Einstand von 12 Gulden und ein Jahrgeld von 8 Gulden, wofür dann die Mitglieder wie die der NGZ das Recht auf Benutzung der sämtlichen Sammlungen erhalten. Der jeweilige Präses der M.M.G. soll während der Dauer seines Vorsitzes auch an den Versammlungen der Ordinarii Zutritt erhalten. Überdies wurde das Verhältnis so aufgefasst, dass die M.M.G. der Naturforschenden gewissermassen als einer oberen Instanz jährlich Bericht über ihre Tätigkeit in Form von «Jahresabschieden» ablegen sollte, dagegen behielt jene nach aussen hin ihre volle Selbständigkeit, eigene Organisation, eigenen Vorstand, eigene Kasse und Rechnungsführung. Teure Apparate, welche die M.M.G. benötigte, wurden von der besser bemittelten NGZ angeschafft. Wie ernst diese Schirmherrschaft genommen wurde, zeigt unter anderem die Ermahnung, die der mächtige Bürgermeister HEIDEGGER in der Naturforschenden Gesellschaft an die Adresse der M.M.G. ergehen liess, als diese in ihrem Jahresbericht über keine, die Obrigkeit insbesondere interessierenden Grenzreisen rapportieren konnte. Nachdem die M.M.G. 1835 ihre Sitzungen eingestellt hatte, wurde 1836 die Verbindung mit der NGZ der «veränderten Zeitumstände halber» nach 68jähriger Dauer gelöst. * In der Kriegführung des 20. Jahrhunderts haben sich die exakten Naturwissenschaften eine Schlüsselstellung erobert; die Mathematik insbesondere aber ist seit wenigen Jahrzehnten daran, im Wettstreit der einzelnen Disziplinen dieser Wissenschaften die Hand nach der Krone auszustrecken. Wenn also heute jemand auf den Gedanken kommen sollte, eine mathematisch-militärische Gesellschaft zu gründen, eine Gesellschaft also, die der Mathematik im modernen Kriegsgeschehen den ihr gebührenden Platz zuweisen möchte, so müsste ein solches Unterfangen heute als moderne, zukunftsweisende Tat gewürdigt werden. Dass Ihre Gesellschaft diese Tat aber schon vor zwei Jahrhunderten vorweg genommen hat, dafür gebührt dem Weitblick ihrer Gründer weit mehr als nur das Prädikat «Summa cum laude». Ich bin dabei überzeugt, dass sich in ihrer Gründerzeit die Mathematik mit weit mehr als nur dem Einmaleins oder der Herstellung von Soldlisten beschäftigt hat (obschon auch diese heute mit AHV, Lohnersatz, Kleiderzulagen, Mundportionen, Soldzulagen und -abzüge etc. zu einer Geheimsparte der Mathematik geworden sind). Hat man sich doch schon damals unter anderem mit der Schiesslehre, mit trigonometrischen Fragen, ja sogar mit Unterricht über Wurzelziehen und dergleichen beschäftigt. Und wenn im August 1769 ein Hauptmann RÖMER sich offerierte, «den Lauf des dermalen an unserem Horizont sichtbaren Kometen zu erklären», dann wäre man heute fast versucht zu sagen, es seien bereits vor Jahrhunderten in Ihrer Gesellschaft die mathematischen Grundlagen der heute auch militärisch hochaktuellen Raumfahrt gelegt worden. Dieses Verdienst wird kaum geschmälert, wenn im Neujahrsblatt der Feuerwerkergesellschaft vom Jahre 1954 eben diese Mathematik aufs Eis gelegt wird mit der militärisch knappen Formulierung, «von den vier Hauptklassen, in welche die Gründer seinerzeit ihre Themata eingeteilt hatten, ist die erste, die Mathematik, gänzlich aus Abschied und Traktanden verschwunden, obgleich die Gesellschaft stets ihren ehrwürdigen Namen beibehalten hat». * Nehmen Sie am heutigen Ehrentag Ihrer ehrwürdigen Gesellschaft die besten Wünsche der NGZ für die kommenden Jahrhunderte entgegen. Möge auch weiterhin der ungewöhnliche Weitblick ihrer Gründer das Wahrzeichen ihrer künftigen Bestrebungen bleiben. ERNST HONEGGER, Oberstdivisionär, Waffenchef der Übermittlungstruppen |
||
| Zimmermann,Diethelm | Walter Knopfli (1889-1965). mit Photo | 110,511-512 |
| Ansprache an der Abdankunsfeier 24.2.1965. (Naturschutz, Vogelschutz, 4 Bände Vögel der Schweiz ...) | ||
| Leibundgut,H. | Hans Pallmann (1903-1965). mit Photo | 110,513-516 |
| Bodenkundler, Schulratspräsident. | ||
| Bovey,Paul | Otto Schneider-Orelli (1880-1965). mit Photo | 110,516-518 |
| Entomologe | ||
| Weibel,E.R. | Morphometrie der Lunge: Ein neuer Beitrag zur Korrelation von Bau und Funktion des Atmungsapparates. | 4: 519-520AR |
| Die Frage nach den Beziehungen
zwischen dem Bau der Lunge und ihrer Funktion als Gasaustauschapparat verlangt
vom Morphologen eine möglichst genaue Bestimmung der Geometrie und
der Dimensionen der inneren Lungenstrukturen. Luftbewegung, Blutströmung
und Gastransportphänomene gehorchen alle physikalischen Gesetzen;
Geometrie und Dimensionen des Apparates, in dem sich diese Vorgänge
abspielen, werden deshalb einen entscheidenden Einfluss auf ihre Wirksamkeit
haben.
Die Untersuchung von inneren Strukturen eines Organes bedingt die Zerstörung seiner Integrität. Am häufigsten wird es zu diesem Zweck in Dünnschnitte zerlegt, die mit licht- und elektronen-mikroskopischen Methoden untersucht werden können. Bei diesem Vorgehen geht aber die dritte Dimension verloren, denn ein Schnitt gibt nur ein zweidimensionales Abbild der Organstruktur wieder. Zudem trifft ein solcher Schnitt die inneren Einheiten des Organs meist in rein zufälliger Weise. Doch gerade in diesem letzten Umstand liegt für die messende Morphologie ein Vorteil: So kann uns nämlich die geometrische Wahrscheinlichkeitslehre Beziehungen angeben zwischen bestimmten Dimensionen der räumlichen Strukturen und den Erwartungswerten von wohldefinierten Messungen an deren Schnittbildern. Da diese Methodik der «Stereologie» nicht nur Biologen, sondern auch Metallurgen, Geologen, Mineralogen etc. interessiert, steht uns heute schon eine ganze Reihe von zweckmässigen Messmethoden zur Verfügung, mit denen wir die meisten funktionell wesentlichen Dimensionen der Lunge bestimmen können. Unsere morphologischen Untersuchungen der menschlichen Lunge haben nun gezeigt, dass sie sich aus 300 Millionen Alveolen aufbaut, kleinen Luftkammern, die den Ästen eines weitverzweigten Systems von Luftwegen seitlich aufgelagert sind. Diese Alveolenzahl wird mit dem achten Altersjahr erreicht und ist scheinbar eine für den Menschen typische Konstante. In den Wänden dieser Alveolen, die beim Erwachsenen eine Gesamtfläche von rund 80 m2 ausmachen, liegen die Blut-kapillaren in Form eines dichtgefügten Netzes. Das Kapillarblut ist durch eine durchgehende Gewebebarriere von der Alveolarluft getrennt. Diese Schranke baut sich wechselweise aus dicken und dünnen Partien auf; ihre arithmetische mittlere Dicke beträgt etwa 1,3 ~. Für die Bestimmung des Diffusionswiderstandes muss aber nur der Wert von 0,6 ~ eingesetzt werden, der dem harnionischen Mittelwert der Dicke entspricht. Durch diese «gewellte» Anlage der Luft-Blut-Schranke werden ihre zwei Aufgaben günstig beeinflusst, obwohl sie eigentlich einander entgegenwirken: Die Erhaltung der Integrität der Beziehungen zwischen Luft und Blut verlangt möglichst viel Gewebe, während die Sicherstellung eines kleinen Diffusionswiderstandes für den Gasaustausch eine extreme Reduktion der Schrankendicke erfordert. Die Alveolen sind als kleine seitliche Luftkammern den etwa vier letzten Generationen eines weitverzweigten Luftwegsystems angelagert. Bei der Untersuchung von menschlichen Lungen zeigte sich, dass die Luftwege von der Trachea ausgehend sich durch Zweiteilung (Dichotomie) verzweigen und dass die Endäste im Durchschnitt nach 23 Generationen erreicht werden. Auch diese Zahl erscheint als eine für den Menschen typische Konstante. Die Durchmesser der Luftwege nehmen gegen die Peripherie zu systematisch ab, doch bewirkt die jeweilige Verdoppelung der Zweigzahl mit jeder Generation ein rapides Ansteigen des Gesamtquerschnittes der Luft wege. Die Trachea hat einen Querschnitt von nur 2-3 cm2; der Luftwegsquerschnitt der letzten Generation beträgt über 1 m2. Dies hat einen entscheidenden Einfluß auf Luftbewegung und Sauerstofftransport innerhalb der Luftwege. Das Arbeitsgebiet der Morphometrie ist jung; es hält noch ein weites Forschungsgebiet offen. (Autoreferat) |
||
| Braun, Rudolf | Aufgaben und Probleme bei der Beseitigung fester Abfallstoffe. | 4:520-521 AR |
| Zu den negativen Aspekten unserer
hochentwickelten Zivilisation gehört die immer grösser werdende
Flut fester und flüssiger Abfallstoffe, die im Hinblick auf die Reinhaltung
unseres Lebensraumes unschädlich gemacht werden müssen. Noch
vor wenigen Jahren galt die Hauptsorge unserer Behörden ausschliesslich
der Beseitigung des Hausmülls. Die meisten Gemeinden entledigten sich
dieser Abgänge auf die einfachste, billigste, jedoch mangelhafteste
Art und Weise, nämlich mit der ungeordneten Ablagerung in der Landschaft
und nahmen die üblen Folgeerscheinungen in Kauf. Diese Art der Beseitigung
kann nicht mehr länger geduldet werden.
Mit dem Anstieg der Bevölkerungszahl, mit der wachsenden Hochkonjunktur, der fortschreitenden Industrialisierung traten jedoch weitere Probleme und Schwierigkeiten auf. Heute sind es nicht nur die häuslichen Abfälle, also Müll, Sperrgut und Gartenabraum, die schadlos beseitigt werden müssen. Es kommen dazu der Schlamm aus kommunalen Kläranlagen, die festen und schlammförmigen Abfälle aus Industrie und Gewerbe, die ölhaltigen Abfälle, die in Grossgaragen, in Mineralölabscheidern und bei der periodischen Reinigung von Öltanks entstehen, sowie die Kadaver, Konfiskate und Abfälle aus Schlachthöfen. Alle diese verschiedenartigen Abfälle müssen so verarbeitet werden, dass die Endprodukte keinen Schaden mehr stiften können und dass ihre Menge und ihr Volumen möglichst stark reduziert wird. Wenn wir von der sog. geordneten Deponie absehen, die grosse Geländeflächen benötigt und daher nur noch in wenigen Fällen zur Anwendung kommt, so kann diese Verarbeitung entweder mit Hilfe der Verbrennung oder der Kompostierung erfolgen. Die Aufgabe der Beseitigung häuslicher Abfälle haben zahlreiche Gemeinden zur Zufriedenheit gelöst. Heute sind in der Schweiz 10 Verbrennungsanlagen (darunter 4 Grossanlagen) und 12 Kompostwerke in Betrieb. Viele dieser Werke stellen regionale Anlagen dar, an die mehrere Gemeinden angeschlossen sind. Aus technischen und wirtschaftlichen Gründen setzt sich das regionale Denken und Planen immer mehr durch. Ende 1965 werden die häuslichen Abfälle von etwa 2,3 Millionen Einwohnern in Verbrennungs- und Kompostwerken unschädlich gemacht. Zahlreiche regionale Anlagen sind in Projektierung begriffen. Im Jahre 1970 werden etwa 3,2 Millionen Einwohner an solche Anlagen angeschlossen sein. Der ausgefaulte Klärschlamm als Endprodukt der Abwasserreinigung kann nicht mehr wie in früheren Jahren in flüssiger Form restlos an die Landwirtschaft abgegeben werden, da einerseits das Angebot die Nachfrage übersteigt, anderseits gewisse hygienische Bedenken die Verwendung des Schlammes in milchwirtschaftlich genutzten Gebieten begrenzen. Der erste Schritt für jede weitere Verarbeitung und Verwertung des Schlammes, sei es auf dem Wege der Ablagerung, der Kompostierung oder der Verbrennung, liegt in der Reduktion seines Wassergehaltes. Verbrennungsanlagen mit Wärmerückgewinnung haben sich in grossen Städten sehr gut bewährt. Aus technisch-wirtschaftlichen Gründen sind sie nicht für kleinere Gemeinden geeignet. Es ist der Verbrennungs-Technik gelungen, Kleinverbrennungsanlagen ohne Wärmerückgewinnung zu entwickeln, die z. Zt. in der Praxis ausprobiert werden. Die Verbrennung des Schlammes bietet heute noch gewisse Schwierigkeiten, namentlich wirtschaftlicher Art, im Gegensatz zur Müll-Kompostierung, bei der eine Mitverarbeitung des Schlammes beträchtliche Vorteile bietet. Der auch in hygienischer Beziehung einwandfreie Müllklärschlamm Kompost kann als Bodenverbesserungsmittel im Pflanzenbau, insbesondere im Gartenbau, im Weinbau und im Waldbau (Baumschulen) mit Erfolg verwendet werden. Für die Landwirtschaft ist er von untergeordneter Bedeutung. Schwierigkeiten stellen sich insbesondere bei der Unschädlichmachung gewisser spezifischer Industrieabfälle ein, die weder verbrennbar noch kompostierbar sind. Manche anorganischen Industrieschlämme sollten bei Temperaturen von 1 300~1 5000 versintert werden, um sie in weitgehend wasserunlösliche, damit deponierbare Form überzuführen. Unbefriedigend in der Schweiz ist die Beseitigung der Kadaver, Konfiskate und Schlachthofabfälle. Die noch weitverbreiteten Wasenplätze sind hygienisch nicht einwandfrei und können nur noch in speziellen Fällen geduldet werden. Der Bau von Tierkörperverwertungsanlagen und Verbrennungsanlagen muss intensiviert werden. Die bisher erstellten Anlagen vermögen nur etwa 37 % der insgesamt anfallenden tierischen Abfälle zu verarbeiten. In den nächsten Jahren wird sich der Mangel an ausgebildeten Fachleuten für die Planung und den Bau von Abfallbeseitigungsanlagen sehr stark bemerkbar machen und die Lösung der dringlichen Aufgaben verzögern. (Autoreferat) |
||
| Niggli,E. | Des internationale Projekt: "Der obere Erdmantel und sein Einfluss auf die Entwicklung der Erdkruste" und die Schweizer Erdwissenschaften. | 4:521-522 AR |
| Die Erde zeigt nach seismischen
Untersuchungen einen Schalenbau. Eine äusserste Haut, die sogenannte
Erdkruste, ist unter den Ozeanen im Mittel 5 km, im Bereich der Kontinente
30 km dick. Sie ist durch die Mohorovicic-Diskontinuität vom ebenfalls
festen Mantel getrennt, der bis in 2900 km Tiefe reicht und an den «flüssigen»
Erdkern grenzt. Man nimmt heute mit guten Gründen an, dass die in
der Kruste sich abspielenden Vorgänge, wie Gebirgsbildung, Grabenbildung,
Vulkanismus und Metamorphose, durch Prozesse verursacht und gesteuert werden,
die ihren Sitz weitgehend im oberen Erdmantel haben. Wir wissen aber über
diesen Mantel, der 840/ des Volumens der Erde einnimmt, noch sehr wenig.
Im August 1960 beschloss die Internationale Union für Geodäsie
und Geophysik, ein internationales Projekt zu planen und durchzuführen,
das uns neue Kenntnisse über den Mantel und über seinen Einfluss
auf die Vorgänge in der Kruste verschaffen soll (- «Upper Mantle
Project»). Vorgesehen sind unter anderm Tiefbohrungen im Ozean durch
die Kruste in den Mantel hinein, dann aber auch eine Intensivierung indirekter,
geophysikalischer Untersuchungen und ferner gleichzeitig auch eine weitere
Abklärung der zum Teil noch ungenügend bekannten und umstrittenen
Vorgänge in der Kruste selbst sowie eine Erforschung des Aufbaues
dieser Kruste.
Auch die Schweiz kann und soll an diesem Projekt mitarbeiten. Das alpine, tertiäre Orogen ist ja auch heute noch das mit klassischen geologischen Methoden am genauesten untersuchte Ketten-gebirge. Gerade deshalb ist es aber dringend notwendig, die tieferen, nicht durch die Erosion erschlossenen Teile des Alpenkörpers zu rekognoszieren, und zwar mittels geophysikalischer Untersuchungen und mit Hilfe von Tiefbohrungen. Die Synthesen über den Bau und die Entstehung der Alpen sind ja noch weitgehend hypothetischer Natur. Im Dezember 1963 beauftragten die Schweizer Geophysiker, Geologen und Mineralogen ein Komitee damit, Pläne für eine Beteiligung der Schweiz am «Projekt oberer Mantel» auszuarbeiten. Das Komitee stellte fest, dass schon eine ganze Reihe im Gange befindlicher oder zur Zeit geplanter Untersuchungen als Beiträge gewertet werden können, so zum Beispiel Arbeiten über Ophiolithe, radioaktive Altersbestimmungen und Isotopenuntersuchungen, Studien über die alpidische Metamorphose, Schweremessungen, geodätische Vermessungen und das europäische Projekt, mit Hilfe von Grosssprengungen den Bau der äusseren Erde im Bereich der Alpen zu bestimmen. Das Komitee ist jedoch der Meinung, dass auch grössere Arbeiten geplant und durchgeführt werden sollten, die eine Zusammenarbeit schweizerischer Erdwissenschafter der verschiedensten Fachrichtungen und allerdings auch die Bereitstellung grösserer finanzieller Mittel erfordern. In Frage kommen unter anderm kombinierte geophysikalische und geologische Untersuchungen, wobei mit Tiefbohrungen (oder Schächten) und seismischen Verfahren Querschnitte durch die Alpen erforscht werden sollen, dann Wärmeflussbestimmungen, eine Untersuchung der in mancher Hinsicht rätselhaften Ivreazone am Südrand der Westalpen, ferner eine möglichst gute Ausnutzung der dem Erdwissenschafter sich bietenden Möglichkeiten beim Bau der geplanten Basistunnel durch die Alpen. Von grosser Bedeutung für das Projekt ist übrigens der geplante Ausbau des schweizerischen Erdbebendienstes. (Autoreferat) |
||
| Semenza,G. | Die zuckerspaltenden Enzyme des Darmes und ihre Bedeutung für die intestinale Resorption der Kohlenhydrate. | 4:522AR |
| 1. Die Disaccharidasen
der Darmschleimhaut sind am Bürstensaum fixiert und den Substanzen
im Darmlumen frei zugänglich.
2. Nach Papain-Behandlung des Bürstensaums kann man die Disaccharidasen der menschlichen Darmschleimhaut chromatographisch zum Teil trennen. Durch das chromatographische Verhalten, durch die Hitzestabilität und durch kinetische Untersuchungen kann man zeigen, dass in der menschlichen Darmmucosa 8 Disaccharidasen vorhanden sind: eine Trehalase, zwei Lactase-Cellobiasen und fünf Maltasen. Von den letzteren greifen zwei nur die Maltose an, zwei sowohl die Maltose als auch die Saccharose und eine die Maltose, die Isomaltose sowie die Palatinose. Diese Multiplizität ist nicht ein Artefakt der Solubilisierung. 3. In der Saccharose-Isomaltose-Intoleranz fehlen 3 Maltasen; und zwar diejenigen, die normalerweise auch die Saccharose, beziehungsweise auch die Isomaltose hydrolysieren. Da diese Krankheit monofaktoriell vererbt wird, zeigt dieser Befund, dass auch beim Menschen ein einziger Erbfaktor die Synthese von mehr als einem einzigen Enzym kontrollieren kann. 4. Die Maltase-Saccharosen und die Maltase-Isomaltase werden durch Na+ aktiviert. Die Aktivierungskonstante ist annähernd gleich der Na+-Aktivierungskonstante der Glucoseresorption. 5. Die Na+-Aktivierung sowohl der Glucoseresorption als auch dieser Maltasen lässt sich durch Kationen der 1. Gruppe kompetitiv (gegen Na+) hemmen. 6. Beim Menschen und Kaninchen wird die Darm-Saccharaseaktivität mit einer Erhöhung der maximalen Geschwindigkeit, aber ohne Änderung des Km für die Saccharose aktiviert. Die Glucoseresorption (im Kaninchen) wird ebenfalls durch Na+ aktiviert, indem die maximale Geschwindigkeit erhöht und das Km (für die Glucose) nicht beeinflusst wird. 7. In der Ratte und im Hamster ist der kinetische Typ der Na+-Aktivierung, sowohl der DarmSaccharase als auch der Glucoseresorption, anders: das Na+ beeinflusst die maximale Geschwindigkeit nicht, verkleinert aber das Km. 8. «Aktiv» resorbierbare Zucker hemmen die Darm-Saccharase kompetitiv. Das K+ der Glucose für die Darm-Saccharase des Hamsters ist (in Anwesenheit von Na+) ca. 10-3 M, das heisst es entspricht dem Km der Glucoseresorption. In Abwesenheit von Na+ sind beide Konstanten viel grösser. 9. Dieser enge (sowohl qualitativer als auch quantitativer) Parallelismus zwischen Glucoseresorption und Na+-aktivierbaren Darmmaltasen zeigt, dass der begrenzende Faktor bei der Zuckerresorption der Eintritt des Zuckers ins Zuckertransportsystem ist und dass der erste Acceptor des Zuckertransportsystems eben diese Na+-aktivierbaren Maltasen sind. Somit wird auch die früher bekannte Tatsache erklärt, dass der Glucoserest der Saccharose besser resorbiert wird als die freie Glucose. 10. Literaturangaben über dieses Gebiet können von Übersichten und Originalarbeiten entnommen werden [Schw. Med. Wochensch., 93; 1272 (1963); Bioch. Bioph. Acta, 73; 582 (1963); 65; 173 (1962); 89; 109 (1964); Chimia, 18; 405 (1964) usw.]. (Autoreferat) |
||
| Känzig,W. | Unvollkommenheit der Ionenkristalle. | 4:522AR |
| In den letzten 25 Jahren hat
die Physik des festen Körpers ungeheure Fortschritte gemacht. Ein
nicht geringer Teil dieses Fortschrittes ist der Erkenntnis zu verdanken,
dass Störungen im Gitterbau notwendig sind zur Erklärung einer
grossen Anzahl von Eigenschaften der festen Materie. lonenkristalle, insbesondere
die Alkalihalogenide spielten schon früh eine wesentliche Rolle in
der Erforschung der Gitterfehler. Ihr Gitterbau und die elektronische Struktur
der Gitterbausteine ist überaus einfach und der theoretischen Analyse
zugänglich. Sie sind durchsichtig in einem sehr breiten Spektralbereich
und somit der konventionellen Spektroskopie zugänglich. Für eine
lange Zeit spielten sie deshalb die Rolle einer Modellsubstanz (man kann
fast sagen einer «Drosophila der Festkörperphysik»), bis
sie abgelöst wurden durch das Germanium der modernen Halbleiterphysik.
In den letzten zehn Jahren sind jedoch die Alkalihalogenide wieder aktueller
geworden:
Die Dislokationen, welche die Festigkeit und Plastizität bestimmen, konnten sichtbar gemacht werden, was eine quantitative Prüfung der theoretischen Vorstellungen ermöglichte. Die Diffusion konnte dank dem Aufgebot radioaktiver Isotope studiert werden. Besondere Fortschritte machte die Untersuchung der sog. Farbzentren. Diese Gitterfehler bestehen aus Leerstellen oder aus Ionen auf Zwischengitterplätzen, welche Elektronen oder Defektelektronen eingefangen haben. Noch um 1955 herum war die Struktur von nur zwei Farbzentren mit einiger Sicherheit bekannt. Heute sind etwa ein Dutzend Strukturen im Detail erforscht mit der Methode der Elektronenspinresonanz. Der Mechanismus der Entstehung von Farbzentren unter dem Einfluss von Röntgenstrahlen war lange Zeit ein Gegenstand der Spekulation. Die Strukturbestimmung von Farbzentren, welche bei sehr tiefen Temperaturen entstehen, hat nun gute Anhaltspunkte geliefert, und man beginnt zu verstehen, auf welchem Wege ionisierende Strahlung nichtleitende Kristalle modifiziert. In neuester Zeit haben die Untersuchungen an Farbzentren neue Zugänge zur Physik der Schallquanten (Phononen) eröffnet: Es wurde beobachtet, dass gewisse Farbzentren, deren Symmetrie niedriger ist als diejenige des Wirtgitters, durch elastische Deformation des Kristalls oder durch Anlegen eines elektrischen Feldes bei sehr tiefen Temperaturen ausgerichtet werden können. Die Orientierungsänderung erfolgt dabei durch Absorption oder Emission eines Schallquants. Ausrichtungszeiten von unter 10^-7 Sekunden sind beobachtet worden. Interessante dielektrische Eigenschaften treten auf. Auch die Wärmeleitfähigkeit lässt sich durch elektrische Felder und mechanische Spannungen beeinflussen. Neue Methoden zur Erzeugung sehr tiefer Temperaturen werden studiert. Aus der «Drosophila» könnte noch eine «Milchkuh» werden! (Autoreferat) |
||
| Ruch,F. | Cytochemie der Nukleoproteide. | 4:523AR |
| Neben biochemischen Untersuchungen
der Nukleoproteide spielen zytochemische Studien eine wichtige Rolle bei
der Abklärung der Funktion dieser biologisch wichtigen Verbindungen.
Sie geben Einblick in die Stoffverteilung innerhalb der Zelle und in Veränderungen
dieser Verteilung während verschiedenen physiologischen Prozessen
wie z. B. Zellwachstum und Zelldifferenzierung.
Zum qualitativen und quantitativen Nachweis der Nukleinsäuren und Nukleoproteide in der Zelle dienen verschiedenartige optische Methoden, z. T. kombiniert mit Farbreaktionen und die Autoradiographie. Verschiedene Ergebnisse der Absorptions- und Fluoreszenz-Mikrospektralphotometrie werden besprochen. Die photometrische Messung der DNS-Menge in Zellkernen gestattet deren Polyploidie- bzw. Polytäniegrad zu bestimmen. Dieser zeigt Zusammenhänge mit der Zell- und Gewebedifferenzierung. In pathologisch veränderten Zellen, z. B. in Tumoren, findet man meist eine von normalen Zellen stark abweichende DNS-Verteilung. Auch in normalen Geweben wird eine gewisse Streuung der DNS-Menge innerhalb jeder Kern-klasse festgestellt. Es wird vermutet, dass diese Streuung mit der unterschiedlichen Genaktivität der verschiedenen Zellen eines Gewebes zusammenhängt. Es gelingt auch zytochemisch lokale Erhöhungen der DNS-Konzentration in Zellkernen nachzuweisen, die je nach Zelldifferenzierung verschieden häufig sind. Solche Stellen sind oft durch abweichendes morphologisches Verhalten ausgezeichnet und als Heterochromatin bezeichnet worden (der übrige Teil des Kerns Euchromatin). Die DNS im Heterochromatin zeigt gegenüber Hydrolyse- und enzymatischen Abbauversuchen ein anderes Verhalten als die DNS im Euchromatin. Es werden daher Verschiedenheiten im DNSHiston-Komplex vermutet. Photometrische Bestimmungen der Bindung saurer Farbstoffe im Kern weisen auf einen höheren (im Verhältnis zur DNS) Histongehalt des Heterochromatins hin. Nachdem in biochemischen Versuchen eine Blockierung der Genaktivität der DNS durch Histone nachgewiesen werden konnte, scheint es wahrscheinlich, dass die Histone im Heterochromatin eine entsprechende Wirkung haben müssen. Viele Untersuchungen sind jedoch noch notwendig um einen Einblick in die Rolle der Nukleoproteide für die Zelldifferenzierung erhalten zu können. (Autoreferat) |
||
| Hälg,W. | Auf dem Wege zur wettbewerbsfähigen Kernenergie. | 4:524AR |
| Bis in die Mitte der fünfziger
Jahre wurden die Aussichten der Kernenergie auf Grund der von den Physikern
erwarteten geringen Kosten sehr optimistisch beurteilt. Etwas später
schlug diese Stimmung ins Gegenteil um, da die praktisch aus dem Uran gewinnbare
Energie (ausgedrückt durch den sogenannten Abbrand) kleiner war als
erwartet. Zudem waren die Baukosten der ersten Anlagen enttäuschend
hoch.
Man hat inzwischen gelernt, dass der Abbrand vergrössert werden kann durch Verwendung von beständigeren Materialien und Befolgung der Prinzipien der Neutronenökonomie. Auf Grund der Erfahrungen mit den bestehenden Kernkraftwerken wird die Lage heute realistischer beurteilt. Generell gesprochen haben die Atomkraftwerke unter anderm wegen der zum Teil übertriebenen Aufwendungen für die Reaktorsicherheit und der Anlagen zur Brennstoffhandhabung grössere spezifische Investitionskosten (Fr./kW) als konventionelle Anlagen, jedoch sinken diese Kosten mit steigender Leistung stärker. Die nuklearen Brennstoff kosten sind hingegen bedeutend niedriger als diejenigen von herkömmlichen Brennstoffen. Als bewährte Reaktortypen gelten die in Grossbritannien und Frankreich entwickelten GasGraphitreaktoren (metallisches Natururan als Brennstoff, C02 als Kühlmittel, Graphit als Moderator), ebenso die vor allem in Kanada und Schweden geförderten Schwerwassertypen (sehr gute Ausnützung des Urans, aber Entwicklung noch nicht so weit gediehen). Dank den Erfahrungen mit Atom-U-Booten und zivilen Leistungsreaktoren sind bei den in den USA entwickelten bewährten Leichtwassertypen (angereichertes Uran als Brennstoff, H20 als Kühlmittel und Moderator) in der letzten Zeit so grosse Verbesserungen möglich geworden, dass die spezifischen Investitionskosten bei sehr grossen Anlagen etwa gleich niedrig sind wie bei konventionellen Kraftwerken. Damit können grosse Reaktoren in einem bedeutenden Teil der USA (wo Kohle und Öl relativ teuer sind) billigeren Strom liefern als herkömmliche Dampfkraftwerke (in der Schweiz gilt das schon für Reaktoren mittlerer Grösse). Da der Vorrat an billig abbaubaren Uranerzen beschränkt ist, wird man allmählich zu Reaktor-typen übergehen, die das Uran möglichst gut ausnützen und eventuell auch das reichlich vorhandene Thorium in spaltbares Uran umwandeln. Die Entwicklung der schnellen Brüter (die mehr Spaltstoff erzeugen als sie verbrauchen) dürfte wegen der grossen technologischen Probleme noch viel Zeit und Geld in Anspruch nehmen. In den USA werden zwischen der Nuklearindustrie einerseits und den Öl- und Kohlegesellschaften (die die Konkurrenz bereits spüren) andrerseits erbitterte Kontroversen ausgetragen. Auch diese Auseinandersetzungen zeigen deutlich, dass die Kernenergie heute wettbewerbsfähig ist. (Autoreferat) |
||
| Elias,H.G. | Struktur und Eigenschaften von Makromolekülen. | 4:524AR |
| Die makromolekulare Chemie hat
sich in den letzten zehn bis fünfzehn Jahren von einem sehr speziellen
zu einem der grossen Teilgebiete der Chemie entwickelt. Kennzeichnend für
diese Expansion ist der Entscheid der «Chemical Abstracts»,
die makromolekulare Chemie als eine der fünf Sektionen dieses Referate-Organs
zu führen. Da die Forschung überwiegend in Industrielaboratorien
ausgeführt wird, kann die Referatzahl jedoch nur einen unteren Grenzwert für die auf diesem Gebiet herrschende Aktivität angeben. Ein grosser Teil der Arbeiten konzentriert sich auf die Beziehungen zwischen der Struktur und den Eigenschaften von Makromolekülen, speziell den Gebrauchseigenschaften. Anders als in der niedermolekularen Chemie kann hier jedoch eine Änderung des Verfahrensweges zu einer solchen der Produkteigenschaften führen. Schon kleine Strukturunterschiede können aber zu grossen Unterschieden in den Gebrauchseigenschaften führen. Diese Effekte sind in der Regel durch den Umstand bedingt, dass die Nebenprodukte der niedermolekularen Chemie nunmehr als Bestandteil der makromolekularen Struktur erscheinen. Die Gebrauchseigenschaften von Makromolekülen werden durch die chemische (Konstitution, Konfiguration, Konformation) und die physikalische Struktur (Konformation, Orientierung, Kristallinität) bestimmt. Der Einfluss der Konstitution wird am Beispiel der Synthese thermostabiler Polymerer erläutert. Thermostabile Polymere sollen im gewünschten Temperaturbereich keine Umwandlungstemperaturen (Schmelzpunkte, Glastemperaturen usw.), keinen Fluss unter Last sowie eine genügende chemische Widerstandsfähigkeit aufweisen. Vernetzung, Substitution der Hauptkette, Einbau von Ringen und der Aufbau von Doppelleiterketten stellen mögliche Synthesewege dar. Die Konformation von Polymeren im kompakten Zustand ist überwiegend durch die Konfiguration bestimmt. Die Konformation in Lösung ist bislang überwiegend unbekannt. Sie kann in der Regel nur durch indirekte Methoden (Bestimmung der Dimensionen, thermodynamische Parameter) aufgeklärt werden. Entgegen früheren Annahmen ist ein thermodynamisch übereinstimmender Zustand bei Untersuchungen über die Lösungseigenschaften von Makromolekülen jedoch nur eine notwendige, aber keine hinreichende Bedingung für vergleichende Strukturanalysen. Es erscheint wahrscheinlich, dass mindestens ein Teil der Fadenmoleküle in Lösung in Form von gestörten Helixstrukturen vorliegt. Molekülketten und Molekülverbände können durch geeignete Behandlung in Vorzugsrichtungen orientiert werden, wodurch Löslichkeit, Färbbarkeit, Zugfestigkeit usw. stark geändert werden können. Die Gebrauchseigenschaften werden jedoch durch eine Kristallisation der Makromoleküle noch weit stärker beeinflusst. Die Arbeiten der letzten sieben Jahre haben zum Konzept der Faltungsstruktur kristalliner Polymerer geführt. Nach diesem Modell sind bei der überwiegenden Mehrzahl kristalliner Polymerer die Molekülketten nach einer bestimmten Anzahl von Kettengliedern in sich zurückgefaltet. Die Faltungslänge hängt bei einem gegebenen Polymeren wesentlich von den Kristallisationsbedingungen ab. Aus sehr verdünnten Lösungen konnten Polymer-Einkristalle erzeugt werden. Auch bei der Kristallisation aus der Schmelze treten jedoch Faltungsstrukturen auf. Von den Temperbedingungen abhängige Rekristallisationen können insbesondere den Bruch und das Dauerstandverhalten beeinflussen. (Autoreferat) |
||
| Aebi,H. | Prinzipientreue und Launen der Natur: Betrachtungen zum Thema der vergleichenden Biochemie. | 4:525-526AR |
| Ganz im Gegensatz zur Vielfalt
der Formen und Farben, die uns in der belebten Welt entgegentritt, ist
bei den grundlegenden biochemischen Mechanismen eine auffallende Einheitlichkeit
zu beobachten. Diese «Prinzipientreue» der Natur erstreckt
sich zum Beispiel auf die Art und Weise, wie genetisch festgelegte Informationen
in der Basensequenz der DNS gespeichert werden, wie Energie aus verschiedenen
Substraten unter Ausschluß von 02 freigesetzt werden kann (Gärung
und Glycolyse) und wie die daraus gewonnene Energie in Form energiereicher
Phosphate (ATP beliebig transportiert und übertragen werden kann.
Der Befund, dass alle bisher untersuchten Lebewesen diese Prinzipien in
gleicher Weise anwenden, macht es sehr wahrscheinlich, dass der eigentlichen
Phase der Evolution der Organismen eine chemische Evolution vorangegangen
sein muss.
Um so interessanter sind nun diejenigen Mechanismen bei denen offenbar von diesem Prinzip abgewichen worden ist. So hat zum Bei~piel die systematische Analyse der als Energiespeicher dienenden Muskelphosphagene (Amidin-Phosphate) gezeigt, dass hier bereits sehr früh vom ursprünglichen Plan abgewichen worden ist. Da bei den Anneliden 7 verschiedene Muskelphosphagen-Typen zu finden sind, darf diese Phase der Evolution füglich als «Experimentierstadium» angesehen werden. Auch die Struktur der Proteine ist im Lauf der Entwicklungsgeschichte - bei gleichbleibender Funktion - laufend verändert worden. Ein Vergleich der 14 - erst seit kurzem in ihrer Primärstruktur bekannten - Cytochrom-C-Arten ergibt, dass im Bereich des Haemin bindenden Abschnittes des Peptidfadens gar keine Unterschiede bestehen, dass aber im «mutierbaren Bereich» des Peptidfadens zahlreiche Varianten vorkommen. Der Befund, dass die Zahl der Aminosäurevarianten um so kleiner ist, je enger die verwandtschaftliche Beziehung zwischen den verglichenen Spezies, hat zur Begründung einer neuen Forschungsrichtung geführt, die von Pauling und Zuckerkandl als chemische Paleogenetik bezeichnet wird. Aus diesen Studien geht zum Beispiel hervor. dass zur Realisierung einer einzigen Aminosäurevariante ein Zeitraum von 10 bis 20 Millionen Jahren benötigt worden ist. Als Launen der Natur dürfen auch diejenigen Anomalien gelten, welche dem Arzt als angeborene Stoffwechseldefekte («inborn errors of metabolism», A. Garrod) bekannt sind. Es sind stets nur «Nebenwege» des Stoffwechsels betroffen, nicht die «Hauptstrassen». Heute sind gegen 100 derartig molekulare Krankheiten bekannt. Sie sind entweder auf eine Fehisynthese zurückzuführen, zum Beispiel Bildung einer atypischen Cholinesterase ( Mutation im Bereich der Struktur-gene) oder auf einen Syntheseausfall, zum Beispiel Enzymdefekte (= Mutation im Bereich des Regulator- und Operator-gen-Apparates). Dass derartige Krankheiten nicht allein klinisches Interesse bieten, sondern auch Probleme von allgemein biologischer Bedeutung aufwerfen, ist anhand eines Beispiels (Akatalasie) gezeigt worden. Die Zielsetzung der vergleichenden Biochemie - ein Grenzgebiet zwischen Biochemie, Zoologie und Medizin - ist eine zweifache: Der Mediziner verspricht sich von ihr eine Klärung der praktisch wichtigen Frage, ob und inwiefern ein im Tierversuch erhobener Befund auf den Menschen übertragen werden kann. Vom Standpunkt der allgemeinen Biologie ist diese Forschungsrichtung geeignet, zusätzliche Einblicke in den mutmasslichen Ablauf der Evolution zu vermitteln. (Autoreferat) |
||
| Verschiedene | Buchbesprechungen | 527-540 |
| P. Läuchli
Richard Cramer E.A.Thomas J. Odermatt E.A.Thomas W. Gehring Wolfgang Pfeiffer E.A.Thomas Wolfgang Pfeiffer Wolfgang Pfeiffer Helmut Müller Hedi Fritz-Niggli
Wolfgang Pfeiffer
|
BLUME, J.: Nachweis von Perioden durch Phasen-
und Amplitudendiagramm 527
ESSER, K. und KUENEN, R.: Genetik der Pilze 527 FRASER, J.: Treibende Welt. Eine Naturgeschichte des Meeresplanktons 528 von FRISCH, KARL: Tanzsprache und Orientierung der Bienen 528 HUSMANN, W.: Praxis der Abwasserreinigung 529 KÜHN, A.: Vorlesungen über Entwicklungsphysiologie 529 LADIGES, W. und VOGT, D.: Die Süsswasserfische Europas 530 LIEBMANN, H.: Die 3. Reinigungsstufe und die Wasser- und Abwasserbelüftung 530 MARSHALL, A. J.: Biology and comparative physiology of birds 531 MOORE, John A.: Physiology of the Amphibia 532 NAEF, ROBERT A.: Der Sternenhimmel 1966. Kleines astronomisches Jahrbuch für Sternfreunde 532 PENROSE, L. S.: Einführung in die Humangenetik 532 PORTMANN, ADOLF: Einführung in die vergleichende Anatomie der Wirbeltiere 533 POTONIE', ROBERT: Fossile Sporae in situ 533 ROCKSTEIN, MORRIS: The Physiology of Insecta 534 STARMACH, KAROL: Pflanzenwelt der Binnengewässer Polens 535 WINKLER, H. G. F.: Die Genese der metamorphen Gesteine 535 WOLDSTEDT, PAUL: Das Eiszeitalter. Grundlinien einer Geologie des Quartärs 536 WOOD, R. D. and IMAHORI, K.: A revision of the Characeae 536 VON Wyss, WALTER: CHARLES DARWIN. Eine Auswahl aus seinem Werk 537 ZISWILER, V.: Bedrohte und ausgerottete Tiere. Eine Biologie des Aussterbens und Überlebens 538 ZOTTERMAN, Y.: Olfaction and Taste 538 Encyclopaedia Cinematographica 539 Jahrbuch der schweizerischen Hochschulen 540 |
|
| Grieshaber,Ernst | Entwicklung und Feinbau der Sphärosomen in Pflanzenzellen. | 109,(1) 1-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durch die seit Jahren bestehende Kontroverse
um Herkunft und Beziehung der Sphärosomen und Fetttropfen veranlasst,
wurden pflanzliche Gewebe, die reich an derartigen Teilchen sind, elektronenmikroskopisch
untersucht.
Die Sphärosomen entstehen aus abgeschnürten Bläschen des endoplasmatischen Retikulums. In Fettgeweben differenzieren sie zu Fetttropfen. Das feingranuläre Sphärosomenstroma ist auf Grund seines cytochemischen Verhaltens an der Fettsynthese beteiligt. Sowohl Sphärosomen wie Fetttropfen sind von einer glatten, das heisst ribosomenfreien Elementarmembran umgeben. Aus der Tatsache, dass die Fettreserven der Zellen in besonderen Teilchen gebildet und angereichert werden, geht hervor, dass die Sphärosomen keine «toten» Zelleinschlüsse, sondern funktionell aktive Organelle darstellen. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imholz,Peter Alexander. | Die Makrofauna einer Uferstelle des unteren Zürichseebeckens. Ein Beitrag zur Oekologie steiniger Brandungszonen. | 109,25-80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Während eines Jahres
untersuchte ich die Makrofauna einer steinigen Uferbank im Gebiet des unteren
Zürichseebeckens in qualitativer und quantitativer Hinsicht.
2. Eingegrabene Fangkästen wurden nach mindestens einmonatiger Ruhe wieder eingeholt. Deren lebender Inhalt wurde fixiert und ein zufälliges Muster daraus unter der Prismenlupe durchsucht. 3. Als Mass für die Zoomasse benützte ich den organisch gebundenen Stickstoff, den ich nach Kjeldahl aufschloss und titrierte. Es wurden Werte gefunden zwischen 0,35 mg N/dm2 (in 10 cm Wassertiefe, Mai) und 74,9 mg N/dm2 (in 80 cm Tiefe, August). 4. Es wurden 94 Spezies unterschieden. 5. Oligochaeten und Insektenlarven wiesen die grössten Abundanzen und Individuendominanzen auf. 6. Die Uferbank lässt bereits innerhalb der Wassertiefen von 0 90 cm deutlich zonierte Zoozönosen erkennen, was unter anderem aus der Verteilung der Chironomidenunterfamilien hervorgeht. 7. Der 20-50 cm unter dem Wasserspiegel liegende Bodenstreifen war am dichtesten besiedelt. Seine Abundanzwerte schwankten von 60 bis 1992 Ind./dm2. 8. Die Abundanzen im Bereich der untersuchten Uferbank zeigten eine ausgesprochene Jahresperiodizität. Dabei ist anzunehmen, dass die Makrofauna im Winter und Vorfrühling haldenwärts disloziert, was zu einer beinahe vollständigen Evakuation der Uferbank führt. 9. Verglichen mit Berichten über die litorale Makrofauna anderer Seen, zeigte der untersuchte Ort grössere Abundanzen, während die Bestimmung der Zoomasse ähnliche Ergebnisse lieferte, wie man sie andernorts fand. 10. Vergleichsproben aus einer weiter seeaufwärts gelegenen ähnlichen Uferbank ergaben im Sommer einen gesicherten Unterschied in der Zusammensetzung der betreffenden Makrofaunen. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Engeler,Erwin & Speiser,Ambros P. | Zur Analogie zwischen einer elektronischen Rechenmaschine und dem Gehirn. | 109,(1) 81-84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peano Axiome, Goedelsche Sätze,
Boolsche Algebra, Turingmaschine, dann werden die Speicherkapazität
des Gehirns, die Anzahl Operationen pro Sekunde geschätzt.
Abschliessend möchten wir festhalten: Trotz grössten Bemühungen an vielen Orten ist es bis jetzt nicht gelungen, zu beweisen, dass das Gehirn zu Denkabläufen fähig ist, die prinzipiell von keiner Maschine geleistet werden können, und auch der Verfasser hat diesen Beweis nicht erbracht. Hingegen wollen wir gerne zugeben, dass es sehr fraglich ist, ob es jemals gelingen wird, eine dem menschlichen Hirn äquivalente Maschine zu bauen; denn die Anzahl der dazu nötigen Schaltelemente und Verbindungen ist ausserordentlich hoch, und es ist sehr schwierig, über den Aufbau des Gehirns einen hinreichend detaillierten Aufschluss zu gewinnen. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waldmeier,M. | Die Sonnenaktivität im Jahre 1963. | 109,(2) 85-102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The present paper gives
the frequency numbers of sunspots, photospheric faculae and prominences
as weil as the intensity of the coronal line 5303 Ä and of the solar
radio emission at the wavelength of 10.7 cm, all characterizing the solar
activity in the year 1963.
Die vorliegende Veröffentlichung gibt die die Sonnenaktivität charakterisierenden Häufigkeitszahlen der Sonnenflecken, der photosphärischen Fackeln, der Protuberanzen, die Intensität der Koronalinie 5303 Ä und diejenige der solaren radiofrequenten Strahlung auf der Wellenlänge 10,7cm. Mean daily sunspot relative-number Mittlere tägliche Sonnenflecken-Relativzahl 27,9 (37,5) Lowest sunspot relative-number Niedrigste Sonnenflecken-Relativzahl 0 (0) Highest sunspot relative-number Höchste Sonnenflecken-Relativzahl 87 (125) Mean daily group-number Mittlere tägliche Gruppenzahl 2,3 (3,0) Total number of the northern spot-groups Gesamtzahl der nördlichen Fleckengruppen 138 (157) Total number of the southern spot-groups Gesamtzahl der südlichen Fleckengruppen 58 (71) Mean equatorial distance of the northern sunspots alter Zyklus 10,0° (9,8°) Mittlerer Äquatorabstand der nördlichen Flecken neuer Zyklus 30,2° (-) Mean equatorial distance of the southern sunspots Mittlerer Äquatorabstand der südlichen Flecken 10,5° (11,4°) Surface covered by fields of faculae on the N-hemisphere Bedeckung der N-Halbkugel durch Fackelfelder 3,6 % (5,5 %) Surface covered by fields of faculae on the S-hemisphere Bedeckung der S-Halbkugel durch Fackelfelder 1,2% (2,5%) Mean equatorial distance of the northern faculae Mittlerer Äquatorabstand der nördlichen Fackeln 12,4° (12,5°) Mean equatorial distance of the southern faculae Mittlerer Äquatorabstand der südlichen Fackeln 11,1° (11,6°) Mean daily profile-surface of prominences Mittlere tägliche Protuberanzenprofilfläche 2626 (3431) Mean daily value of the total emission of the coronal line 5303 Å Mittlere tägliche Gesamtemission der Koronalinie 5303 Å 260,7 (447,9) Mean daily value of the radio emission at the wavelength of 10.7 cm Mittlere tägliche Radioemission auf Wellenlänge 10,7 cm 80,8 (90,0) The values put in brackets are concerning the year 1962. Die in Klammern gesetzten Werte beziehen sich auf das Jahr 1962. The tables 1, 3 and 11 give the daily values of the relative-numbers,
of the group-numbers and of the radio emission, the tables 4, 5, 6, 8 and
9 contain the distribution in latitude of the spots, faculae, prominences
and of the coronal intensity. Fig. 1 and 3 are showing the course of the
relative numbers and of the radio emission, and by fig. 2 the distribution
in latitude of the spots, faculae, prominences and of the coronal intensity
is demonstrated.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thomas,E.A. | Katalog der Planktonorganismen des Zürich-Obersees und des Zürichsees. | 109,103-142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Als Beispiel die Seite 123
Literaturverzeichnis 11 Arbeiten Zürichsee-Obersee,
68 für den Zürichsee
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurt,F. | Beobachtungen an den ostäthiopischen Antilopen: Madoqua kirki, Strepsiceros strepsiceros chora, Strepsiceros imberbis, Oryx beisa beisa, Gazelle soemmering erlangi, Lithocranius walleri. | 109,(2) 143-162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Im vorliegenden Aufsatz handelt
es sich um Gelegenheitsbeobachtungen, die während eines zehnmonatigen
Aufenthaltes in Ostäthiopien gesammelt wurden. Anlässlich ausgedehnter
Fahrten während der Trockenzeit (Dezember und Januar) werden drei
Savannentypen auf Grund der Vegetation, der Baumabstände und -höhen
unterschieden. Dabei stellt sich heraus, dass Antilopen offene Biotope
einem dichter bewachsenen Lebensraum vorziehen. Im Gegensatz zu Oryx und
Sömmeringsgazellen leben Dik Diks, grosse und kleine Kudus in einem
verhältnismässig baumreichen Buschtyp. Es zeichnet sich eine
Tendenz ab, wonach die Grösse der sozialen Verbände zunimmt mit
dem Lichterwerden der Baum- und Strauchvegetation. Dies gilt sowohl innerhalb
der gleichen Art (Oryx, Sömmeringsgazelle) als auch zwischen verschiedenen
Arten.
In der stark erodierten Savanne zwischen Erer und Dire Daua wurden während 10 Monaten Dik Diks, grosse und kleine Kudus beobachtet. Gelegentlich brachen aus einer nördlichen Grassteppenzone, wo auch Sömmeringsgazellen festgestellt wurden, Gerenuks und Oryxantilopen in den vier bis sechs Kilometer breiten Beobachtungsraum ein. Beim grossen Kudu und beim Dik Dik wird näher auf das Fortpflanzungsverhalten eingegangen. Die jahreszeitlichen Populationsverschiebungen werden diskutiert. Summary
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bühlmann, Hans | Die "Geburtsstunde" der mathematischen Statistik. | 109,(3) 163-170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kein Abstract
Antrittsvorlesung |
Ein Beispiel aus der Spieltheorie
1494 falsche Löungen bei Fra Luca Paccioli, 1556 bei Nicolo Fontana etwas besser, ab Girolamo Cardano (1501-1576) richtig. Hat Cardano oder sein Schüler Ludovico Ferrari die Fundamentalmenge erfunden? Bei Galileo Galilei war es bereit ein Gemeinplatz. Brühlmann vermutet formalisiert durch Pierre de Fermat und Blaise Pascal. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rätz,Jürg | Ueber ein spezielles Brennstoffproblem - eine mathematische Betrachtung. | 109,171-174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kein Abstract | Problem: Mathematical Games M.Gardner, Ein Motorfahrzeug , das sich Zwischendepot von Treibstoff anlegen kann und eine beliebige Strecke überwinden soll. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finsinger,Franz Xaver | Abtötungs- und Mutationsraten nach Röntgenbestrahlung frisch abgelegter Drosophila-Eier in verschiedenen Sauerstoffkonzentrationen. | 109,175-195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. l0-20 min alte Eier von Drosophila
melanogaster wurden in Stickstoff/Sauerstoffgemischen (0, 2, 4, 8, 10,
21, 100% O2) bestrahlt mit 1000 r 50-keV-Röntgenstrahlen. Als Strahleneffekte
wurden registriert: embryonale Sterblichkeit, postembryonale Sterblichkeit
und die Rate der rezessiven geschlechtsgekoppelten Letalmutationen.
2. Die Raten aller drei Effekte steigen von 0 bis 10 % Sauerstoff an und bleiben dann von 10 bis 100% Sauerstoff praktisch konstant. 3. Die Sauerstofferhöhungsraten ( Verhältnis des Effektes nach Bestrahlung in Luft zu Effekt nach Bestrahlung in Stickstoff) für embryonale Sterblichkeit und Letalmutationen beträgt 2,4, diejenige für postembryonale Sterblichkeit ist niedriger. 4. Es konnte gezeigt werden, dass verschiedene Strahleneffekte, die im gleichen Experiment induziert wurden, trotz gleicher Dosisabhängigkeit, gleicher Abhängigkeit von der Sauerstoffkonzentration und gleicher Sauerstofferhöhungsrate nicht auf denselben Primäreffekten beruhen müssen. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zai, Luther .E. | Untersuchungen über Methoden zur Beurteilung von Rehwildverbiss in Waldbeständen. | 109,197-265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In der Einleitung wurde hervorgehoben,
dass die Zusammenhänge zwischen Rehwildverbiss und Standortsmerkmalen
allzuwenig abgeklärt sind und dass die Ursache dafür weitgehend
auf das Fehlen systematischer Untersuchungsmethoden zurückzuführen
ist. Die vorliegende Arbeit hat sich deshalb mit den Fragen auseinandergesetzt,
die sich bei der Beurteilung des Rehwildverbisses stellen.
Die Untersuchungen konnten nachweisen, dass die Ausmasse des Verbisses durch «Verbissintensitäten» ausgedrückt und dass diese in Waldbeständen durch Stichproben ermittelt werden können. Diese Stichproben liefern aber nur zuverlässige und interpretierbare Resultate, wenn gewisse Bedingungen erfüllt sind. Es hat sich gezeigt, dass die Vergleichbarkeit der Resultate von Stichproben aus verschiedenen Beständen durch sehr hohe Variabilität der Verbissintensität innerhalb ein und desselben Bestandes gestört wird. Untersuchungen über die Variabilität haben ergeben, dass Höhe und Dichte der Pflanzen einen bedeutenden Einfluss auf die Verbissintensität ausüben. Eine weitere Untersuchung dieser Einflüsse ist notwendig, damit bei Stichprobenerhebungen eine der Variabilität entsprechende Schichtung angewendet werden kann. Vergleiche der Verbissintensität wurden auch mittels Testkulturen durchgeführt. Diese Methode erwies sich als besonders empfehlenswert, wenn es sich darum handelt, objektiv vergleichbare Anhaltspunkte für die Folgen verschiedener Verbissintensitäten zu ermitteln. Bei Testkulturen wurden Erfahrungen gemacht, die bei weiteren derartigen Untersuchungen, besonders bei der Versuchsanordnung, berücksichtigt werden sollten. So müsste versucht werden, eine Zufallsanordnung der Kulturen sowie eine Korrelation des Verbisses mit der genau ermittelten Wilddichte zu erreichen. Die Beurteilung der Schadenstärke erfolgte, indem der Zusammenhang zwischen regelmässigem Verbiss und Höhenzuwachs untersucht wurde. Diese Untersuchungen führten zum Schluss, dass die Verbissstärke am besten mit Hilfe der Verbisshäuflgkeit während einer Periode von 5 Jahren dargestellt wird. Des weitern sollte geprüft werden, ob eine Korrelation zwischen Höhenzuwachsintensität und Verbissintensität besteht. Der nächste Schritt bestände darin, die Verbissstärke in verschiedenen Beständen zu taxieren und sowohl untereinander als auch mit den theoretischen, unter kontrollierten Verhältnissen ermittelten Verbissstärken zu vergleichen. Die Erfahrungen bei der Stichprobenerhebung und dem Ermitteln der Häuflgkeitsverteilung verbissener Pflanzen lassen drei Taxierungsmöglichkeiten zur Wahl. Die interessanteste Möglichkeit bietet die Anwendung von «Sequential Stichproben», weil bei dieser die Verbissstärke gruppiert werden kann und eine ranke Zuteilung der taxierten Probe-flächen zu einer der Gruppen erlaubt. Zu diesem Zwecke ist es sehr lohnenswert, eine Untersuchung an waldbaulich sinnvoll verteilten Gruppen vorzunehmen. Eine solche Gruppierung kann zum Beispiel die Fragen der Schutzmassnahmen berücksichtigen. Ausserdem gibt der Vergleich von Verbissstärken in verschiedenen Beständen einen sehr nützlichen Anhaltspunkt für das Verbissausmass, da ja eine Periode und nicht ein zufälliges einzelnes Jahr berücksichtigt wird. Schliesslich wird gezeigt, dass es mit Hilfe von Stichprobenverfahren möglich sein müsste, eine Taxierung des Nahrungsangebotes und der Nahrungsaufnahme vorzunehmen. Ein Versuch, mit Hilfe der dargestellten Methoden das Nahrungsangebot verschiedener Waldformen darzustellen, drängt sich auf. Die Fragen der tragbaren Wilddichte, der Anlage von Wildäckern und Aufstellung von Futterstellen können erst dann sinnvoll abgeklärt werden, wenn dieses grundlegende Problem abgeklärt erscheint. Die vorliegenden Untersuchungen erlauben auch bereits einige waldbauliche Folgerungen. Besonders eindrücklich ist die Tatsache, dass innerhalb relativ kleiner Bestände, die hier untersucht wurden, sozusagen keine erfassbaren Zusammenhänge zwischen Bestandestyp und Verbissbild zu finden waren. Neben der Höhe und Dichte des Jungbestandes sind die Faktoren, welche zu einer Bevorzugung gewisser Jungwuchstypen führen, offenbar nicht leicht erfassbar. Hinsichtlich des Schutzes der Weisstannenjungwüchse hat sich gezeigt, dass Schutzmassnahmen spätestens bei den 40 cm hohen Pflanzen getroffen werden sollten und dass diese bis zu einer oberen Grenze von ca. 1,30 m unbedingt erforderlich sind. Die Tatsache, dass die Häufigkeitsverteilung verbissener Pflanzen einer negativ binomischen Verteilung folgt, führt zu der Vermutung, dass Gruppen von Pflanzen mehr gefährdet sind als Einzelpflanzen. Ein Hinweis in dieser Richtung geben die Feststellungen aus dem Vorversuch. Die Beimischung von Buche führte dort zur Verminderung der Verbissintensität. Einzelmischung der Tanne mit Buche scheint also von Vorteil zu sein. Schliesslich konnte gezeigt werden, dass die Verbissschäden in Kulturen innerhalb von Nadelbeständen am grössten sind. Dies ist kaum allein auf das Fehlen der Bodenvegetation in solchen Beständen zurückzuführen. Es ist vor allem wahrscheinlich, dass sich das Wild zeitweise in diesen Beständen mit geringer Mächtigkeit der Schneedecke besonders gerne aufhält. Ein Schutz der Kulturen und Jungwüchse erscheint unter diesen Verhältnissen besonders dringend. Als wesentlichstes Ergebnis der vorliegenden Untersuchungen möchten wir neben dem Aufschluss über die Eignung verschiedener Methoden zur Untersuchung von Verbissschäden die Erkenntnis betrachten, dass diese auf sehr komplexen Ursachen beruht. Es handelt sich nicht bloss um ein einfaches Ernährungsproblem, welches beispielsweise allein durch die Fütterung des Wildes, die Anlegung von Wildäckern und dergleichen Massnahmen gelöst werden kann. Die Vermutung wurde sehr bestärkt, dass auch waldbauliche Faktoren eine wesentliche Rolle für die Verbissintensität spielen können. Die Fragen, wie weit Unterschiede der Gefährdung von Licht-und Schattenpflanzen bestehen, ob alle Tannenherkünfte gleich stark vom Rehwild verbissen werden, ob Unterschiede in den Regenerationsfähigkeiten der Pflanzen bestehen usw. wurden überhaupt nicht berührt. Es handelt sich hier um spezifisch waldbauliche und waldkundliche Fragen, welche systematisch untersucht werden sollten, denn das Rehwild ist in manchen Gebieten zu einem entscheidenden «Standortsfaktor» geworden. Bei den bisherigen Untersuchungen über die Rehwildschadenprobleme wurde allzuviel von blossen Hypothesen ausgegangen. Für zukünftige Versuche scheint uns unerlässlich, vorerst verschiedene Einzelfaktoren mit Hilfe der erprobten statistischen Methoden und zum Teil vorerst unter genau bekannten Bedingungen, also im Wildgehege, zu untersuchen. Untersuchungen in freier Wildbahn, namentlich über die lokale Wildbestandesdichte, sollten die einzelnen Experimente ergänzen. So dürfte eine enge Zusammenarbeit von wildkundlicher und waldbaulicher Forschung die besten Erfolge versprechen. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thomas,E.A. | Massenentwicklung von Lamprocystis roseopersicina als tertiäre Verschmutzung am Ufer des Zürichsees. | 109,(3) 267-276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Was die primären Verschmutzungen
am Zürichsee anbetrifft, so darf man sagen, dass deren Verschwinden
in absehbare Nähe gerückt ist. Fünf Kläranlagen für
Gemeindeabwässer stehen in Betrieb und weitere sechs sind im Bau oder
in Projektierung; bald wird es kaum mehr vorkommen, dass man krasse primäre
Seeverschmutzungen noch vom Zug aus sieht (was dieser Tage sogar einem
ausländischen Professor auffiel.)
Die in den See fliessenden Düngstoffmengen und damit die sekundären Seeverschmutzungen nehmen indessen immer noch zu. Die begonnenen Aktionen zur Entfernung der hässlichsten Schwimmschichten von Uferalgen dürften vielleicht eine gewisse Entlastung bringen. Trotzdem scheinen auch die tertiären Verschmutzungen noch im Zunehmen begriffen, was aus folgenden bakteriologischen Befunden hervorgeht: a) Aus dem Geschäftsbericht der Wasserversorgung
der Stadt Zürich, 1962, zitieren wir: «Neben den Auswirkungen
auf den Chemismus des Seewassers zeigt sich die zunehmende Eutrophierung
auch im Anstieg des Keimgehaltes.» «Diese seit Jahren anhaltende
Entwicklung stellt die städtische Wasserversorgung vor neue, grosse
Aufgaben, besonders da der See im Projekt der Regionalplanung für
viele Nachbargemeinden und -städte als Wasserspender dienen soll.»
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meyer,Peter Otto | Die Trematodenlarven aus dem Gebiete von Zürich. | 109,(4) 277-372 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| über die sogenannten Entenflöhe | I. Bestimmungsschlüssel
für die zürcherischen Cercarientypen nach dem Verhalten
Tabelle 18: die Verteilung der im Zürichsee vorgefundenen Cercarienformen auf die verschiedenen Schneckenarten.
Zusammenfassung
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schinz, Julie | Die Vogelwelt des Neeracher Riedes. Ergänzende Beobachtungen von 1953-1963. | 109,373-408 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabelle 1. 20 neu festgestellte
Arten (in Klammer: Nummer in Kapitel II)
1 Podiceps nigricollis BREHM, Schwarzhalstau cher (2) 2 Ardeola ralloides (SCOPOLI), Rallenreiher (6) 3 Ciconia nigra (L.), Schwarzstorch (10) 4 Cygnus bewickii YARREL, Zwergschwan (11) 5 Anser albifrons (SCOPOLI), Blässgans (13) 6 Circus pygargus (L.), Wiesenweihe (36) 7 Falco columbarius L., Merlin (40) 8 Larus fuscus L., Heringsmöwe (72) 9 Larus minutus PALLAS, Zwergmöwe (74) 10 Rissa tridactyla L., Dreizehenmöwe (75) 11 Chlidonias hybrida (PALLAS), Weissbartseeschwalbe (78) 12 Asio otus (L.), Waldohreule (83) 13 Coracias garrulus L., Blauracke (88) 14 Dendrocopus medius (L.), Mittelspecht (92) 15 Prunella modularis (L.), Heckenbraunelle (110) 16 Locustella luscinioides (SAVI), Rohrschwirl (120) 17 Ficedula albicollis (TFMMINCK), Halsbandschnäpper (133) 18 Parus montanus CONRAD, Weidenmeise / Alpenmeise (136) 19 Remiz pendulinus (L.), Beutelmeise (137) 20 Pyrrhocorax pyrrhocorax (L.), Alpenkrähe, Steinkrähe (159) Neu hinzugekommene, nicht gesicherte Spezies bzw. ssp. sind: a) Anthus spinoletta petrosus (MONTAGU), Strandpieper, den ich zwecks Beringung in der Hand hielt. Allgemeine Verbreitung: Brutvogel an den felsigen Küsten der britischen Inseln, der Kanalinseln, in Frankreich an den Felsen der Picardie, Normandie, Bretagne, Vendée und auf den Inseln Noirmoutier und Yeu (NIETHAMMER, G.: Handbuch der deutschen Vogelkunde, Bd. 1, Leipzig, 1937-1942). b) Luscinia s. svecica (L.), Rotsterniges Blaukehlchen, der skandinavischen Rasse angehörend. Tabelle 2.
Tabelle 3.
Zusammenfassung
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schürmann, Jörg | Untersuchungen über organische Stoffe im Wasser des Zürichsees. | 109,409-460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aminosäuren | Während eines Jahres erfolgten
Untersuchungen über den Gehalt des Zürichseewassers an Aminosäuren.
Die Proben stammten aus der Uferzone von Stäfa und aus dem Pelagial
und Profundal bei Thalwil (tiefste Stelle des Sees).
In der Uferzone kamen zwei verschiedene Methoden zur Anwendung, die miteinander verglichen werden: a) Proben von 10 Litern zur direkten Analyse der Aminosäuren; b) lonenaustauscher wurden in speziellen Säcken während drei Tagen in den See gehängt. Das ammoniakalische Eluat dieser lonenaustauscher prüften wir auf Aminosäuren. Die Proben von a (Eindampfproben) konnten in vier Fraktionen aufgeteilt werden: A-Fraktion: Ninhydrinpositive Substanzen, die an stark saurem Kationenaustauscher adsorbiert wurden. B-Fraktion: Substanzen, die durch die Ionenaustauschersäule liefen. Die Hydrolysate dieser Extrakte bildeten die All- und die BH-Fraktion. In der B-Fraktion konnten nie freie Aminosäuren festgestellt werden. Die Konzentration der Totalaminosäuren schwankt zwischen 1 und 6 10-6 Mol pro Liter; die höchsten Werte von einzelnen Aminosäuren überschreiten nie die Konzentration von 0,6 10-6 Mol pro Liter in den A-Fraktionen, während in den hydrolysierten Extrakten Höchstwerte von 1 2 10-6 Mol pro Liter vorkommen. Die Uferproben wiesen grössere Mengen auf als diejenigen des Pelagials und Profundals bei Thalwil. In den BH-Fraktionen wurde der Hauptanteil der Aminosäuren gefunden. Der relative Anteil der peptidisch gebundenen Aminosäuren der AH-Fraktion und derjenige der freien Aminosäuren variiert stark. Im qualitativen und im quantitativen Gehalt an Aminosäuren in den verschiedenen Fraktionen zeigen sich manche Über einstimmungen. Die einfachen, aliphatischen Aminosäuren herrschen vor. Es werden einige Beziehungen zwischen dem Chemismus des Wassers (anorganische Ionen, Aminosäuren) und biologischen Erscheinungen (Entwicklung von Uferalgen) dargestellt. Voruntersuchungen über freie Zucker zeigten, dass Glucose neben andern Kohlehydraten vorkommt. Substanzen, welche im UV fluoreszieren und solche, die UV absorbieren, konnten papierchromatographisch getrennt werden. Summary
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lemans, A. | Der Firnzuwachs pro 1963/64 in einigen schweizerischen Firngebieten, 51. Bericht | 109,461-470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resumé 1963/64
In den nördlichen Ketten der Schweizer Alpen blieben die Winterniederschläge bedeutend hinter dem langjährigen Durchschnitt zurück. In dieser Hinsicht ist das hydrologische Jahr 1963/64 vergleichbar mit einigen von den trockensten Jahren, die wir seit 1864 kennen. Mit Ausnahme des Monats August wies die Ablationsperiode übernormale Temperaturen und Sonnenscheindauer auf. Oberhalb 3000 m fand die Ablation hauptsächlich in der Zeit von Mitte Juni bis Anfang August statt. Nachher blieb das Firnniveau bis Mitte September mehr oder weniger konstant, da Abschmelzung und Neuschneefälle sich die Waage hielten. Das Datum des Herbstminimums konnte deshalb nicht mit Sicherheit bestimmt werden. In tieferen Lagen dauerte die Ablation bis Ende August oder sogar bis Mitte September an. Am 16. September wurde in allen Höhenlagen ein deutliches Ansteigen der Schneedecke beobachtet. Der resultierende Firnzuwachs war stark unternormal und in 2700 m Höhe traten stellenweise mindestens 25jährige Eisschichten zutage. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Markgraf, F. | Der Botanische Garten und das Botanische Museum der Universität Zürich | 109,471-473 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auswärtige Spezialisten,
die unser Herbar besuchten, überprüften Bestimmungen an folgenden
Sammlungen und Familien: Prof. Kasapligil, Oakland (Corylus); Frau Prof.
Jacot-Guillarmod, Grahamstown (Pflanzen aus Basutoland); Margarete Emmerich,
Rio de Janeiro (Sammlung Markgraf, Brasilien); Prof. Birand, Ankara (Sammlung
Markgraf, Türkei). Eine besondere Vereinbarung wurde auf Grund persönlicher
Bekanntschaft mit dem Rijksherbarium Leiden getroffen: die grosse Sammlung
Clemens aus Neu-Guinea und Borneo, von der sich ein umfang reicher Satz
in unbestimmtem Zustand bei uns befand, wurde gegen Abgabe einiger Dubletten
im Rijksherbarium Leiden bestimmt, teilweise bis auf die Art; die Farne
aus dieser Sammlung bestimmte uns alle Herr Dr. Holttum, Kew.
Das Herbar wurde ausserdem von zahlreichen Botanikern besucht, die unser Material für ihre Arbeiten benutzten, so z.B.: John Banbury, Kew; PD. Dr. Hantke, ETH (Quercus); Bez.-Förster Oberli, Wattwil (Rhamnus, Myricaceen); Sr. Marzella Keller (Flora d. Luzerner Seelands); E. Götz und W. Seitz (Aconitum); E. Nelson (Ophrys). 4. Veröffentlichungen, die auf den Sammlungen fussen
5. Zuwachs
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Burla, H. und V. Ziswiler | Das Zoologische Museum der Universität Zürich | 109,473-475 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personal
Direktor: Prof. Dr. H. Burla, Konservator: Dr. V. Ziswiler, Assistent: Dr. M. Schnitter, Präparatoren: R. Ebeling, U. Goepel, Spezial-Handwerker: H. Schmid, Zeichner: J. Kühn, Laborant: O. Krauer, wissenschaifliche Mitarbeiter: Dr. E. Hauschteck (Cytologie), Dr. H. P. Hartmann (Osteologie). Raumverhältnisse
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuhn-Schnyder, Emil | Das Paläontologische Institut und Museum der Universität Zürich | 109,476-481 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild Mastodon cf. turicensis Schinz | 2. Arbeiten über fossile
Wirbellose
PD. Dr. B. Ziegler setzte seine Studien über den Oberjura fort. Im Vordergrund stand die Beschaffung von Untersuchungsmaterial. Dazu dienten eine grössere Exkursion nach Mittelitalien und Sardinien (17. März bis 6. April) sowie kleinere Exkursionen in die Prealpes, ins Helveticum und den Jura. Über Ergebnisse seiner Studien an Spongien sprach er in Wien und Tübingen, über stratigraphische Probleme in Marburg. Abgesehen von zwei Exkursionen (Beznau und Wutachgebiet), die dem Studium der Ammonitenfaunen des Doggers galten, hat sich das Schwergewicht der wissenschaftlichen Arbeit von Dr. H. Rieber auf die Ammonoideen der Trias verlagert (siehe oben). 3. Paläontologie des Kantons Zürich
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steinmann, A. | Die Sammlung für Völkerkunde der Universität Zürich | 109,481-483 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personal
Direktor: Prof. Dr. A. Steinmann, Prof. Dr. K. Henking (ab 16. April). Konservatorinnen: Dr. Eva Stoll, Gertrud Wildberger (halbamtlich). Zeitweilige Hilfskräfte: cand. phil. Suzanne Haas, stud. phil. Christine Osterwalder. Freiwillige Mitarbeiter: Frau Lilo Bühler, Frau Dr. Elisabeth Zink. Tätigkeit
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leibundgut, H. | 19. Jahresbericht der Naturschutzkommission für das Jahr 1963 | 109,483 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nachdem die Liste der Naturschutzobjekte
von wissenschaftlicher nationaler Bedeutung vorläufig abgeschlossen
ist und gedruckt vorliegt, stellt sich der Naturschutzkommission vor allem
die Aufgabe, in Zusammenarbeit mit dem Büro für Regionalplanung
und dem Zürcherischen Naturschutzbund den Schutz weiterer Objekte
von eher lokaler Bedeutung anzuregen. Unsere Hoch- und Mittelschulen, aber
auch einzelne Naturwissenschafter und Naturfreunde sind am Schutze von
Objekten interessiert, denen zwar gesamtschweizerisch kein Seltenheitscharakter
zukommt, die aber für Unterricht und Forschung sowie im Interesse
des rein ideellen Naturschutzes grosse Bedeutung haben. Als wichtige Aufgabe
unserer Kommission erwies sich auch, bei der Aufstellung eines Inventars
der bereits bestehenden Naturschutzobjekte mitzuwirken. Vor allem ist es
auch notwendig, die Aufsicht über die Objekte und deren Unterhalt
besser zu ordnen.
Durch die Teilnahme des Präsidenten an den Sitzungen der Konsultativen Kommission des Schweizerischen Bundes für Naturschutz erfolgte auch eine Mitarbeit bei der Lösung nationaler Naturschutzaufgaben. Ausser den Mitgliedern der Kommission stellten sich mehrere weitere Mitglieder der Natur-forschenden Gesellschaft in Zürich für Beratungen und die Bearbeitung von Gutachten in verdankenswerter Weise zur Verfügung. Als wesentlich erscheint die in der Konsultativen Kommission des Schweizerischen Bundes für Naturschutz allgemein vertretene Auffassung, wonach die Bedeutung der Naturschutzkommissionen der Naturforschenden Gesellschaften durch die Gründung kantonaler Naturschutzvereine nicht vermindert wurde. Diese vertreten in erster Linie die ideellen und öffentlichen Interessen des Naturschutzes, während den wissenschaftlichen Kommissionen nach wie vor die Behandlung der Interessen von Lehre und Forschung zufällt. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Escher, Kaspar | Erratische Blöcke im Eigentum der NGZ | 109,485-486 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volltext
mit Nachtrag |
Bericht über die sich im
Besitz der NGZ befindenden erratischen Blöcke
Als Rechnungsrevisor der NGZ erachteten wir es als unsere Aufgabe, uns über das Vorhandensein und den Zustand der unter den Vermögenswerten unserer Gesellschaft aufgeführten vier erratischen Blöcke zu orientieren. Während der bei Oberembrach liegende Rötelstein Einheimischen und auch einem weitern Kreis gut bekannt ist, konnten die drei andern im Zürcher Oberland liegenden Findlinge erst auf Grund eines genauen Studiums der sich im Besitz unseres Quästorates befindlichen Kaufs- und Schenkungsurkunden sowie eines durch die Herren Dr. Bircher, Dr. Brockmann und Dr. Hirschi verfassten Berichtes über einen Augenschein eruiert werden. Die Begehung durch die genannten Herren im November 1916 war offenbar die letzte. Leider sind die in ihrem Bericht angeführten topographischen Blätter und Photos nicht mehr aufzufinden. Verschiedene Begehungen, teilweise allein, teilweise zusammen mit unserem Herrn Quästor, letztmals im Juli 1962, setzen uns in die Lage, über unsere vier erratischen Blöcke wie folgt zu berichten: Block Nr.1
Block Nr.2
Block Nr.3
Block Nr.4
Zusammenfassung
Nachtrag: Unter Präsident Hitzig wurden
alle Blöcke durch den ganzen NGZ-Vorstand (mit Begleitung) im Herbst
1981 unter Führung von René Hantke besucht. Nachricht
der Rekognoszierung: Block Nr. 2 wurde durch offenbar den Bewirtschafter
gesprengt, weil er das Mähen behindert haben soll. Erratiker, die
den Höchststand der Würmvergletscherung anzeigen, wurden als
Ersatz besichtigt. Woraus bis jetzt (2006) noch nichts wurde.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voegeli,H. | Naturschutz-Exkursionen zur Zürcher Schulsynode 1964. Vorwort. | 109,487-488 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Der Kanton Zürich entwickelt
sich in baulicher und technischer Hinsicht ausserordentlich rasch. Natur
und Landschaff erfahren grundlegende Veränderungen, wodurch unersetzliche
Werte gefährdet sind, die der Mensch für seine körperliche
und seelische Gesundheit nötig hat und die aus Ehrfurcht vor der Schöpfung
schützenswert sind.
Es ist heute eine Pflicht der Allgemeinheit, der Verarmung unserer Tier- und Pflanzenwelt vorzubeugen und die Landschaft vor Verunstaltung zu bewahren. In dieser Aufgabe unserer Zeit ist das Mitwirken der Lehrerschaft von besonders hohem Wert. Denn Lehrer können in dreifacher Hinsicht Wesentliches beitragen: als Erzieher, als Berater unserer Gemeindebehörden und durch praktische und wissenschaftliche Mitarbeit. Dass die Zürcher Schulsynode 1964 dem Naturschutz gewidmet ist, erfüllt uns deshalb mit Freude und Dankbarkeit. An dieser Tagung, eingeleitet durch einen Vortrag von Herrn Prof. Dr. H. Ellenberg, ETH Zürich, über «Naturschutz unsere Aufgabe», finden sechs getrennt geführte, halbtägige Exkursionen statt mit folgenden Themen und Referenten: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Egli,E. & Landolt,E. | Naturschutz-Exkursion zur Zürcher Schulsynode 1965. 1.Bedeutung und Bild der Erholungslandschaft. | 109,488-494 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allgemeine Einführung, Bevölkerungsentwicklung, Erholungslandschaft und Pflege, Beispiele Riedflächen, Kleinseggenrieder oder Kalkflachmoore, Pfeifengraswiesen und Nasswiesen mit ihren charakteristischen Pflanzenarten. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leibundgut,Hans | Naturschutz-Exkursionen zur Zürcher Schulsynode 1964. 2. Naturwälder als Lehr- und Forschungsobjekte. | 109,495-497 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Als Beispiel das Waldreservat Girstel am Uetliberg, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Escher,Konrad & Pavoni,Nazario | Naturschutz-Exkursionen zur Zürcher Schulsynode 1964. 3. Die Bedeutung unserer Bachtobel, am Beispiel des Erlenbacher Tobels. | 109,497-503 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazario Pavoni: Geologie: Aufschlüsse, Vorgänge; Konrad Escher: biologishe Probenahme, und Gefährdung und Pflege | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhn-Ochsner,Walter | Naturschutz-Exkursionen zur Zürcher Schulsynode 1964. 4. Moorlandschaften des Kantons Zürich. | 109,503-511 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bedeutung der Moore; Entstehung der und die Arten unserer Moore; Ueberblick über die Vegetationseinheiten; Verzeichnis der Moorreservate im Kanton Zürich, inbegriffen Seen mit angrenzendem Riedgelände. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thomas,Eugen A. | Naturschutz-Exkursionen zur Zürcher Schulsynode 1964. 5. Seetypen u.Gewässerschutz. | 109,511-517 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klassifizierung der Seen; Seetypen der Zürcher Region; Gewässerschutzmassnahmen an Seen; Greifensee, Seeweidsee. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Graber,Hans | Naturschutz-Exkursionen zur Zürcher Schulsynode 1964. 6. Kleingewässer im Dienste der Schule. | 109,517-520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Es wäre zu wünschen, dass jede Schule ein Kleingewässer mit einer natürlichen Vegetation und Fauna in unmittelbarer Nähe zur Verfügung stünde. d.h. Schul-Reservate. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steiner,Hans | Luise Nabholz (1878-1964). | 109,521 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.Juni 1878 (Moskau) bis
23. Juli 1964. ab 1918 Paris, 1920 Zürich. 1942 bis 1954 NGZ-Sekretärin
(Redaktor und Aktuar)
für Generalindexband bis 1956. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viscontini,M. | Neue Ergebnisse der chemischen Forschung bei Mutationen im Insektenreich. | 109,523-524AR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bis jetzt wurden die meisten
genetisch-chemischen Forschungen bei Mikroorganismen und deren Mutanten
durchgeführt. Höher organisierte Tiere wurden weniger verwendet,
da die Zahl der Generationen in einer bestimmten Zeitspanne verhältnismässig
klein und die Anzahl ihrer Nachkommen im allgemeinen nicht genügend
gross ist. Ferner sind die Metabolite bei Tieren schwer zu erfassen und
zu isolieren.
Das erste Versuchstier schon vor dem Krieg - war ein Schmetterling, Ephestia kühniella und seine Mutante a, weil die Züchtung dieser Art im Laboratorium relativ einfach ist. Dank der Papierchromatographie kann man heute mit so kleinen Stoffmengen arbeiten, dass für das Studium genetisch-chemischer Probleme diese Methode ganz herangezogen wurde. Im Jahre 1951 zeigten E. Hadorn und H. K. Mitchell das Vorhandensein zahlreicher fluoreszierender Stoffe bei einer kleinen Fliege, der Taufliege oder Drosophila melanogaster. Anwesenheit und Konzentration dieser Stoffe hängen mit Geschlecht und Mutationen dieser Fliege zusammen. Wir erkannten diese Stoffe als Pteridine, von welchen das Pterin (1), das Isoxanthopterin (II) und die Pterin-8-carbonsäure (IV) schon bekannt und andere, wie das Biopterin (V), die zwei Sepiapterine und die drei Drosopterine noch unbekannt waren. Diese fünf letzten Pterine lassen sich durch intramolekulare Oxydo-Reduktionen von Biopterin ableiten. 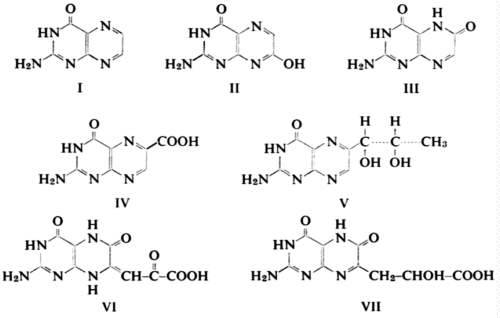
E. Hadorn und H. K. Mitchell fanden in der Wildrasse von
Drosophila alle diese Pterine, hingegen fehlte bei der Mutante «rosy»
das Isoxanthopterin völlig. Beide Autoren fanden auch, dass die Mutante
keine «Xanthinoxydase», die fähig ist, das Pterin 1 in
Isoxanthopterin zu oxydieren, bildet. Dieser sehr wichtige Befund konnte
auch auf Ephestia kühniella ausgedehnt werden.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zähner,Hans | Probleme des mikrobiellen Eisen-Stoffwechsels. | 109,524AR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zahlreiche Mikroorganismen
scheiden bei Eisenmangel wasserlösliche Stoffe in das Nährmedium
aus, die selektiv Ferri-Ionen binden. Auf diese Weise wird Eisen aus schwerlöslichen
Verbindungen herausgelöst und dem Organismus zur Verfügung gestellt.
Bei genügender Eisenversorgung hört die Ausscheidung dieser Stoffe,
die wir als Sideramine bezeichnen, auf.
Einzelne Mikrooganismen (Pilobolus kleinii, Arthrobacter terregens, Microbacterium lacticum) benötigen Sideramine für das Wachstum (l-l00-µg/l Kultur). In höheren Konzentrationen kann bei diesen Mikrooganismen Hämin die Rolle der Sideramine übernehmen. Aus Kulturen verschiedener Actinomyceten konnten eisenhaltige Antibiotica (Sideromycine) isoliert werden. Die Sideromycine gehören zu den aktivsten Antibiotica die bekannt sind. Die Sideramine und die Sideromycine heben sich gegenseitig in der Wirkung auf (strukturell verwandte Metaboliten-Antimetaboliten). Die Sideromycine und Sideramine sind chemisch miteinander verwandt; beide Stoffgruppen binden Eisen in Form eines Trihydroxamsäure-Komplexes. Im Falle der Ferrioxamine, die bei allen gut untersuchten Actinomyceten gefunden wurden, sind die drei Hydroxamsäuregruppen fadenförmig angeordnet. Bei den Sideraminen aus Pilzen sitzen die drei Hydroxamsäuregruppen an Seitenketten eines Hexapeptidringes, der aus 3 Mol Hydroxyornithin und 3 Mol Glycin oder Serin besteht. Die Ferrimycine entsprechen in ihrem Bau den Ferrioxaminen und das Grisein demjenigen der Sideramine aus Pilzen. Aus verschiedenen Beobachtungen lässt sich die Hypothese ableiten, dass den Sideraminen im mikrobiellen Stoffwechsel die Rolle von spezifischen Fe-Donoren zukommt, z. B. beim Eiseneinbau in Protoporphyrin auf der letzten Stufe der Häm-Synthese. Die grosse Bedeutung der Eisenporphyrine im Stoffwechsel macht verständlich, dass erstens die Sideraminbildung verbreitet ist, zweitens die Antagonisierung der Sideramine durch die Sideromycine zu einer Hemmung des Wachstums führt und drittens ein Organismus, der die Fähigkeit zur Sideraminbildung verloren hat, auf die Zufuhr dieser Stoffe von aussen angewiesen ist. Verwendung von Fe-freien Sideraminen in der Medizin: Eisenfreie Sideramine z.B. in der Form des Desferrioxamin B-Methansulfonates können bei pathologischen Eisenablagerungen eingesetzt werden um aus dem menschlichen Körper aktiv Eisen auszuscheiden. Günstige Resultate wurden bisher in Fällen von primärer Hämochromatose, Transfusionssiderosen und Porphyria cutanea tarda erzielt. Auch Eisen-Vergiftungen können mit Erfolg mit eisenfreien Sideraminen behandelt werden. (Autoreferat) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storck,Hans | Klinik und Forschung bei allergischen Krankheiten. | 109,525AR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Am Beispiel von Patienten
mit Urticaria, Serumkrankheit, Neurodermitis, Asthma, Kontakt-ekzem, thrombozytopenische
Purpura und Periarterutis nodosa werden die charakteristischen Züge
allergischer Krankheiten dargestellt. Es sind dies rasches und schubweises
Auftreten von Krankheits-symptomen innerhalb weniger Minuten oder erst
Stunden nach Kontakt mit dem Allergen, zeitlich, qualitativ und quantitativ
geänderte Reaktionsweise gegenüber Stoffen, die vorher keine
Reaktionen hervorriefen (Nahrungsmittel, Tierhaare, Staub, Insektenstiche,
Fremdserum, Medikamente, Blumen, Pflanzenpollen, chemische Substanzen u.
a. m.). Je nach Heredität, Eintrittspforte, Art und Quantität
der Allergene können die verschiedensten Organe erkranken. Eine spezifische
Therapie gelingt oft durch Elimination des Allergens oder Desensibilisierung
mittels Injektionen des Allergens in steigender Dosis.
Kenntnisse der allergischen Krankheiten, Diagnostik und Therapie basieren auf den Fortschritten der allgemeinen Immunologie. Umstimmend wirken Antigene (grossmolekulare, körper- und zirkulationsfremde Proteine und Kohlehydrate), bei der primären Reaktion (Sensibilisierung) in kleinster Menge, bei der sekundären Reaktion (Auslösung) meist in grösserer Menge nach bestimmter Inkubationsperiode, in welcher Antikörper gebildet werden. Sequenz der Aminosäuren, Sekundär-und Tertiärstruktur, Vorhandensein von sauren, basischen und aromatischen Determinanten bestimmen die Spezifität der Proteine, Reihenfolge der Zucker und Polysaccharide, Bindungsart, die Spezifität der Kohlehydrate, zudem Aktivität und sterische Struktur beider Stoffgruppen. Die Mannigfaltigkeit der pflanzlichen und tierischen Antigene ist unbegrenzt. Auch Haptene, das heisst einfache, meist mit Eiweissen leicht reagierende Stoffe (Molekulargewicht unter 1000) wirken antigen nach Bindung an Eiweisse, wobei besonders polare Gruppen die Spezifität bestimmen. Bei allergischen Hautreaktionen können unter anderm die verschiedensten gruppenspezifischen Reaktionen auf chemisch verwandte Stoffe beobachtet werden. Oft entstehen die aktiven Allergene erst beim metabolischen Abbau, zum Teil erst nach chemischer und physikalischer (z. B. UV-Licht) Umsetzung, was den Nachweis durch Testungen erschwert. Die Bildung von Antikörpern auf Antigene (Allergene) ist ein allgemeiner physiologischer Vorgang und besteht in der spezifischen Anpassung von körpereigenen Globulinen auf das Antigen, was zu dessen Neutralisation und beschleunigten Entfernung aus der Zirkulation beitragen kann. Der qualitative und quantitative Nachweis der Antikörper gelingt mit mehr oder minder empfindlichen serologischen Methoden oder Testungen. Auf Grund von besonderen Experimenten (Immunofluoreszenz, Gewebezüchtung etc.) wird heute angenommen, dass Antikörper in den Lymphoblasten und Plasmazellen verschiedenster Reife gebildet werden, sowohl bei tierexperimenteller Anaphylaxie und beim Ekzem wie auch beim Menschen. Je nach Antigen, Veranlagung und weiteren Faktoren entstehen quantitativ und qualitativ verschiedene Antikörper. Die spezifische Antigen-Antikörper-Reaktion kann, ähnlich wie bei der Präzipitation, Agglutination, Opsonisation, Bakteriolys in vitro auch in vivo eine schädliche Substanz inaktivieren oder eliminieren (Schutz, Phylaxie, Immunität) oder aber zum krankmachenden Gewebsreiz führen (Anaphylaxie, Allergie, Immunpathologie). Allen Phänomenen liegt aber ein ähnlicher immunologischer Vorgang der Antigen-Antikörper-Reaktion zugrunde. Die experimentellen und klinischen allergischen Phänomene lassen sich in solche vom Sofort- und Spättypus unterscheiden, mit besonderen Verhältnissen von Antigenen, Antikörpern, gewebsschädigenden Übermittlungssubstanzen und Bedeutung des Komplements. Es stellt sich die Frage, ob die verschiedenartigen Phänomene auf einer unterschiedlichen Reifung der Antikörper aus noch unbekannten Gründen beruhen. Diagnostik und Therapie der allergischen Krankheiten stellen unter anderm noch folgende ungelöste Probleme: 1. Entwicklung einer in vitro Testmethode bei Atopie, bei gewissen Arznei-mittelreaktionen, beim Spätreaktionstypus. 2. Aufklärung der Bedeutung der Kohlehydrate als spezifisches und gruppenspezifisches Allergen (Pneumokokken, Hausstaub, Gräserpollen). 3. Erforschung weiterer gewebsreizender Ubermittlungssubstanzen, die bei Antigen-Antikörper-Reaktionen frei werden, mit Entwicklung entsprechender Inhibitoren. 4. Auswertung von Immunparalyse und Immuntoleranz für die spezifische Therapie, eventuell Entwicklung neuer Methoden zur Beeinflussung der spezifischen Reaktion des lympho-plasmozellulären Systems (zum Teil auch unspezifisch mit ionisierenden Strahlen, radioaktiven Stoffen, Cytostatica und Antimetabolica. (Autoreferat) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grünenfelder,Marc | Radiometrische Mineralalter alpiner Gesteine. | 109,526AR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesteinsbildende und akzessorische
Mineralien enthalten Haupt- und Spurenelemente, deren
Isotope zum Teil radioaktiv sind. Gelten die Voraussetzungen, dass zur Zeit t =0 das radioaktive Isotop vollständig von seinem stabilen Endprodukt abgetrennt worden war und dass in geologischer Zeit im Mineral kein Verlust oder Gewinn des radioaktiven Mutterelementes, seiner im Falle von Uran und Thorium relativ kurzlebigen Zwischenelemente und des radiogenen Endproduktes stattgefunden hat, so lässt sich ein radiometrisches Zerfallsalter nach der bekannten Zerfallsgleichung: Nt = Mt* e^(Lambda*t-1) Nt: Anzahl der Atome des stabilen Endproduktes zur Zeit t. Mt: Anzahl der zur Zeit t noch vorhandenen Atome des radioaktiven Isotops. Lambda Zerfallskonstante. berechnen. Mit Hilfe der massenspektrometrischen Analyse der radioaktiven Isotope U238, U235, Rb87 und K40 und deren Endprodukte Pb206, Pb207, 5r87 und Ar40 sind in den letzten vier Jahren von einigen schweizerischen Hochschullaboratorien radiometrische Altersbestimmungen an Mineralien und Gesteinen der Schweizer Alpen, insbesondere in der zentralalpinen Region und im Tessin ausgeführt worden. Im Gotthardmassiv ergaben U/Pb-Analysen akzessorischer Zirkone der Glimmer-Alkali-feldspatgneise vom Typus Gamsboden, Fibbia und Medels, Zerfallsalter von 275-315 Millionen Jahren, die in Übereinstimmung mit geologischen Befunden für herzynische Kristallisationen dieser Gesteinskörper sprechen. Die ausgezeichnet paralleltexturierten Streifengneise der gleichen tektonischen Einheit enthalten hingegen Zirkone, deren U/Pb-Zerfallsalter 485-520 Millionen Jahre beträgt. Biotitanalysen, die von E. Jäger an den gleichen Proben ausgeführt wurden, ergaben Rb-Sr/ Zerfallsalter von 15-21 (herzynische Granitgneise) und 32 (Streifengneise) Millionen Jahren, die den Einfluss der alpin-tertiären Metamorphose dieses Gebietes deutlich erkennen lassen. U/Pb-Zerfallsalter in Zirkonen der Paragneise vom Typus Gurschen (oberhalb Hospental) weisen erstmals auf die Existenz präkambrischer Kristallisationen im Gotthardmassiv hin. Im Gegensatz dazu finden wir im nördlich angrenzenden Aarmassiv radiometrische Rb/Sr-Altersbestimmungen an Glimmern und Gesamtgestein (H. WÜTHRICH) sowie U/Pb-Zerfallsalter an Zirkonen, die konkordante Alterswerte von 249-312 Millionen Jahren liefern. Die Glimmer- und Gesamtgesteinsanalysen zeigen, immer unter den oben erwähnten Voraussetzungen, dass speziell am Nordrand des Aarmassivs die alpin-tertiäre metamorphe Umprägung eine geringe war. Im zentraler gelegenen Mittagfluhgranit wie auch im zentralen Aaregranit scheint das Rb/Sr-Alter der Biotite (54 bzw. 18,5 Millionen Jahre) alpin-tertiär überprägt zu sein. Rb/Sr-Gesamtgesteinsanalysen des Mittagfluhgranitgneises sowie Rb/Sr-Analysen der gesteinsbildenden Biotit-, Mikroklin- und Albitfraktionen weisen auf eine partielle Mischung der Sr-Isotopenverhältnisse nach der herzynischen Kristallisation des Gesteins hin. E. JÄGER gelang es dagegen am Beispiel des Rotondogranits im Gotthardmassiv, dessen stratigraphische Stellung umstritten ist, unter bestimmten Voraussetzungen eine vollständige Homogenisierung der Sr4sotopenverhältnisse vor 13 Millionen Jahren nachzuweisen. Damit erhält die von HAPNER (1958) auf Grund petrographischer sowie gefügeanalytischer Kriterien vermutete tertiäre «Bildung» des Rotondogranits erneut eine Bekräftigung. In dieser Hinsicht ist es bemerkenswert, dass sowohl die Zirkone des Rotondogranits als auch jene des vergneisten Granodioritstockes von Acquacalda (südl. des Lukmanierpasses) eine deutliche Heterogenität des Zirkonbestandes aufweisen, die sich in bezug auf Gehalt und Verteilung der Spurenelemente im morphologischen Einkristall, im Gehalt an H20 sowie im Unterschied im Kristallbau erkennen lässt. Beide Gesteinseinheiten sowie jene des Tremola- und Monte-Prosagranits, die ähnliche Heterogenitäten ihres Zirkonbestandes zeigen, befinden sich am Südrand des Gotthardmassivs. Im lepontinischen Raum des Tessins sind Rb/Sr-Biotitalter von 14,0-17,5, in der Wurzelzone solche von 19,3-21,8 Millionen Jahren festgestellt worden. Wenngleich diese Zerfallsalter ein Alter für die alpin4ertiäre Metamorphose angeben, kann ihr Ausmass und damit der von WENK (1943, 1955, 1956 und 1962) für dieses Gebiet angenommene tertiäre, anatektische Granitisationsprozess, ohne Albit-, Alkalifeldspat-, Gesamtgesteins- und Zirkonanalysen noch nicht eindeutig bekräftigt werden. (Autoreferat) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olsen,Jörgen Lykke | Supraleitung. | 109,527AR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Supraleitung wurde
schon 1911 von KAMERLINGH ONNES gefunden. Trotzdem ist eine theoretische
Deutung des Phänomens erst in den letzten Jahren gelungen, und es
ist auch erst in letzter Zeit klar geworden, daß die Supraleitung
sehr grosse technische Möglichkeiten bietet.
Das Hauptmerkmal der Supraleitung ist das Verschwinden des elektrischen Widerstandes bei einer kritischen Temperatur T~, die unterhalb 100 K liegt für Elemente, bei Legierungen aber bis zu 180 K gehen kann. Unterhalb dieser kritischen Temperatur ist der elektrische Widerstand unmessbar klein. Experimentell hat man zeigen können, dass er 10^-14 ma1 kleiner als der elektrische Widerstand im normalen Zustand ist. Die Supraleitung wird durch ein von der Temperatur abhängiges kritisches Magnetfeld zerstört. Dieses kritische Magnetfeld, Hc, gehorcht der Gleichung: Hc= H0[1-(T/Tc)^2]. H0 liegt für reine Substanzen bei allen Elementen unterhalb 2000 Gauss. Aus diesem Grunde schien es lange unwahrscheinlich, dass die Supraleitung irgendwelche technische Anwendungen haben würde. Die Erklärung der Supraleitung wurde von BARDEEN, COOPER und SCHRIEFEER im Jahre 1957 gegeben. Sie zeigt, dass eine Wechselwirkung zwischen Elektronen und Gitterwellen zu gebundenen Zuständen führen kann, deren Energie kleiner als die Energie freier Elektronen ist. Die Tatsache, dass die Supraleitung von einer Wechselwirkung mit Gittervibrationen herrührt, führt dazu, dass T0 von der Frequenz der Gittervibrationen abhängig ist und deshalb auch von der Isotopenmasse. Tatsächlich wurde auch ein Isotopeneffekt bei Tc beobachtet, wobei Tc proportional M^-½ ist. Im Jahre 1961 wurden eine Reihe von Hochfeld-Supraleitern entdeckt, die Stromdichten bis zu 10^5 A/cm2 bei Magnetfeldern, die für NbZr in der Grössenordnung von 70000 Gauss und bei Nb3Sn bis 150000 Gauss liegen, ohne Widerstand leiten können. Es ist klar, dass solche Substanzen wichtige Anwendungen in der Konstruktion von starken Magneten, die ohne Leistung arbeiten, finden können. Es ist auch wahrscheinlich, dass sie in der eigentlichen Elektrotechnik Verwendung finden werden. Die Theorie der Hochfeld-Supraleitung ist in den letzten Jahren entwickelt worden. Das höchste kritische Feld Hc2 für Hochfeldsupraleiter zeigt sich proportional ihrem Widerstand. Doch gibt es eine absolute obere Limite von Hc2, die für Supraleiter mit Tc=18°K in der Gegend von 350 000 Gauss liegt. In den letzten Wochen ist Supraleitung in Oberflächenschichten von Metallen bei Feldern fast zweimal so gross wie Hc2 von DE GENNES aus Paris theoretisch vorausgesagt worden und sowohl in Grenoble wie auch von uns am Institut für kalorische Apparate und Kältetechnik (Vorstand Prof. Dr. P. GRASSMANN) beobachtet worden. (Autoreferat) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fritz-Niggli,Hedi | Mutabilität des Erbmaterials. | 109,527-528 AR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Ursache der erblichen Änderungen
von Eigenschaften sind Chromosomen- und Punktmutationen. Dabei bestehen
die Chromosomenmutationen aus einer Änderung der Zahl und der Struktur
von Chromosomen, während sich die Punktmutationen mit den heutigen
Methoden nicht als gröbere Strukturänderungen der Chromosomen
manifestieren, sondern subtile Genänderungen darstellen.
Chromosomenverlust und Chromosomenvermehrung können sich durch Störungen im Verteilungsmechanismus der Erbfaktorenträger während der Heranbildung der Geschlechtszellen und auch in den ersten Teilungsschritten der befruchteten Eizelle ereignen. Bekannt ist beim Menschen die Trisomie (das dreifache Vorhandensein) eines kleinen Autosoms, welches zur mongolischen Idiotie führt. Ebenso sind bis jetzt Trisomien anderer Autosome und Veränderungen der Zahl der Geschlechtschromosomen beobachtet worden. Natürlicherweise entstehen stets neue Chromosomen- und Punktmutationen, wobei sich bei der Maus beispielsweise ein bestimmter Mutationsschritt in einer Häufigkeit von 1 Mutation auf 100000 nichtmutierte Gene ereignet. Die experimentelle Mutationsforschung zeigt, dass neben Ultraviolett und ionisierenden Strahlen verschiedene chemische Substanzen, wie Urethane, Formaldehyd, Schwefel- und Stickstoffmustard-Derivate, Epoxyde, Nitrosamine, unnatürliche Bausteine der Desoxyribonukleinsäure usw. Mutationen auslösen. Dabei ist die Mutabilität des Erbmaterials vom Stoffwechsel der Zelle und besonders der Desoxyribonukleinsäure abhängig. Zur Analyse des Mechanismus der Punktmutation wurde der Genlocus ad7 von Schizosaccharomyces Pombe gewählt, der nach LEUPOLD ein sogenanntes Cistron, ein komplexes Gen, darstellt, das sich in Subgene unterteilen lässt. Untersucht wurden die Rückmutationen einiger Mutanten des ad7-locus zur Normalform, wobei sich die Mutanten durch ihre Unfähigkeit der Adenin-Synthese und der Bildung eines roten Pigmentes von der Normalform unterscheiden. Testobjekte waren durch Nitrit, Ultraviolett und Röntgenstrahlen ausgelöste Mutanten, die zum Teil am selben Mutationsort sitzen. Unter anderm stellte sich folgendes heraus: 1. Ionisierende Strahlen lösen Rückmutationen aus, wobei sich in teilenden Zellen mehr Mutationen einstellen als in ruhenden. 2. Die Zahl der strahleninduzierten Punktmutanten lässt sich nach der Bestrahlung durch eine Behandlung mit Chloramphenicol herabsetzen. 3. Zwischen chemisch induzierten und durch Strahlen ausgelösten Mutationen scheinen prinzipielle, qualitative Unterschiede zu bestehen. 4. Ebenso können sich Mutanten des gleichen Mutationsortes unterschiedlich verhalten. Nach den heutigen Vorstellungen über den Bau des Gens und seiner Arbeitsweise könnte eine Punktmutation in einer Konversion eines Basenpaares, einem Basenverlust oder einer Basenvermehrung sowie dem Einbau falscher Bausteine der Desoxyribonukleinsäure bestehen. Die Untersuchungen an der Spalthefe scheinen zu zeigen, dass Nitritmutationen eher in einer quantitativen Änderung der Basenpaare bestehen, während Strahlen vielseitiger sind und quantitative sowie qualitative Änderungen erzeugen. Doch sind weitere Untersuchungen notwendig, um Sicheres auszusagen. (Autoreferat) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lüscher,Martin | Sozial-Wirkstoffe bei staatenbildenden Insekten. | 109,528-529 AR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Im Insektenstaat müssen
die Funktionen oder Tätigkeiten der Individuen koordiniert sein, damit
der Staat überleben und sich in der Evolution behaupten kann. Für
diese Koordination ist hauptsächlich ein System von chemischen Wirkungen
zwischen den Individuen verantwortlich. Diese geben dauernd oder zeitweise
Wirkstoffe ab. Solche Wirkstoffe, die nach aussen abgegeben werden und
die bei anderen Individuen der gleichen Art bestimmte Verhaltensreaktionen
oder eine entwicklungs-physiologische Reaktion auslösen können,
werden als Pheromone bezeichnet.
In den letzten Jahren sind bei sozialen Insekten viele Pheromone nachgewiesen und zum Teil sogar identifiziert und synthetisiert worden. Nach der Art ihrer Produktion und Wirkung lassen sie sich in zwei Klassen einteilen: 1. Pheromone, die für momentane Funktionen verantwortlich sind und zu raschen Reaktionen auf Veränderungen in der Umwelt des Insektenstaates führen. Es sind meist Duftstoffe, die nur zeitweise unter bestimmten Bedingungen abgegeben werden. Sie beeinflussen bei den anderen Individuen über die olfaktorischen Sinnesorgane und das Gehirn das Verhalten in charakteristischer Weise. 2. Pheromone, die für die Steuerung von Funktionen auf lange Sicht verantwortlich sind. Sie werden von einzelnen Individuen dauernd abgegeben und von anderen Individuen oral aufgenommen. Wahrscheinlich gelangen sie durch Resorption in die Hämolymphe und beeinflussen die endokrinen Drüsen. Zur ersten Klasse gehören Pheromone, die attraktiv sind und die für das Zusammenbleiben der Individuen des Staates verantwortlich sind. Auch Spurpheromone, die das Auffinden einer entdeckten Nahrungsquelle und das Zurückfinden zum Nest erleichtern, und Alarmpheromone, die bei Gefahr abgegeben werden, gehören zu dieser Klasse. Zur zweiten Klasse gehören die Pheromone, die in der sogenannten Königinnensubstanz («Queen substance») der Honigbiene enthalten sind. Diese hemmen die Entwicklung der Ovarien der Arbeiterinnen und bewirken, dass diese keine Ersatzweiselzellen bauen. Hierzu gehören auch Pheromone, die von den funktionellen Geschlechtstieren der Termiten abgegeben werden. Diese wirken auf die Larven ein und verhindern sie daran, sich in Ersatzgeschlechtstiere umzuwandeln. Die Pheromone der ersten Klasse können in ihrer Wirkung mit der Funktion des Nervensystems eines Organismus verglichen werden, während diejenigen der zweiten Klasse den Hormonen eines Organismus analog sind. Der Insektenstaat hat also auf höherer Ebene Koordinationsmechanismen entwickelt, die in ihrer Wirkungsweise denjenigen eines Organismus vergleichbar sind. In dieser Beziehung darf der Insektenstaat mit Recht als Superorganismus betrachtet werden. (Autoreferat) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Winkler,Ernst | Arbeit und Ziel der Orts-, Regional- und Landesplanung. | 109,529AR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Landesplanung - und mit
ihr Orts- und Regionalplanung, die lediglich räumliche Teilbereiche
der erstem sind - erwuchs als Kulturbewegung und nachherige Organisation
vor allem, um den je länger desto bedrohlicher werdenden Kollisionen
zwischen Wohnen, Arbeiten, Verkehren und Erholen beizukommen, denen sie
durch Aufeinanderabstimmen der Bedürfnisse und Ansprüche an den
menschlichen Lebensraum zu begegnen sucht. Im Vortrag wurde am Beispiel
der Modellstadt im Furttal, die durch die Forschungsgemeinschaft für
Städtebau geplant wurde, zu zeigen unternommen, wie die Gebietsplanung
arbeitet. Am Anfang steht wie in der wissenschaftlichen Forschung die Problemstellung,
die im Beispiel durch das Suchen nach einem günstigen Stadtstandort
und Leitbildern ihres Aufbaus markiert wurde. An sie schloss sich die Inventarisation
oder Dokumentation der Grundlagen, welche die hohe Bedeutung von Böschungs-,
Expositions-, Bau- und Nährgrundkarten, von Klima- und Gewässereignungsaufnahmen,
Bevölkerungs-, Siedlungs-, Wirtschafts-, Verkehrs-, Landschaftsschutzuntersuchungen
usw. für die Beurteilung von Planungsgebieten und Planungen selbst
zum Ausdruck brachte. Auf ihrer Basis wurde das Entwicklungsprogramm der
Dimensionen und der Strukturverhältnisse der Stadt behandelt, an welchem
beim angeführten Beispiel zahlreiche Fachinstitutionen der ETH und
der Privatwirtschaft (Verkehr, Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Feuerwehr,
Elektroversorgung, Gasversorgung, Müllabfuhr, Zivilschutz, Post, SBB,
Grünplanung usw.) mitgewirkt hatten. Ihre Studien erlaubten, auch
die Bau- und teilweisen Betriebskosten einer Stadt von rund 30000 Einwohnern
zu bestimmen, wobei erstere auf 1,2-1,5 Milliarden Franken berechnet wurden.
Die Analyse dieser Untersuchung schloss mit Hinweisen auf praktische Beispiele
der Orts- und Regionalplanung, um schliesslich noch den ersten «Nationalplan»,
eine Ideenskizze A. Meilis aus den Dreissigerjahren zu erläutern,
in welchem bereits das vieldiskutierte Leitbild der konzentrierten Dezentralisation
der künftigen Besiedlung der Schweiz vorweggenommen wurde. Da erfolgreiche
Orts-, Regional- und Landesplanung nicht ohne umfassende Organisation möglich
erscheint, widmete sich das Referat zum Schluss noch der Frage, welche
entsprechenden Massnahmen bisher im Lande getroffen worden sind. Von einer
kurzen Geschichte der Schweizerischen Vereinigung für Landesplanung
ausgehend, die in die Dreissigerjahre zurückreicht und als Initiantin
der aktuellen Planungstätigkeit zu gelten hat, da sie sowohl Regionalplanungsgruppen
als Nuclei kantonaler und lokaler Planungsbestrebungen wie auch zahlreiche
direkte Aktionen anregte, wurde kurz der im Lauf der letzten Jahrzehnte
sukzessive gegründeten Ämter und ihrer Tätigkeit gedacht,
die in gegen 900 Ortsplanungen und einer Reihe von Regionalplanungen namentlich
in den Kantonen Aargau, Zürich, Basel, Bern, Graubünden und Tessin
Ausprägung fand. Schliesslich galt ein Wort dem 1961 gegründeten
Institut für Orts-, Regional- und Landesplanung an der ETH, dem Forschung,
Schulung und Beratung in den verschiedenen Planungszweigen zur Aufgabe
gestellt ist und das sowohl auf lokaler, regionaler, nationaler und internationaler
Ebene der Realisierung zu dienen trachtet. Das Referat schloss mit einem
Appell: Nicht allein die Planer als Fachleute haben sich mit der Förderung
der koordinierenden Planung zu befassen, es sind
hierzu alle Bürger aufgerufen. (Autoreferat) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Findenegg,Ingo | Die Seen Kärntens, ein Vergleich mit ostschweizerischen Seen. | 109,530AR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Kärntner Seen
liegen in einem inneralpinen Senkungsgebiet der Ostalpen, das rings von
hohen Bergzügen umgeben ist. Diese Lage bewirkt (1) relative Windarmut,
(2) im Sommer hohe Sonnenscheindauer, (3) im Winter aber kaltes und durch
Hochnebel sonnenarmes Klima. Für die Thermik der Seen bedeutet dies
starke Erwärmung der oberen Wasserschichten im Sommer, lange Eisbedeckung
im Winter und wegen des Fehlens anhaltender Winde geringe Dynamik der Wasserbewegung.
Die Entwicklung dieser charakteristischen Eigenschaften der Kärntner
Seengruppe wird noch gefördert durch die allgemein geringe Durchflutung,
denn die Seen liegen abseits der Hauptentwässerungslinien des Landes.
Der grösste Unterschied gegenüber den Ostschweizer Seen ergibt
sich jedoch aus den Dimensionen, denn der ausgedehnteste Kärntner
See, der Wörthersee, erreicht mit 19 km2 nicht einmal die Grösse
des Walensees. Alle Kärntner Seen zusammen bedecken nur 60 km2, weniger
als die Fläche des Zürcher Untersees. Auch diese geringe Flächenausdehnung
der Kärntner Seen trägt wesentlich dazu bei, die Strömungsvorgänge
und die Wasserdurchmischung herabzusetzen, da sie dem Wind nur eine kleine
Angriffsfläche darbieten. So kommt es, dass selbst im Vorwinter, wenn
die Temperaturgleiche aller Seeschichten eingetreten und die Stabilität
der Schichtung auf ein Minimum gesunken ist, keine vollständige Umschichtung
der Wassermassen stattfindet. Bei vielen Seen bleibt daher das Tiefenwasser
in dauernder Stagnation und von der Belüftung, wie sie an normal zirkulierenden
Seen auftritt, ausgeschlossen (meromiktischer Seetypus). In der Schweiz
kommen derartige Verhältnisse nur selten vor; immerhin verhält
sich aber doch der Zürichsee ebenfalls (fakultativ) meromiktisch.
Waren die Kärntner Seen ursprünglich arm an Pflanzennährstoffen und infolgedessen die Entwicklung des Algenplanktons verhältnismässig gering, so hat sich das Bild in vielen Fällen im Laufe der letzten Jahrzehnte weitgehend geändert. Zwar liegen an unseren Seen keine grösseren Städte, aber die Entwicklung des Fremdenverkehrs hat zu einer starken Verbauung mit Hotels, Villen und Strandbädern geführt, so dass viele von ihnen die wohlbekannten Merkmale zivilisatorischer Überdüngung aufweisen. Unter dieser Eutrophierung leiden die Kärntner Seen, obwohl ihre Belastung auf den Sommer beschränkt ist, wegen ihres geringen Wasservolumens und der schwachen Durchflutung besonders stark. In den Auswirkungen der Eutrophierung ergeben sich gegenüber den Ostschweizer Seen manche Unterschiede. Da die Kärntner Seen wegen ihres meromiktischen Verhaltens schon primär ein sauerstoffarmes Tiefenwasser besassen, äussert sich die Eutrophierung weniger in einer Verödung der Boden- und Fischbesiedlung als vielmehr in einer Verminderung der Badequalität infolge stärkerer Veralgung und Bildung von Wasserblüten. So haben zum Beispiel dte Sichttiefen des Wörthersees in den letzten 30 Jahren um 39 o/o abgenommen, im Ossiacher See um 300½. Dabei ist die Veränderung des Algenbestandes zum Teil etwas anders verlaufen als in der Schweiz. Während sich zum Beispiel im Zürichsee die Eutrophierung zuerst durch ein Massenauftreten der Tabellaria fenestrata kundgab, ist diese Art in Kärnten bisher kaum in Erscheinung getreten. Auch das Auftreten der Blutalge Oscillatoria rubescens zeigt insofern ein etwas anderes Bild, als diese Art in Kärnten im Sommer nur unterhalb der Sprungschicht auftritt, während sie besonders im Rotsee auch im Sommer an der Oberfläche leben soll. Es fehlen im Plankton der Kärntner Seen bislang auch die fädigen Jochalgen Mougeotia und die Grünalge Ulothrix. Auch zu Massenwucherungen der Cladophora glomerata am Flachufer ist es bisher nicht gekommen. Daraus kann man vielleicht den Schluss ziehen, dass die Eutrophierung der Kärntner Seen doch noch nicht so weit vorgeschritten ist als die einiger Schweizer Seen. (Autoreferat) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diverse | Buchbesprechungen | 109,(4),531-544 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thomas, E.A.
Hediger, H.J. Thomas, E.A. Waldner, F. Blumer, S. Tardent, Pierre v.Werra, Hans Curtius, H.C. Thomas, E.A.
Thomas, E.A.
|
Bresch, C.: Klassische und molekulare Genetik.
Ein Lehrbuch 531
Christen, H. R.: Chemie. 2. Auflage 531 Cosandey, F.: La Tourbière des Tenasses sur Vevey 532 Finkelnburg, W.: Einführung in die Atomphysik 533 Gäumann, E.: Die Pilze, Grundzüge ihrer Entwicklungsgeschichte und Morphologie . . 533 Götze, H.: Dem Andenken von Reinhard Dohrn 534 Harbers, E., Domagk, G. F. und Müller, W.: Die Nukleinsäuren 534 Heidermanns, C. und Kirschner-Kühn, 1.: Die Ausscheidung von Wirkstoffen im Harn von Wild- und Nutztieren, III 535 Kozhov, M.: Lake Baikal and its life 536 Lidman, H.: Waldvolk 537 Nultsch, W.: Allgemeine Botanik. Kurzes Lehrbuch für Mediziner und Naturwissenschafter 537 Paulssen, L. M.: Identification of Active Charcoals and Wood Charcoals 538 Pettijohn, F. J. and Potter, P. E.: Atlas and Glossary of Primary Sedimentary Structures 538 Potter, P. E. and Pettijohn, F. J.: Paleocurrents and Basin Analysis 539 Schlie, Ilse.: Über den biologischen Wert der einzelligen Alge Scenedesmus obliquus 540 Weidel, W.: Virus und Molekularbiologie 541 Wohlfarth-Bottermann, K.-E.: Zellstrukturen und ihre Bedeutung für die amöboide Bewegung 542 Wurmbach, H. Biwer, A., Schneider, L., Pohland, H.-L. und Borchert, U.: Zur antithyreoidalen und Missbildung erzeugenden Wirkung pflanzlicher und tierischer Öle bei Kaulquappen 542 Gemeinnütziger Verein der Stadt Bern. Die akademischen Berufe 543 Encyclopaedia Cinematographia. Labroides dimidiatus, Antennarius mummifer, Histrio, histrio 543 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Benz, Georg | Arthropoden-Viren. | 108,1-35 | ||||||||||||
| 2. ARBOR-Viren
Bei dieser Virusgruppe handelt es sich um sphärische 20- 45 nm~ grosse, RNShaltige wirbeltierpathogene Viren, die von blutsaugenden Mücken und Zecken über-tragen werden. Sie entwickeln sich im Cytoplasma der befallenen Zellen, gleichen somit durchaus den Moratorviridae. Im Gegensatz zu den persistenten Pflanzenviren lassen sich die ARBOR-Viren leicht durch Injektion von Wirt zu Wirt (auch von Wirbeltier zu Wirbeltier) übertragen. Sie sind auch viel weniger von spezifischen Arthropodenvektoren abhängig. Alle bisher untersuchten ARBOR-Viren sind bei intracerebraler Injektion pathogen für junge Mäuse. Die Viren besitzen strukturgebundene Hämagglutinine und bewirken in Wirbeltieren eine primäre Infektion der hämopoetischen Organe (Lymphknoten und Knochenmark) mit anschliessender Virämie. Bei hoher Pathogenität kommt es auch zu einer Virusvermehrung in der Leber (z. B. Gelbfieber). Nach der Allgemeininfektion kann eine tödliche Infektion des Zentralnervensystems einsetzen (Enzephalitis, Enzephalomyelitis). Da die Wirbeltiere Antikörper gegen die Viren bilden können, ist aber eine spontane Heilung möglich. Die Arthropodenvektoren werden von den ARBOR-Viren nicht geschädigt. Der Nachweis einer Virusvermehrung im Arthropodenvektor ist für verschiedene Virusarten erbracht worden. Da verschiedene Virusarten von ihren Zeckenvektoren auch transovariell auf ihre Nachkommen vererbt werden, dürften die Zecken als Primärwirte solcher Viren betrachtet werden. In diesen Fällen dienen die Zecken auch als Virus-Reservoirs. Dagegen wurde bei den nur von Mücken übertragenen ARBOR-Viren bisher noch keine transovarielle Übertragung nachgewiesen. Es ist denkbar, dass die primären Wirte dieser Viren ausgestorben sind. V. Versuch einer Einordnung der Arthropodenviren in ein
allgemeines Virensystem
Die Krankheitserreger aus der p5itacosis~Lymphogranuloma-Gruppe enthalten sowohl RNS als auch DNS. Zudem ist für einige Glieder dieser Gruppe eine Vermehrung durch Zweiteilung postuliert worden. Diese Erreger können daher als Organismen betrachtet werden. Sie sind wahrscheinlich den Rickettsien näher verwandt. Der Formenkreis der bekannten Viren kann in drei Stämme
unterteilt werden:
Die DNS-haltigen Arthropodenviren werden als besondere Klasse Arthropodo-nucleophaga betrachtet und, entsprechend dem Schema auf Seite 31 (Tabelle 1), den Nucleophaga zugeordnet. Die RNS-haltigen Arthropodenviren werden als Klasse Arthropodoplasmophaga den Plasmophaga zugeordnet. Ob zwischen den höheren Taxa evolutive Beziehungen bestehen, ist vorläufig eine Ermessensfrage. Theoretisch könnte man sich vorstellen, dass sich die Plasmophaga aus den Arachnoiden ableiten. Als verhältnismässig ursprüngliche Gruppen würden sich dann die Acaroviren und die von Zecken übertragenen ARBOR-Viren (= Arborviroidea) auszeichnen. Die arthropodophilen Viren könnten als Zwischenstufen zu den Phytovirales und Zooplasmovirales aufgefasst werden. Eine Ableitung der Pflanzenviren von arthropodophilen Viren bereitet keine theoretische Schwierigkeiten. In Tabelle 1 wird der mögliche Zusammenhang der Phytophaga und der Arthropodoplasmophilia durch eine nur partielle Abgrenzung zwischen Arthropodoplasmovirales und Phytovirales angedeutet. |
||||||||||||||
| Messikommer,Edwin | Beitrag zur Kenntnis der Algenverbreitung in der Westschweiz. | 108,37-69 | ||||||||||||
| als Beispiel
9. Staurastrum polymorphum Breb. var. cinctum var. nov. Taf. II, Fig. 39 Vom Typus dieser Alge hat man lange Zeit nur eine vage Vorstellung besessen, indem sie fast nie abgebildet worden ist und trotzdem fast in jedem Algenkatalog Erwähnung gefunden hat. Um dieser allgemeinen Unsicherheit zu begegnen, hat dann der finnische Desmidiologe Grönblad sich die Mühe genommen, ein mit dem Namen St. polymorphum bezeichnetes Probeexemplar (Nr.71) aus Wittrock, Nordstedt, Lagerheim «Algae aquae dulcis exsiccatae» zu zeichnen und das Ergebnis zu veröffentlichen. Cfr. Grönblad 1921, Taf. V, Fig. 17-20. Zwei Jahre später ist dann Bd. 5 der Monographie der britischen Desmidiaceen erschienen, in der das zur Diskussion stehende Staurastrum in Wort und Bild ebenfalls Platz gefunden hat. Die Abbildungen von Grönblad und den Briten unterscheiden sich aber erheblich. Da jedoch die Monographie von WEST für die Desmidiologen die Bibel bedeutet, so ist es auch verständlich, dass in der Nachzeit die Darstellung im Desmidiaceenwerk der beiden West mehr Beachtung gefunden hat. |
||||||||||||||
| Primault,Bernard | Comparaison de thermomètres pour le mesure des températures du sol. | 108,71-104 | ||||||||||||
| 4. Conclusions pratiques
a) Les relevés que nous possédons nous permettent de tirer une première conclusion qui n'est certes pas négligeable. Les premiers essais faits à Zurich avaient montré de très grosses différences entre les relevés des résistances et des thermomètres à mercure. Pour une utilisation pratique de ces relevés, il était indispensable de savoir Si ces différences résultaient des conditions particulières rencontrées à Zurich ou Si elles pouvaient se généraliser sur de grandes surfaces. Le présent essai montre que de telles différences ne sont pas particulières aux conditions de terrain et de climat que nous rencontrons sur le Plateau suisse. En effet, nous avons pu constater des divergences du même ordre dans d'autres parties de l'Europe, à savoir à Brwinow dans les plaines de l'Europe septentrionale et à Pregassona qui jouit d'un climat méditerranéen. Il en est d'ailleurs de même de la région de Zagreb dont les conditions se rapprochent fort des plaines du centre du continent. Ainsi, l'usage de l'un ou de l'autre des appareils de mesure n'est pas indifférent Si l'on veut obtenir des résultats comparables d'un endroit à l'autre. b) Le but étant de rechercher l'influence de la température du sol sur le développement et les fonctions physiologiques des racines des plantes ou des parasites vivant dans le sol, il était nécessaire que des relevés correspondent à ce que ressentent ou la plante ou le parasite. Nous avons vu au chapitre 3.6. que l'appareil qui présente en général les plus grands écarts diurnes et atteint le plus rapidement les extrêmes de la journée est la résistance électrique placée horizontalement dans le sol. En outre, sa position relative correspond approximativement à celle des racines des plantes. D'ailleurs, la terre exerce sur ces éléments de mesure une pression continue du fait de son poids comme elle en exerce une sur les racines. Enfin, le contact est très étroit entre la chape de plomb et les particules de terre comme c'est le cas pour tout organisme vivant enfoui dans le sol. Ces différents raisonnements permettent d'affirmer que l'instrument le plus adéquat pour la mesure des températures du sol est la résistance électrique placée horizontalement. c) Le présent essai a permis de démontrer que les divergences entre les mesures faites par des appareils de conceptions diverses variaient en fonction inverse de l'humidité du sol ou de la proximité de la mer. Ainsi sous des climats perpétuellement humides ou dans des conditions de nappe phréatique favorable, l'usage de thermomètres à mercure peut également être recommandé. Avant d'utiliser ces derniers appareils, il est cependant indispensable de s'assurer que le sol est toujours humide. Ce n'est qu'à cette condition que les mesures faites au moyen de thermomètres àmercure pourront être comparées à celles faites au moyen de résistances électriques. d) Nous avons mis les séries de divergences calculées en rapport avec les relevés météorologiques dont nous disposions. Il découle de cette comparaison que la divergence diminue partout (sans nécessairement tomber à 0) après des chutes de pluie de plus de 3 mm. Il suffit même souvent de 0.5 mm de précipitations pour affecter les divergences. Comme ce phénomène se retrouve à toutes nos stations «continentales», il semble bien que l'humidité du sol joue un rôle prépondérant dans la cohésion des appareils avec les particules de terre et, partant, dans l'exactitude des mesures. e) Le choix de l'appareil doit de plus s'appuyer sur le fait que le sol sèche plus rapidement et plus profondément avec la saison chaude. Si donc nous constatons de grosses variations d'humidité dans le sol, il sera indispensable de n'utiliser qu'un appareil ayant une grande adhérence avec la terre. Il semble donc recommandé de n'utiliser que des résistances électriques ou éventuellement des couples thermoélectriques en été dans tous les terrains pouvant se désécher durant la période d'essais envisagée. f) Le calcul des moyennes journalières de la température du sol peut être basé soit sur de nombreuses mesures ou un dépouillement détaillé des bandes d'enregistrement soit sur deux mesures journalières. Dans notre première étude, nous avions proposé pour ces dernières les délais de 8 et 18 heures. On a également proposé d'utiliser le maximum et le minimum de la journée. Or les dépouillements faits aux stations disposant d'enregistreurs ont démontré que le minimum moyen est relevé vers 8 h locales et le maximum un peu après 18 h locales, ce qui revient à dire que l'on peut, sans grand risque d'erreur, effectuer deux lectures journalières à heures fixes et se passer d'instruments enregistreurs spéciaux, délicats et pas toujours fidèles. g) En outre, nous ne saurions assez recommander aux chercheurs de décrire dans leurs mémoires les appareils utilisés et la nature du sol dans lequel les travaux ont été faits. Ce n'est qu'à cette condition que des comparaisons d'un endroit à l'autre pourront être établies. Il est fort regrettable que ces précautions n' aient pas été prises jusqu'ici, car bon nombre de travaux très intéressants qui ont été publiés perdent ainsi une grande partie de leur valeur comparative. 5. Epilogue
|
||||||||||||||
| Widmer,Georg | Bestimmung der Elektronendichte der Sonnenkorona. | 108,(1) 105-139 | ||||||||||||
| wurden von ihm auch auf die K-Komponente
reduziert. Die unserem Modell zugrunde liegende Rotationssymmetrie war
bei dieser Korona besonders gut erfüllt und erlaubte es deshalb, die
gemittelten Werte in einem einzigen Quadranten zusammenzufassen. Da die
vorliegende Berechnung auf horizontale Schnitte bei verschiedenen Höhen
angewiesen ist, war es nötig, die in Winkelabständen von 100
gegebene radiale Helligkeitsverteilung durch Interpolation in eine horizontale
umzuwandeln. Auf den in Tabelle III angegebenen 20 Höhen Z~ wurden
zunächst die zu den vorliegenden Radien gehörenden horizontalen
Abstände Xki numerisch ermittelt. Die zugeordneten Helligkeiten entstanden
ebenfalls numerisch (nach Umrechnung in Einheiten des Sonnenzentrums) durch
lineare Interpolation der auf demselben Kreisbogen liegenden benachbarten
Werte. Zu diesem Zweck wurde ein zusätzliches Rechenprogramm für
die ERMETH aufgestellt, welches die für das Hauptprogramm benötigten
Eingangswerte samt Parameter automatisch in der richtigen Reihenfolge auf
Lochkarten herausdruckt. Eine Wiederholung mit beliebig vorgegebenen Höhen
z an anderen radialen Verteilungen ist deshalb auch in Zukunft möglich.
Die nach dieser Methode auftretende unregelmässige Verteilung der
Abstände auf grösseren Höhen entspricht ungefähr dem
dort wechselnden Gradienten der Helligkeit. Elektronendichte und Polarisation
der auf diese Art (mit a 0,2 und b 0,8 nach [5] bei der Wellenlänge
A~4300 Ä) durchgeführten automatischen Rechnung sind in Tabelle
II für verschiedene Höhen z mitgeteilt. Für einen Schnitt
am Äquator mit 37 Punkten benötigt der Computer 30 Min. Rechenzeit.
Auf grösseren Höhen nimmt diese ungefähr quadratisch ab
mit der Anzahl der Punkte, so dass für einen Polarisationsfall und
für eine Korona im ganzen etwa 6~8 Stunden zu belegen sind.
3. Diskussion der Resultate
Ich danke Herrn Prof. Dr. M. Waldmeier für seine
Unterstützung und sein anhaltendes Interesse an dieser Arbeit sowie
für das zur Verfügung gestellte Material der Korona 1954.
|
||||||||||||||
| Finsler,Paul | Totalendliche Mengen. | 108,(2) 141-152 | ||||||||||||
| B. L. VAN DER WAERDEN in freundschaftlicher Verehrung zu seinem 60. Geburtstag gewidmet |
1. Mengen endlicher Stufenzahl Die Mengen, die im folgenden betrachtet werden, sind reine Mengen, d. h. auch ihre Elemente sind stets nur wieder reine Mengen. Beispiele von solchen Mengen sind die Nullmenge, die kein Element besitzt, und die Einsmenge, welche nur die Nullmenge als Element besitzt. Die Elemente einer Menge m, die Elemente dieser Elemente usf. sind die i n m wesentlichen Mengen. Ist die Menge a in h wesentlich und b in c, so ist auch a in c wesentlich. Wenn der Übergang von einer Menge m zu ihren Elementen, dann zu den Elementen dieser Elemente usf. nur endlich oft ausgeführt werden kann, dann heisst die Menge m von endlicher Stufenzahl. Die in einer Menge endlicher Stufenzahl wesentlichen Mengen sind ebenfalls von endlicher Stufenzahl. Eine Menge endlicher Stufenzahl ist nie in sich selbst wesentlich, denn sonst könnte dieser Übergang unendlich oft fortgesetzt werden. Ist eine Menge h in einer Menge a von endlicher Stufenzahl wesentlich, so ist a nicht in 1> wesentlich, denn sonst wäre a in sich selbst wesentlich. Wenn der Übergang von einer Menge m zu ihren Elementen, dann zu den Elementen dieser Elemente usf. genau s-mal ausgeführt werden kann, dann heisst s die Stufenzahl der Menge in. So hat die Nullmenge die Stufenzahl 0, die Einsmenge die Stufenzahl 1. Eine Menge endlicher Stufenzahl hat zusammen mit den in ihr wesentlichen Mengen eine bestimmte 5 t r u k tu r. Wenn die Mengen a und b dieselbe Struktur haben, d.h. wenn diese Mengen mit den darin wesentlichen Mengen eineindeutig und elemententreu aufeinander abgebildet werden können, dann sind sie i d e n t is c h, andernfalls aber verschieden. Die Einsmenge ist von der Nullmenge verschieden, weil sie ein Element besitzt, während die Nullmenge kein Element besitzt. Es gibt aber nur eine Nullmenge und nur eine Einsmenge. Die Elemente einer Menge müssen stets voneinander verschieden sein. Eine Menge heisst endlich, wenn sie nur endlich viele Elemente besitzt; die Anzahl dieser Elemente heisst die Elementenzahl der Menge. Eine Menge heisst totalendlich, wenn sie selbst und alle in ihr wesentlichen Mengen endlich sind und wenn sie zudem von endlicher Stufenzahl ist. Es soll gezeigt werden: Jede Menge endlicher Stufenzahl ist totalendlich. Die Elemente einer Menge in bilden die erste Stufe von in, die Elemente dieser Elemente die zweite Stufe usf. Eine bestimmte Menge, z. B. die Nullmenge, kann verschiedenen Stufen von in angehören und auch in derselben Stufe öfters auftreten; sie ist aber doch jeweils nur einfach zu zählen. Die letzte Stufe von in besteht notwendig nur aus der Nullmenge, also aus einer endlichen Menge. Wenn die k-te Stufe von in nur aus endlich vielen endlichen Mengen besteht, so gilt dasselbe für die (k- 1)-te Stufe, da sich aus endlich vielen Mengen als Elementen nur endlich viele und nur endliche Mengen bilden lassen. Daraus folgt durch Induktion die Behauptung des Satzes. Die totalendlichen Mengen bilden zusammen einen vielfältigen Strauss, der aber sogleich auseinandergenommen und geordnet werden soll. 2. Die Mengen als Zahlen
|
|||||||||||||
| Waldmeier,Max | Die Sonnenaktivität im Jahre 1962. | 108,153-168 | ||||||||||||
| The present paper gives the frequency
numbers of sunspots, photospheric faculae and prominences as well as the
intensity of the coronal line 5303 Ä and of the solar radio emission
at the wavelength of 10.7 cm, all characterizing the solar activity in
the year 1962.
Die vorliegende Veröffentlichung gibt die die Sonnenaktivität charakterisierenden Häufigkeitszahlen der Sonnenflecken, der photosphärischen Fackeln, der Protuberanzen, die Intensität der Koronalinie 5303 Ä und diejenige der solaren radiofrequenten Strahlung auf der Wellenlänge 10,7 cm. Mean daily sunspot relative-number Mittlere tägliche Sonnenflecken-Relativzahl 37,5 (53,9) Lowest sunspot relative-number Niedrigste Sonnenflecken-Relativzahl 0 (0) Highest sunspot relative-number Höchste Sonnenflecken-Relativzahl 125 (145) Mean daily group-number Mittlere tägliche Gruppenzahl ~3,0 (4,7) Total number of the northern spot-groups Gesamtzahl der nördlichen Fleckengruppen 157 (205) Total number of the southern spot-groups Gesamtzahl der südlichen Fleckengruppen 71 (131) Mean equatorial distance of the northern sunspots Mittlerer Äquatorabstand der nördlichen Flecken 9,8° (11,2°) Mean equatorial distance of the southern sunspots Mittlerer Äquatorabstand der südlichen Flecken 11,4° (10,8°) Surface covered by fields of faculae on the N-hemisphere Bedeckung der N-Halbkugel durch Fackelfelder 5,5% (8,3%) Surface covered by flelds of faculae on the S-hemisphere Bedeckung der S-Halbkugel durch Fackelfelder 2,5% (5,0%) Mean equatonal distance of the northern faculae Mittlerer Äquatorabstand der nördlichen Fackeln 12,5° (14,6°) Mean equatorial distance of the southern faculae Mittlerer Äquatorabstand der südlichen Fackeln 11,6° (11,8°) Mean daily profile-surface of prominences Mittlere tägliche Protuberanzenprofilfläche 3431 (3818) Mean daily value of the total emission of the coronal line 5303 Å Mittlere tägliche Gesamtemission der Koronalinie 5303 Å 447,9 (720,6) Mean daily value of the radio emission at the wavelength of 10.7 cm Mittlere tägliche Radioemission auf Wellenlänge 10,7 cm 90,0 (104,8) The values put in brackets are concerning the year 1961. Die in Klammern gesetzten Werte beziehen sich auf das Jahr 1961. The tables 1, 2 and 10 give the daily values of the relative-numbers,
of the group-numbers and of the radio emission, the tables 3, 4, 5, 7 and
8 contain the distribution in latitude of the spots, faculae, prominences
and of the coronal intensity. Fig. 1 and 3 are showing the course of the
relativenumbers and of the radio emission, and by fig. 2 the distribution
in latitude of the spots, faculae, prominences and of the coronal intensity
is demonstrated.
|
||||||||||||||
| Scheidegger ,Adrian E. | Erdbebenmechanismen. | 108,169-180 | ||||||||||||
| Zusammenhang zwischen tektonischen
Verschiebungs- und Spannungsfeldern
Die statistische Analyse der Nullachsen führt auf eine regionale Verschiebungsachse. Man möchte nun aber auch gerne über das regionale Spannungsfeld etwas aussagen können. Es ist daher wichtig, den Zusammenhang zwischen tektonischen Verschiebungs- und Spannungsfeldern zu untersuchen. Über diesen Zusammenhang kann man keine allgemeingültige Aussagen machen. da die Beziehungen zwischen den Spannungen und den Verzerrungen von der «Rheologie» des Materials abhängen. Wenn man sich aber auf Erdbebenherde beschränkt, kann man wohl annehmen, dass die Vorgänge denen, die der Andersonschen (1942) Theorie der Brüche zu Grunde liegen, entsprechen. In der Andersonschen Theorie nimmt man an, dass die möglichen Bruchflächen einen Winkel von ungefähr 450 mit den Richtungen der grössten und kleinsten Hauptspannung einschliessen und der Richtung der mittleren Hauptspannung parallel sind. Die Andersonsche Theorie stellt nichts anderes als eine sehr vereinfachte Form der bekannten Mohrschen Bruchhypothese dar. In der Andersonschen Theorie nimmt man also an, dass in jedem nicht degenerierten Spannungszustand zwei Bruchflächen möglich sind, die zueinander orthogonal stehen. Falls die eine dieser Bruchflächen realisiert ist, liegt der Verschiebungsvektor so, dass die andere die dazugehörige Hilfsebene darstellt. Wenn man daher annimmt, dass im Mittel die Richtung der grössten Hauptspannung in einem Gebiete konstant sei, dann müssen die restlichen Hauptspannungsrichtungen in einer zu dieser Richtung orthogonalen Ebene liegen. Da die Nullachsenrichtung mit der mittleren Hauptspannungsrichtung zusammenfällt und man annimmt, dass die Nullachsen ungefähr einer Ebene parallel sind, so kommt man also zum Schluss, dass die Bewegungsachse eines Gebietes im Mittel der Richtung der grössten Hauptspannung entsprechen muss. Umgekehrt erlaubt einem daher die statistische Analyse von Erdbebenherdmechanismen, die mittlere Richtung der grössten Hauptspannung in einem Gebiete zu ermitteln. Wenn das unseren Betrachtungen zu Grunde liegende Modell richtig ist, sollte die aus den Nullachsen hergeleitete mittlere PHS-Richtung dieselbe sein wie die, die man erhält, wenn man über die einzelnen PHS-Richtungen der individuellen Erdbeben mittelt. Grosstektonische Betrachtungen
|
||||||||||||||
| Zimmermann,H.W. | Zur Kenntnis des Quartärs der südtunesischen Schottregion. | 108,181-195 | ||||||||||||
| Résumé
Dans le Nefzaoua, au Sud tunisien, se trouve, entre le Djebel Tebaga au Nord et le Chott el Djerid au Sud, une grande zone de piedmont qui a été étudiée dans la région de l'oasis de Kébili. D'un seul oued sortant des montagnes, trois vallées fossilisées sous des dépôts plus récents ont été découvertes et attribuées a de différentes époques du Quaternaire. Le piedmont même est constitué de couches assez jeunes qui ont été identifiées par des trouvailles de fossiles prouvant leur appartenance au Quaternaire ancien. Partant de la connaissance des différents niveaux marins méditerranéens, la régression pléistocène marine de même que les mouvements custatiques du niveau de la mer ont pu être suivis par leurs effets sur la géologie et sur la morphologie de la région étudiée. Ils comprennent les temps entre le Sicilien et aujourd'hui. Vorbemerkung
|
||||||||||||||
| Steiner,Dieter | Beobachtungen über die Verwendbarkeit des Luftbildes bei der geomorphologischen Kartierung in einem Wüstengebiet (Südtunesien). | 108,(2) 197-215 | ||||||||||||
| Résumé
L'article présenté ci-dessous est consacré à l'étude des possibilités de levées cartographiques géomorphologiques basées sur des photographies aériennes de régions arides, aussi bien qu'à la discussion des avantages et des inconvénients qu'offre le matériel photographique employé. On ne doute pas que les chances d'interprétation ne soient bonnes dans différents cas. Si une levée du réseau hydrographique permet certaines conclusions sur le sous-sol, l'étude d'autres formes du relief en fournit davantage, c'est-à-dire qu'avec les formes on peut aussi retracer les types de matériel morphotique; pour identifier le caractère de celui-ci, il est pourtant nécessaire de tracer des coupes à travers le terrain même, à pied. Elles peuvent être préétablies directement sur les photographies aériennes afin de toucher autant de types de sous-sol que possible avec un minimum de marches. Comme les photographies aériennes employées par l'auteur n'avaient pas été faites en même temps, il en résulte la possibilité de comparer l'influence de l'humidité et des actions éoliennes au cours d'une et au cours de plusieurs années. Ainsi, la période d'exsiccation printanière permet de mieux reconnaître des parties de sols à granulation fine; d'autre part, l'aspect des barkhanes dont les surfaces désertiques sont parsemés change après peu d'années à tel point qu'elles finissent par ne plus être reconnaissables. Einleitung
|
||||||||||||||
| Ziegler,B. | Leitfossilien und Faziesfossilien. | 108,(3) 217-242 | ||||||||||||
| 1 Erweiterte Fassung der Antrittsrede
an der Universität Zürich vom 10. November 1962.
Allen Kreationisten sehr empfohlen! |
(Mit 40 Abbildungen im Text)
Dass Fossilien die Überreste von Lebewesen sind, die in früheren Zeiten gelebt haben, ist eine Erkenntnis der Neuzeit. Noch vor 300 Jahren gab es viele Forscher, die lehrten, es handle sich dabei um Zeugnisse einer geheimnisvollen Kraft, der vis plastica, die aus Schlamm und Gestein die Fossilien forme. Wieder andere glaubten, die Fossilien seien nur zufällige Bildungen. Und doch gab es damals Gelehrte, die solche Deutungen ablehnten. Sie suchten nach rationalen Erklärungen. Einer unter ihnen war Leonardo Da Vinci, der in den Fossilien Überreste von Lebewesen erblickte. Diese richtige Auffassung setzte sich erst mit Beginn des 18. Jahrhunderts durch. Es ist vor allem dem Zürcher Arzt und Naturforscher Johann Jakob Scheuchzer zu verdanken, dass die Kenntnis von der organischen Herkunft der Fossilien Allgemeingut der Wissenschaft wurde. Daneben stand er allerdings noch im Banne der überkommenen Vorstellungen seiner Zeit. Er glaubte, dass die Fossilien Überreste von Organismen seien, die bei der Sintflut umgekommen waren. Das Vorkommen aller Fossilien erklärte er also durch eine einzige, weltweite Katastrophe. Schon bald begannen jedoch Schwierigkeiten: Wie war mit einer einzigen Sintflut zu erklären, dass nicht in allen Schichten dieselben Fossilien vorkamen? Um die Mitte des 18. Jahrhunderts vertrat der französische Gelehrte Leclerc De Buffon die Auffassung, es hätten nacheinander sechs bis sieben solcher Überflutungen oder Katastrophen stattgefunden. Nur so konnte er die Abfolge der Fossilien in den Gesteinen deuten. Diese Vorstellung wurde später von seinem Landsmann Georges Cuvier übernommen. Um die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts begann man die zeitliche Bedeutung der Fossilien zu ahnen. Der erste, der diese Vermutung in grösserem Ausmass bestätigen konnte, war 1799 der englische Ingenieur William Smith. Bei Kanalbauten in der Gegend von Bath in Westengland beobachtete er, dass an den verschiedensten Orten immer wieder die gleichen Fossil-Gesellschaften übereinander folgten. Smith schloss daraus, dass Schichten gleichen Alters dieselben Fossilien enthalten; Schichten verschiedenen Alters besitzen andere Fossilien. William Smith entdeckte also, dass gewisse Fossilien für ganz bestimmte Zeitabschnitte der Erdgeschichte leitend sind. Als Entdecker der Leitfossilien ist er zugleich auch der Begründer der Biostratigraphie, das heisst derjenigen Forschungsrichtung innerhalb der Paläontologie, die sich bemüht, die Abfolge der Gesteine und der Zeiten mit Hilfe der Fossilien zu ergründen. Dadurch wurde es möglich, eine relative Chronologie der Erdgeschichte aufzustellen. *
Abb. 1. Geographische Verbreitung der rezenten Muschel
Portlandia arctica (Gray). Die Tiere leben in kaltem, wenig tiefem Wasser
und bevorzugen weiche Schlammböden. Nach S. Ekman 1952, umgezeichnet.
Abb. 3 Verbreitung von Exogyra virgula
Abb. 40. Fazies-Abhängigkeit bei Ammoniten am Beispiel von Aulacostephanus (Untergattung Pararasenia) im Oberjura Mitteleuropas. In der Karte: Schraffiert: Oberjura aufgeschlossen, senkrecht schraffiert: Gebiete mit Flachwasser; waagrecht schraffiert: Gebiete mit tieferem Wasser. Punktiert: Vermutete Landflächen. Unten: Schwarz: Anteil der Untergattung Pararasenia an der Aulacostephanen-Fauna der eudoxus-Zone. Nach B. Ziegler 1962. Leitfossil zu sein und Faziesfossil darzustellen schliessen
sich also gegenseitig nicht aus. Jede Art ist beides zugleich. Ob sie mehr
zum Leitfossil neigt oder ob sie mehr Faziesfossil ist, hängt neben
ihrer Evolutionsgeschwindigkeit allein von ihrer Lebensweise ab. Man darf
deshalb in den Fossilien nicht unbelebte Sammlungsobjekte oder bequeme
Zeitmarken sehen, sondern muss in ihnen die Lebewesen erblicken, welche
sie einst waren. Dann aber belohnen sie uns mit einer reichen Fülle
von Erkenntnissen:
|
|||||||||||||
| Epprecht,W. | Formveränderungen von Textur-Zink bei thermozyklischer Beanspruchung. | 108,243-293 | ||||||||||||
| Zusammenfassung
Die Untersuchungen an Zinkblechen und Zinkdrähten zeigen, dass Zinkmetall mit gerichteter Textur bei thermozyklischer Beanspruchung Formänderungen erfährt, deren Richtungssinn aus der Textur verständlich wird. In Richtungen, in welchen besonders viele Kristalle zu gleiten vermögen, wachsen Zinkproben bei zum mindesten teilweise über Tp (Polygonisationstemperatur) hinausgehender thermozyklischer Beanspruchung, während anderseits in jenen Richtungen Kontraktion erfolgt, in welchen nur wenige oder keine Kristalle zu gleiten vermögen. Die Kontraktionen dürften dabei die passive Folge des ungefähr quer zur Kontraktionsrichtung stattfindenden Materialflusses sein. Ausser der kristallographischen Gleitung finden oberhalb Tp entsprechend wie beim Kriechen, auch Bewegungen infolge von Polygonisation und Korngrenzenfliessen statt, welche offenbar dafür verantwortlich sind, dass die Spannungen in den Kristallen beim oberen Temperaturhalt weitgehend abgebaut werden. Die entfestigten Kristalle können beim nachfolgenden Temperaturzyklus erneut gleiten, während die Bewegungen bei unterhalb von Tp bleibenden Zyklen infolge der von Zyklus zu Zyklus zunehmenden Verfestigung sehr bald zum Stillstand kommen. Summary
|
||||||||||||||
| Bär,O. & Leemann,A. | Klimamorphologische Untersuchungen in Marokko. | 108,(3) 295-357 | ||||||||||||
| Für die Strukturbodenbildung
sind nach unseren Beobachtungen folgende Vorgänge massgebend (Reihenfolge
nach unserer Beurteilung ihrer Wirksamkeit):
- Solifluktion (breiige Auftaumasse als Transportmittel). Frosthub und Frostschub. - Kammeis und Wind (nur leicht modifizierend). An pluvialzeitlichen Formen wurden beobachtet (auf unser engeres Arbeitsgebiet beschränkt): 1. Im Mittleren und Hohen Atlas: Blockströme, Solifluktionsdecken, Glacis-Terrassen 2. Nur im Hohen Atlas: Trogtäler, Kare, Nivationsnischen, Rundhöcker mit Gletscherschliffen, Stufenmündungen D. Zusammenfassung und Hinweise
Ohne Einbezug der Vorkommen in Kältebecken liegt die untere Solifluktionsgrenze in Marokko 500 m bis 600 m tiefer als die untere Strukturbodengrenze. In den Alpen beträgt dieser Höhenunterschied 400 m bis 500 m (Lit. 17). Die Differenz ist gering, die Ähnlichkeit erstaunlich! |
||||||||||||||
| Weiss,Kurt | Gibt es eine Analogie zwischen einer elektronischen Rechenmaschine und dem Gehirn? | 108,(4) 359-371 | ||||||||||||
| Herrn Prof. W. Heitler zum 60. Geburtstag
gewidmet
Institut für theoretische Physik der Universität Zürich |
Einleitung
Es ist üblich geworden, die grossen elektronischen Rechenmaschinen «Elektronen-gehirne» zu nennen. Durch diese Bezeichnung wird die Meinung nahegelegt, dass das Gehirn nichts weiter als eine besonders komplizierte Rechenmaschine ist. Man ist zwar bereit, zuzugeben, dass eine Rechenmaschine kein Bild malen, kein Gedicht schreiben kann etc.; krass zeigt sich das Unvermögen der Maschine, irgend etwas zu tun, was man ihr nicht explizit beigebracht hat, bei der Verwendung zur Übersetzung von Sprachen. Es ist aber weniger bekannt, dass die Maschine sich selbst auf ihrem ursprünglichen Anwendungsgebiet der Mathematik - grundlegend vom Gehirn unterscheidet. Dies zu zeigen ist das Hauptthema dieses Aufsatzes. Die Anregung dazu lieferte eine Diskussionsbemerkung von Prof. M. Fierz im Anschluss an einen Vortrag über die Lernfähigkeit von Maschinen und des Gehirns. In dieser Bemerkung wurde angedeutet, dass die metamathematischen Resultate von Goedel und Church vielleicht einen Beitrag zum Verständnis des Verhältnisses von Maschine und Gehirn zu liefern imstande sind. Im Anschluss daran ergab sich bei Diskussionen in unserem Institut, dass der angedeutete Tatbestand eine präzisere Untersuchung und Darstellung erheischt. Es soll in der vorliegenden Arbeit versucht werden, eine solche Untersuchung zu geben. Im § 1 wird kurz umrissen, warum es möglich ist, überhaupt an eine Analogie zwischen einer elektronischen Rechenmaschine und dem Gehirn zu denken. Basierend auf der Darstellung J. von Neumanns [1] (Zahlen in Klammern beziehen sich auf das Literaturverzeichnis am Schlusse des Aufsatzes), ergänzt durch neuere Daten, wird bereits an dieser Stelle darauf hingewiesen, wie gewaltig die Unterschiede zwischen Gehirn und Maschine sind. Im § 2 werden bekannte naturwissenschaftliche Argumente wiedergegeben, die Indizien zur Verschiedenheit von Rechenmaschine und Gehirn enthalten. Die Bemerkung von Prof. K. Akert [2]: «Noch hat die moderne Hirnwissenschaft erst eine kurze Strecke zurückgelegt, und sie hat einen weiten Weg bis zum Ziel vor sich. Aber es scheinen genug Anhaltspunkte da zu sein, welche die Richtung der naturwissenschaftlichen Arbeit klar vorzeichnen» wird in dem Sinne erläutert, dass gezeigt wird, dass die naturwissenschaftliche Untersuchung des Gehirns ganz andere Probleme stellt und andere Methoden bedingt, als die Analyse der physikalischen Vorgänge in der Rechenmaschine. Im § 3 wird eine erste Übersicht über den Hauptgegenstand des Aufsatzes gegeben, indem die Logik der Rechenmaschine mit der des Gehirns vorläufig verglichen wird. Im § 4 werden die metamathematischen Resultate von Goedel und Church dargestellt (das Haupt-resultat von Goedel wurde in nichtformalisierter Form schon 5 Jahre vor der Arbeit Goedel [15] von P. Finsler [16] ausgesprochen und durch inhaltliches [im Gegensatz zum formalen] Schliessen bewiesen); im § 5 wird ihr Zusammenhang mit Eigenheiten der menschlichen Sprache aufgezeigt. Der § 6 ist der Relevanz der genannten Methoden für den Unterschied der Logik der Rechenmaschine und derjenigen des Gehirns gewidmet. Es wird sich als Resultat ergeben, wie wenig, falls eine Analogie zwischen Maschine und Gehirn überhaupt angenommen wird, damit über das Gehirn und unser Denken ausgesagt ist. Es sei noch zum vornherein festgestellt, dass diese Arbeit in keiner Weise den Anspruch stellt, philosophische Aussagen zu machen. Sie ist vielmehr als Versuch aufzufassen, die logistische Strukturanalyse in ihrer begrenzten Zuständigkeit zur Erforschung des Gehirns darzustellen. Es soll aber daraus nicht gefolgert werden, der Vergleich des Gehirns mit einer Maschine sei gänzlich unfruchtbar. Erstaunlich, und zu einem grossen Teil auch nützlich, sind die in einer elektronischen Rechenmaschine realisierten Analoga zu einfachen Denkprozessen. Wir beschränken uns hier grundsätzlich auf mathematische Denkprozesse. Aber selbst dann zeigt sich, dass mit einer solchen Analogie verschwindend wenig über das mathematische Denken selber ausgesagt ist, oder positiv ausgedrückt: Es zeigt sich, dass grundsätzliche qualitative Unterschiede zwischen einer Maschine und dem Gehirn vorhanden sind. 1. Elektronische Rechenmaschinen und das Gehirn
|
|||||||||||||
| Schneider,Fritz | Systematische Variationen in der elektrischen, magnetischen und geographisch-ultraoptischen Orientierung des Maikäfers. | 108,373-416 | ||||||||||||
| 9. Zusammenfassung
1. Im Schalentest werden Maikäfer (Melolontha vulgaris F.) künstlichen magnetischen und elektrischen Feldern ausgesetzt. Sie erwachen aus der Kältestarre und setzen sich in optisch und mechanisch indifferenter Umgebung in bestimmten Himmelsrichtungen wieder zur Ruhe. Aus diesen Ruhelagen lassen sich ultraoptische Orientierungsreaktionen ableiten. 2. Die künstlichen magnetischen Felder werden mit starken Stabmagneten erzeugt, welche unter den Versuchstischen in der Horizontalebene gedreht werden können; das künstliche horizontale magnetische Feld in den Glassehalen beträgt etwa 10 Gauss, d.h. es ist etwa fünfzigmal stärker als die Horizontalkomponente des erdmagnetischen Feldes. Die Stärke der ebenfalls in der Horizontalebene drehbaren elektrostatischen Felder beträgt in einer Versuchsserie 4,5 V/16 cm, in allen übrigen Versuchen 100 V/16 cm. 3. Neben magnetischen und elektrischen Feldern nehmen die Maikäfer noch weitere, vektoriell bestimmte, durch Mauern, Glas und einen Faradaykäfig dringende ultraoptische Felder oder Strahlen wahr, welche bisher noch nicht identifiziert werden konnten; sie sind für die ultraoptische und speziell für die geographische Orientierung von grosser Bedeutung und werden im folgenden «Melofelder» genannt. 4. Ultraoptische Orientierungsreaktionen äussern sich in einer Bevorzugung bestimmter Richtungen und Sektoren in bezug auf die Vektoren wirksamer physikalischer Felder; oft werden entgegengesetzte Richtungen oder solche, welche in der Art eines Achsenkreuzes rechtwinklig aufeinanderstehen, gleichzeitig bevorzugt. 5. Unter geographisch-ultraoptischer Orientierung wird eine bestimmte Körpereinstellung in bezug auf die geographische Nordsüd-Achse unter Ausschluss optischer und anderer trivialer Bezugssysteme verstanden. Um solche Reaktionen von der Ausrichtung nach den Vektoren künstlicher magnetischer und elektrischer Felder zu trennen, sind die letzteren richtungsvariabel, d.h. ihre Himmelsrichtung wird von einem Versuchstier zum folgenden verändert. 6. Die Orientierung nach den verschiedenen Bezugssystemen lässt sich in getrennte Kreis- oder Punktdiagramme eintragen. Die für unsere Schlussfolgerungen wichtigsten Diagramme sind vom Laboratorium für Biometrik und Populationsgenetik der Eidg. Techn. Hochschule in Zürich (Prof. Dr. H. L. Le Roy) einer statistischen Prüfung unterzogen worden. 7. Im Versuch 9 bevorzugen und meiden die Käfer ganz bestimmte Sektoren in bezug auf ein magnetisches Feld; die Sektoren drehen sich gleichförmig im Sinne des Uhrzeigers. Diese Art systematisch variabler magnetischer Orientierung ist mit einer Zufallswahrscheinlichkeit von etwa 1,2 10-8 statistisch sehr gut gesichert. Bei bestimmten Feldstellungen besteht zudem eine Korrelation zwischen den Himmelsrichtungen der magnetischen Felder und der Orientierung. 8. Versuch 10 beweist, dass sich die Maikäfer gleichzeitig elektrisch und geographisch orientieren können; die bevorzugten Sektoren in bezug auf die beiden Bezugssysteme sind etwa gleich breit und bewegen sich mit ähnlicher Geschwindigkeit gegen den Uhrzeiger. Die Zufallswahrscheinlichkeit für diese Art systematisch variabler elektrischer und geographisch-ultraoptischer Orientierung beträgt nur etwa 1,6 l0-~ bzw. 1,6.10-6. 9. Im Versuch 14 wurden Feineinstellungen der Vektoren künstlicher magnetischer Felder in Intervallen von 1/4 Teilstrich (- 1/256 des Kreisumfanges) in ihrem Effekt auf die geographische Orientierung miteinander verglichen. Solche stufenweise Drehungen eines magnetischen Feldes gegenüber dem Komplex der «Melofelder» in der Grössenordnung eines Winkelgrades haben systematische Änderungen in der Richtungswahl in der Grössenordnung von 50 Winkelgraden zur Folge (Irrtumswahrscheinlichkeit kleiner als 1. l0-~). 10. Wird das Verhalten der Käfer in einem längeren Versuch bei zwei Magnetstellungen, welche nur um 3/4 Teilstriche voneinander abweichen, miteinander verglichen (Versuch 15), lässt sich feststellen, dass durch diese relative Richtungsänderung des künstlichen magnetischen Feldes gegenüber den «Melofeldern» nicht nur die momentane Richtungswahl der Käfer, sondern auch die Breite, der Drehsinn und die Drehgeschwindigkeit der bevorzugten Sektoren und die Aktivität verändert werden (Irrtumswahrscheinlichkeit für die Aussage über die unterschiedliche Punktbesetzung in beiden Diagrammen etwa 1 10-3). 11. Im Versuch 16 werden geographische und elektrische Orientierung unter dem Einfluss von zwei Stellungen künstlicher magnetischer Felder, welche nur um 1 Teilstrich voneinander abweichen, miteinander verglichen. Neben den unter 10 aufgeführten Wirkungen sind noch folgende Effekte beobachtet worden: Umwandlung einer geographischen in eine elektrische Orientierung (Irrtumswahrscheinlichkeit kleiner als 1. 10-~), Phasenverschiebung in der überindividuellen Aktivitätsperiodik. 12. Aus allen diesen Befunden wird geschlossen, dass manche systematische Variationen in der ultraoptischen Orientierung, spontane Umstellungen in der Drehrichtung bevorzugter Sektoren, Wechsel von vorwiegend geographischer nach elektrischer Orientierung und umgekehrt (Versuch 11), überhaupt Änderungen im u. 0. Orientierungsverhalten und in der Aktivität auf eine relative Richtungsänderung von «Melofeldern» zurückzuführen seien. 13. Nicht alle ultraoptischen Orientierungsreaktionen lassen sich aus der Stellung wirksamer Feldvektoren geometrisch erklären; wahrscheinlich werden Informationen über Lage und Lageänderungen der Vektoren zentralnervös verarbeitet und in Form bestimmter Körperstellungen auf die Vektoren physikalischer Felder transponiert. 14. Da die physikalische Natur der «Melofelder» und das Programm ihrer Variationen noch kaum bekannt sind, kann in bezug auf ultraoptische Orientierung keine Prognose gemacht werden. In Serien von 11 und 8 vergleichbaren Versuchen an verschiedenen Tagen wurde nur je einmal eine aussergewöhnliche Orientierungsleistung erzielt, welche sich von einer zufälligen Richtungswahl sehr deutlich unterscheidet (Versuchsreihen 12 und 13). Die beiden Treffertage (Irrtumswahrscheinlichkeit für die Annahme einer ultraoptischen Orientierung etwa 6,8 10-~ und 1 10-~) fielen mit besonderen Mondphasen zusammen. Summary 1. Cockchafers (Melolontha vulgaris F) exposed to artificial magnetic and electrostatic fields in horizontal dark Petri dishes (Fig. 1) move affer overcoming cold stupor, and stop in a definite direction; this final position is not random but a result of ultraoptic orientation. 2. The artificial magnetic fields are produced by strong movable bar magnets placed horizontally below the tables; the horizontal field strength inside the dishes is about 10 Gauss, i. e. fiffy times more than the horizontal component of the earth's natural field. The strength of the movable horizontal electrostatic fields was in one study 4.5 V/16 cm, in all others 100 V/16 cm. 3. Cockchafers exhibit a response to magnetic and electrostatic fields and to the vectors of unidentified physical factors pervading walls, glass and a Faradaycage. These unidentified factors contribute to ultraoptic, especially geographic-ultraoptic orientation, and are called ,,melofields". 4. Ultraoptic orientation appears as a selection of definite sectors or directions relative to the vectors of effective physical fields; simultaneously preferred sectors deviate frequently 900 or 1800 (Fig. 6, 8, 11). 5. Geographic-ultraoptic orientation is a type of azimuthal orientation without reference to light or another trivial directional stimulus. In order to separate these reactions from those relative to vectors of experimental magnetic and electric fields, we must rotate these artificial fields of stimulation from one individual to the other. 6. The results are condensed in circle and correlation diagrams. The most important figures have been analysed statistically by the Laboratory of Biometry and Population Genetics of the Federal Institute of Technology at Zurich (Prof. Dr. H. L. Le Roy). 7. The cockchafers can select and avoid definite sectors relative to a vector of a magnetic field (experiment 9, Fig. 2a); these sectors rotate continuously clockwise (P 1,2.10-8). In addition to these reactions a limited correlation between azimuthal position of magnetic fields and orientation was observed. 8. Experiment 10 demonstrates that cockchafers can combine azimuthal (Fig. 4 a) and electric (Fig. 4b, solid circles) orientation. The selected sectors relative to these two direction-indicating systems have approximately the same angle and rotate counterclockwise at a similar speed (P~1,6~10-~ and 1,6.10-6 resp.). 9. Experiment 14 (Fig. 12) pertains to responses to different azimuthal angles of magnetic fields; turnings of the magnetic vectors relative to the ,,melofields" of about 10 cause shiffs of the preferred sectors of about 500 (P< 1. 10-~). 10. An azimuthal turning of a magnetic vector of 40 (experiment 15, Fig. 14) affects the position, the angle and the sense and speed of rotation of the preferred sectors and the activity of the cockchafers. (P for differences in pomt distribution of the two diagrams 1 10-~.) 11. If cockchafers are exposed to vectors of electric fields an azimuthal turning of a magnetic vector of 5 ½ 0 (experiment 6, Fig. 15) causes additional responses: inversion of geographic (azimuthal) to electric orientation (Fig. 16, a~d) (P< 1 10-~) and phase-shiffing of activity rhythm (Fig. 17). 12. From all these and similar experimental studies conducted with Melolontha it is now possible to conclude that (1) systematic variations of ultraoptic orientation (2) spontaneous changes of clockwise to counterclockwise rotation of preferred sectors (Fig. 5 a), (3) inversions of geographic to electric orientation (experiment 11, Fig. 5, 6) and (4) rhythmical changes in activity are frequently induced by relative turnings of vectors in the whole complex of ,,melofields". 13. lt would appear impossible to give for all these responses a rational explanation based only on the hypotheses of faceted sense organs and ,,nonius-effect" or similar geometrical considerations. Information on the position and movements of vectors must be integrated in the central nervous system and transposed as ,,preferred angle" to the vectors of physical fields. 14. We cannot yet predict definite ultraoptic orientational responses since the physical nature of the ,,melofields" and the programme of their variations is as yet unknown. In two series of 11 and 8 comparable experiments only one in each series yielded useful results: experiments 12 (Fig. 7, 8) and 13 (Fig. 9, 10). These events (P for ultraoptic orientation 6,8 10-~ and 1 10~~) coincided with special moon-phases. |
||||||||||||||
| Güller,A. | Meteorologische Betrachtungen zur Zürichseegefrörne 1963. | 108,417-426 | ||||||||||||
| Der «Seegfrörni-Winter»l963
liegt längst hinter uns, und statt des seltenen Vergnügens, mit
den Schlittschuhen über die weite, ebene Fläche zu ziehen, erfreuen
wir uns wieder am Baden und Schwimmen in den erfrischenden Fluten unserer
Seen. Langsam verblassen damit die Eindrücke, die das seltene Ereignis
einer totalen Seegefrörne uns gebracht hat, in unserer Erinnerung.
Zwar haben hübsche Postkarten und Sondernummern der Tageszeitungen das Wesentlichste der denkwürdigen Ereignisse festgehalten und werden das fröhliche Treiben bei Jung und Alt noch viele Jahre in der Erinnerung wach halten. Der Seegefrörne-Winter mit seiner beinahe arktischen Kälte brachte aber neben der Volksbelustigung eine ganze Menge von Nebenerscheinungen mit sich, die wir sonst bei uns nicht zu sehen bekommen. Ihr Studium ist normalerweise in unsern Breiten nicht möglich. Zu diesen gehören all die Vorgänge, die mit der Bildung und dem Zerfall der Eisdecke zusammenhängen. Von ihnen soll im folgenden die Rede sein. Vorerst ist es von Interesse, sich von der Strenge dieses Winters anhand von Vergleichen einen Begriff zu machen. Die Tatsache allein, dass nördlich der Alpen ausser dem Vierwaldstätter- und dem Walensee fast sämtliche Schweizerseen zufroren, gibt nur einen relativen Begriff für die Strenge des Winters. Besser vermag eine Gegenüberstellung mit früheren Seegefrörnen anhand von Zahlenwerten auf Grund konkreter Messungen darüber ein Bild zu geben. Zur zahlenmässigen Kennzeichnung der Härte eines Winters gibt es verschiedene Möglichkeiten. Meistens beruhen sie auf meteorologischen Messungen und deren Vergleich mit andern Jahren nach bestimmten Gesichtspunkten. Ein lückenloses und einheitliches Material liegt bei uns seit der Gründung des schweizerischen meteorologischen Dienstes, d.h. seit 1864 vor. Auf Grund dieses Materials, das unter anderem lückenlose Temperaturreihen umfasst, lässt sich die Härte eines Winters nach verschiedenen Kriterien zum Ausdruck bringen. |
||||||||||||||
| Clusius,K. | Physikalische Bemerkungen zur Zürichseegförni 1963. | 108,427-430 | ||||||||||||
| II.
Kleine thermodynamische Betrachtung zur « Seegfrörni »
A. Die Voraussetzungen zum Eintritt einer «Seegfrörni», die im Durchschnitt etwa dreimal in einem Jahrhundert vorkommt, sind günstig, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind: 1. Kaltes, windiges Wetter am Anfang des Winters (vor Weihnachten), durch das die konvektive Durchmischung des Wassers und seine Abkühlung auf das Dichtemaximum bei 4° C befördert wird. 2. Anschliessend anhaltende Kälte mit relativ wenig Wind, damit die unter 4°C abgekühlte Oberflächenschicht des Wassers schwimmen bleibt und nicht mit dem wärmeren Tiefenwasser durchwirbelt wird. Der Wind wird unschädlich, sobald die erste dünne Eisschicht vorliegt. Er erhöht dann sogar die Wärmeübergangszahl Luft Eis und befördert die Eisbildung. Eine auftretende Schneedecke ist jedoch wegen ihrer geringen Wärmeleitfähigkeit ungünstig. B. Die Eisdecke schwimmt auf dem Wasser und hat an der Unterseite exakt 0° C, auf der Oberfläche dagegen annähernd die Lufftemperatur -d C. Durch die Eisfläche F von der Dicke x fliesst von der Unterseite nach der Oberfläche ein Wärmestrom, der von der Kristallisation neuen Eises herrührt. Dieser Wärmestrom ist dem vertikalen Temperaturgradienten im Eis [0°-( -d°)]/x = d°/x proportional. Während der Zeit dt nimmt dadurch das Eis um dx an Dicke zu, und mit der Schmelzwärme Le und der Dichte r wird FLredx = Fld/x dt, (1) wobei l die Wärmeleitzahl
ist. Integriert wird
Zur Zeit t=0 ist auch x=0 und somit C=0, also x=sqrt( 2ldt/Ler) ~ Sqrt(dt) Die Dicke der Eisschicht ist daher der Wurzel aus dem
Produkt von Kältegrad in Celsius und Zeit proportional. Übrigens
ist l von Eis mit ~ 0,0045 cal/cm sec
Grad etwa 200mal kleiner als die Wärmeleitung von Kupfer.
|
||||||||||||||
| Lemans, A. | Der Firnzuwachs pro 1962/63 50. Bericht | 108,431-441 | ||||||||||||
| Resumé 1962/63
Die Niederschläge waren im hydrologischen Jahr 1962/63 allgemein unternormal, besonders während der Akkumulationsperiode Oktober-Mai. Die sommerliche Ablation, die hauptsächlich im Juli erfolgte, war leicht übernormal, so dass ein unterdurchschnittlicher Jahres-Firnzuwachs resultierte. Die Firngebiete oberhalb ca. 2800 m wurden bereits am 18. August 1963 wieder eingeschneit, während in tieferen Lagen der Abschmelzprozess bis zum 1. Oktober 1963 andauerte und mehrjährige Firnrücklagen abtrug. H. Nachwort Wir möchten diesen Bericht nicht beenden, ohne darauf hinzuweisen, dass die systematischen Beobachtungen über Schneefall und Firnzuwachs im Claridengebiet vor genau 50 Jahren begonnen und seither trotz allen Schwierigkeiten ohne Unterbrechung fortgesetzt wurden. Im November 1913 wurde die Gletscherkommission der Physikalischen Gesellschaft Zürich (später Zürcher Gletscherkommission genannt) ins Leben gerufen mit dem Ziel, den Haushalt einiger ostschweizerischer Gletschergebiete zu untersuchen, um auf diese Weise die Arbeiten der Gletscherkommission der SNG zu unterstützen. Von Anfang an sollten regelmässige Firnzuwachsmessungen sowie Niederschlagsmessungen mittels am Gletscherrand aufgestellten Totalisatoren die nötigen Unterlagen liefern. Die Gründungsmitglieder dieser Kommission waren Dr. R. Billwiller (später Direktor der MZA), Prof. A. DE Quervain und Ing. F. Rutgers. Die Berichte Nr.1 bis 7 wurden in «SKI», Jahrbuch des Schweiz. Skiverbandes, die nachfolgenden in der Vierteljahrsschrift der NGZ publiziert. Am 20. Oktober 1913 wurde ein erster Schneepegel auf festem Grund in der Nähe der Claridenhütte aufgestellt und im Herbst 1914 eine sogenannte «Boje» im Claridenfirn selbst verankert. Noch im selben Jahr wurden bei der Silvrettahütte ein fester Schneepegel und ein Totalisator aufgestellt und am Neujahrstag 1915 konnte auf dem Silvrettafirn ebenfalls eine Boje plaziert werden. Somit liegen eigentliche Firnzuwachsmessungen seit dem Winter 1914/15 vor. In einzelnen Jahren sind die Resultate allerdings recht unsicher, sei es, weil eine Boje in einer Gletscherspalte verschwand oder wegen sehr starker Abschmelzung umfiel, oder weil die Beobachter im Herbst wegen schlechtem Wetter und grossen Neuschneemengen ihr Messprogramm nur unvollständig durchführen konnten. Ohne die Tatkraft und Ausdauer einzelner langjähriger Kommissionsmitglieder und Mitarbeiter wären in der Sojährigen Reihe bedeutend mehr Lücken entstanden. Vergessen wir nicht, dass das Begehen von Gletschern recht mühsam sein kann, wenn man allerlei Messutensilien mittragen muss, und ausserdem seine Tücken hat. Einmal hing sogar ein Beobachter zweieinhalb Stunden lang in einer Gletscherspalte und konnte nur mit Mühe von seinem einzigen Begleiter gerettet werden. Wir möchten hier insbesondere an Dr. h. c. Rudolf Streiff-Becker (1873-1959) erinnern, den grossen Kenner der Glarner Alpen, der ein Vierteljahrhundert lang, bis zu seinem fünfundsiebzigsten Lebensjahr aktiv an diesen Gletschermessungen teilgenommen hat, und an Dr. R. Billwiller, der während 30 Jahren für die Jahresberichte verantwortlich zeichnete. Im Jahre 1946 ging die Verantwortung für das Messprogramm auf die MZA über und die Zürcher Gletscherkommission löste sich auf. Dass die MZA für die Arbeiten im Felde auf die Mitarbeit von anderen Instituten und Einzelpersonen angewiesen ist, wurde schon in der Einleitung dieses Berichtes festgehalten. Es sei uns hier gestattet, wieder einmal an die Öffentlichkeit zu appellieren und alle Skitouristen und Bergsteiger, die den Clariden- oder Silvrettafirn betreten oder auch nur die gleichnamigen Hütten besuchen, freundlich zu bitten, die in den Hütten aufliegenden Meldekarten (die Portofreiheit geniessen!) zu benützen und uns Pegelablesungen (oder besondere Beobachtungen, z. B. Staubfall, Stange umgefallen) zuzusenden. Die in den Hütten angeschlagene «Gebrauchsanweisung» sollte für jedermann verständlich sein. Sie können unserer Dankbarkeit gewiss sein. F. Rutgers schrieb in seinem ersten Bericht (Oktober 1914): «Sowohl in der Claridenhütte wie auch in der Silvrettahütte wurde ein Buch aufgelegt (abgesehen von den Meldekarten), worin die Touristen die jeweilige Schneehöhe eintragen können. Ich hoffe, dass dies regelmässig geschieht. In der Claridenhütte sind die Eintragungen während des ganzen Winters durch Skiläufer freundlichst gemacht worden, wofür ich den Betreffenden hiemit bestens danke. Ohne die fortwährende Mithilfe aller Touristen wären diese Arbeiten unmöglich, und ich hoffe, dass diese Zeilen dazu beitragen werden, weitere Touristen, insbesondere Skiläufer, für die Ablesung unserer Apparate zu gewinnen.» Ist es nicht eigenartig, dass im hydrologischen Jahr 1962/63 kein einziger Bergsteiger oder Skifahrer uns eine Meldung schickte? Man kann doch nicht behaupten, dass der Wintersport in unseren Tagen viel weniger betrieben wird als Anno 1914! Von 1947 bis 1962 ruhte die Verantwortung für die Bearbeitung und Publikation der Messresultate sowie für einen Teil der Feldarbeiten auf W. KUHN, Meteorologe der MZA. Nun ist diese Aufgabe auf den Schreibenden übergegangen. Der Berichterstatter möchte seinem Kollegen an dieser Stelle herzlich danken für die Art und Weise, mit der er ihn in diese Materie eingeführt und beraten hat. |
||||||||||||||
| Burla, H. | Die öffentlichen naturhistorischen Sammlungen und die medizinhistorische Sammlung beider Hochschulen in Zürich im Jahre 1962 | 108,442 | ||||||||||||
| Mit den nachfolgenden Beiträgen
wird die vor einem Jahr begonnene Berichterstattung über die öffentlichen
naturwissenschaiflichen Sammlungen in Zürich fortgesetzt. Für
die mineralogisch-petrographische und für die geologische Sammlung
der ETH liegen dieses Jahr keine Berichte vor, da sich die Verhältnisse
an diesen zwei Sammlungen seit dem letzten Jahr nicht stark verändert
haben.
Wiederum sei den Behörden und Gönnern gedankt für die Förderung, die den Sammlungen zugute kam. Ebenfalls zu Dank verpflichtet fühlen sich die Vorstände der Sammlungen allen denjenigen Mitgliedern der Naturforschenden Gesellschaft gegenüber, die mit Interesse die Entwicklung der Sammlungen verfolgen und sie besuchen. |
||||||||||||||
| Markgraf, F. | Der Botanische Garten und das Botanische Museum der Universität Zürich | 108, 442-444 | ||||||||||||
| 3. Bearbeitungen
Technisch: Das Moos- und das Flechtenherbar wurden nach der modernen Literatur neu geordnet. Aus dem ganzen Herbar wurden die sogenannten Typen, auf die die Erstbeschreibung einer neuen Art gegründet ist, herausgezogen und besonders gesichert. Wissenschaftlich: Die eigenen Mitarbeiter und Dauergäste bearbeiteten folgende Pflanzenfamilien und Sammlungen: Prof. Dr. F. Markgraf (Gnetaceen aus Malesien, einzelne Pflanzen der eigenen Sammlung aus der Türkei, Apocynaceen aus Brasilien); Dr. 0. Rohweder (Commelinaceen und Bromeliaceen); Frau Dr. DE Mendoza-Heuer (Türkei-Sammlung Markgraf, Sammlung Michaelis, Kanaren); Frau Prof. Markgraf (Festuca des Schweizer Herbars und des Generalherbars); Dr. H. U. Stauffer (Santalales); Dr. Hartmann (Karakorum-Pflanzen); Dr. H. Hürlimann (Pflanzen aus Neu-Kaledonien). Auswärtige Gäste lieferten Bestimmungen aus ihren Spezialgebieten: PD. Dr. Hantke, ETH (fossile Pflanzen von Schrotzburg); Prof. Dr. H. Saint JohN aus Honolulu (Pandanaceen); Prof. Dr. A. Guillaumin in Paris bestimmte Pflanzen der Sammlung Baumann-Hürlimann. |
||||||||||||||
| Burla, H. | Das Zoologische Museum der Universität Zürich | 108, 444-447 | ||||||||||||
| Sammelreise
In der Zeit vom 11. April bis 6. August 1962 führte das Zoologische Museum eine Sammelreise nach der Türkei und nach Persien durch. Teilnehmer waren die Herren cand. phil. Walter Götz, cand. phil. Rolf Nöthiger und Laborant Otto Krauer. Der Anlass zum Unternehmen ergab sich aus der Notwendigkeit, für eine cytologisch-populationsgenetische Arbeit Muster von Drosophila subobscura aus nahöstlichen Populationen zu sammeln. Dabei wurde die Gelegenheit benützt, um intensiv Wirbeltiere für unsere Unterrichts- und Schausammlung zu beschaffen. Als Exkursionsfahrzeug diente ein VW-Bus mit Anhänger (Abb. 1). Der Weg führte über 27000 km durch Jugoslawien, Rumänien in die Türkei und von dort über Kleinasien nach Persien bis Teheran und ans Kaspische Meer. Die Rückreise erfolgte über Trabzon, Istanbul und Thessaloniki. Die Ausbeute an Wirbeltieren zählt 339 Katalognummern, nämlich 26 Amphibien und Reptilien, 271 Vögel und 42 Säugetiere. Unter den Vögeln sind Reiher, Störche und Ibisartige mit fast allen europäischen Arten vertreten; Raubvögel, Eisvögel, Bienenfresser, Racken, Hopfe, Kuckucke, Limicolen und Sperlinge steuern ebenfalls reichhaltiges Material bei. Unter den Säugetieren figurieren Wildschwein, verschiedene Caniden, Sumpfluchs, Alpenpfeifhase, Ziesel, Pferdespringer, Sciurus anomalus, zwei Arten Igel und weitere Arten, die teils noch der Bestimmung bedürfen. Der Zustand des grössten Teils der Ausbeute wird als gut bewertet; nur einzelne Bälge und Häute sind unbrauchbar. Gute Stücke sind teils als Ersatz für gegenwärtig in schlechtem Zustand ausgestellte Präparate vorgesehen; ein weiterer Anteil wird der Balg- und Fellsammlung des Museums einverleibt. Eine Sammlung von Haussperlingen in 10 Mustern zu 10 Individuen wird biometrisch bearbeitet. Bestandeszunahme Nebst der Nahostexkursion brachten uns Schenkungen des Zoologischen Gartens, der Schweizerischen Vogelwarte Sempach und mehrerer privater Gönner zahlreiche wertvolle Tiere ein, u. a. Eisbär, Braunbär, Rentier, Habicht, Brandente. Ferner erhielten wir vom Schweizerischen Blindenmuseum 26 Schachteln Conchylien. Neuzugänge werden jeweils wie folgt verarbeitet: Gut erhaltene Kadaver, von welchen wir nicht bereits schöne Präparate besitzen, werden zu Ausstellungszwecken präpariert, wobei grössere Tiere nach dermoplastischer Methode aufgestellt werden. Rein wissenschaftliches Material konservieren wir in Form von Balg- oder Flüssigkeitspräparaten. Vom restlichen Teil der Eingänge werden lediglich die Skelette und Häute gewonnen. |
||||||||||||||
| Kuhn-Schnyder, E. | Das Paläonthologische Institut und Museum der Universität Zürich | 108, 447-451 | ||||||||||||
| Abb. Der erste Halbaffe aus dem Kanton Zürich Microchoerus sp. Aus einer Spaltenfüllung des Eocaens eines Steinbruchs bei Dielsdorf. Unterkieferfragment mit M1-M3. | ||||||||||||||
| Steinmann, Alfred | Die Sammlung für Völkerkunde der Universität Zürich | 108, 451-453 | ||||||||||||
| Bilder: Tempelpauke Nepal; geschnitzte Türverzierung Nepal | ||||||||||||||
| Ackerknecht, E.H. | Die medizinhistorische Sammlung der Universität Zürich | 108, 453 | ||||||||||||
| von den Erben Prof. Felix
Nager 650 Medaillen mit Portraits berühmter Aerzte und Naturwissenschafter.
180 Briefe von Auguste Forel- |
||||||||||||||
| Leibundgut, Hans | Naturschutzkommission; 18. Jahresbericht für das Jahr 1962 | 108, 454 | ||||||||||||
| Die Liste für Naturschutzobjekte
von wissenschaftlicher nationaler Bedeutung wurde ergänzt und der
vom Schweizerischen Bund für Naturschutz eingesetzten Kommission unterbreitet.
Von mehreren Wissenschaftern wurden uns zu diesem Zweck ausgezeichnete
Gutachten zur Verfügung gestellt. Dem Redaktor unserer «Vierteljahrsschrift»,
Herrn PD. Dr. Thomas, ist zu verdanken, dass wiederum mehrere dieser Gutachten
veröffentlicht werden konnten. Das weit über die NGZ hinausreichende
Interesse für diese Veröffentlichungen geht daraus hervor, dass
die Direktion der öffentlichen Bauten des Kantons Zürich der
Presse, allen berührten Gemeinden, den Verwaltungsabteilungen, verschiedenen
Kommissionen, Verbänden und Einzelpersonen Sonderdrucke mit einem
Begleitschreiben überreichte. Diese Unterstützung unserer Bestrebungen
ist dankbar anzuerkennen.
Beschlüsse der Kommission des SBN für die Naturschutzobjekte von nationaler Bedeutung liegen bereits für folgende von uns vorgeschlagene Objekte vor: Beschluss 12: Rheinfall, 23: Lägern, 41: Robenhauserriet, 45: Neeracher Riet, 48: Albiskette-Reppischtal, 55: Sihltallandschaft Sihlbrugg-Schindellegi, 66: Drumlinlandschaft bei Wetzikon, 78: Kerngebiet der Töss, 89: Irchel. Leider ist durch diese Beschlüsse und das Verständnis der kantonalen Stellen der Schutz dieser Objekte noch nicht sichergestellt. Von grosser Wichtigkeit ist das Ergebnis der Volksabstimmung vom 26. Mai 1963 über «Gesetz über die Finanzierung von Massnahmen im Interesse des Natur- und Heimatschutzes». Eine gute Zusammenarbeit mit dem Schweizerischen Bund für Naturschutz, dem Büro für Regionalplanung des Kantons Zürich, dem Beauftragten für Natur- und Heimatschutz und dem Zürcherischen Naturschutzbund erleichterte uns die rasche und erfolgreiche Erledigung zahlreicher anderer Aufgaben. Vor allem aber ist den Mitgliedern der Naturschutzkommission für die jederzeit bereitwillige und aufbauende Mitarbeit zu danken. |
||||||||||||||
| Hantke,René | Naturschutzobjekte von wissenschaftlicher Bedeutung. Die schieferkohleführenden Schotter am Buechberg (Zürcher Obersee). | 108,455-458 | ||||||||||||
| Wenn mit den schieferkohleführenden
Schottern des Buechberges am Zürcher Obersee auf ein ausserkantonales
Naturschutzobjekt von nationaler Bedeutung hingewiesen wird, so geschieht
dies deshalb, weil die Beziehungen Zürichs zum Buechberg bereits sehr
alt sind und auch stets sehr eng waren. Schon in römischer Zeit und
später während langer Jahrhunderte lieferten die Molassesandsteine,
die auf der Nordseite des Buechberges gebrochen wurden, geschätzte
Bausteine für die zahlreichen Bauten der Stadt: fürs Grossmünster,
den Chor der Predigerkirche sowie für zahlreiche Steinmetz- und Bildhauerarbeiten
(F. De Quervain 1962). Heute dienen die Sandsteine des Buechberges vor
allem als Natursteinverkleidungen von Kunstbauten und für gartenarchitektonische
Zwecke. Bei Guntliweid schlossen sie eine individuenreiche fossile Flora
mit Campher- und Palmblättern ein, die, wie auch verschiedene kleinere
Schneckenfaunen, erst durch den Steinbruchbetrieb zutage gefördert
wurden (R. Hantke 1956, H. K. Zöbelein 1963).
Auf der Südseite der enggestauchten Molassesynklinale gelangten jungquartäre Sedimente in bedeutender Mächtigkeit zur Ablagerung. Darin wurden um 1830 Schieferkohlen entdeckt, die in der Folge verschiedentlich ausgebeutet wurden, wobei wiederum der grösste Teil per Schiff nach Zürich verfrachtet wurde (A. Jeannet in E. Baumberger et alii 1923). Seit 1910 erweckten jedoch die begleitenden Sand- und Kiesschichten ein immer grösser werdendes Interesse als die aschenreiche und stark schwefelhaltige Schieferkohle selbst. Seit einigen Jahrzehnten bauen die KIBAG und die Bollenberg AG in riesigen Kieswerken Sand und Kies ab, um den gewaltigen und immer noch steigenden Bedarf der Stadt und ihrer Umgebung decken zu helfen. Seit 1960 wird zudem noch im Areal Girendorf ausgebeutet. Während sich Naturschutzbestrebungen geologischer Objekte bisher im Mittelland vor allem auf grosse Erratiker als Zeugen der Eiszeit beschränkten, trifft bei den schieferkohleführenden Schottern des Buechberges einer jener Fälle zu, auf die neulich auch H. Jäckli (1961, 273) hingewiesen hat, wo es gilt, so merkwürdig dies klingen mag, einen künstlich geschaffenen Aufschluss zu schützen und dadurch erst durch künstliche Eingriffe zutage getretene Ablagerungen und Strukturen vor ihrem ... |
||||||||||||||
| Heim,P.Johannes | Naturschutzobjekte von wissenschaftlicher Bedeutung. Das Nuolener Ried. | 108,459-465 | ||||||||||||
| Als kleiner Rest eines
weiten Riedlandes, welches ein ehemaliges Schwemmland der Linth und der
Wägitaler Aa überdeckt, liegt das Nuolener Ried am Südufer
des Zürcher Obersees (Abb. 1). In 5 Zonen offenbart sich zwischen
der Mündung der Wägitaler Aa und dem Buechberg ein Verlandungsprozess,
wie man ihn selten in solcher Vollkommenheit zu sehen bekommt (Abb. 2).
1. Flora Ein durchschnittlich 7 m breiter Schilfgürtel (Phragmitetum) leitet mit der Vetegationszone 1 die Verlandung ein. Am West- und Ostzipfel ist Phragmites communis von der Seebinse (Schoenoplectus palustris) so stark durchsetzt, dass man von einem Schoenoplecto-Phragmitetum sprechen könnte. Nur an einer Stelle ist noch Nuphar Abb. 1. Das weite, ehemalige Ried ist bis auf einen kleinen, aber kostbaren Teil am See zusammengeschrumpft. Foto: P. Heim. |
||||||||||||||
| Redaktion | Zum Naturschutzobjekt Rheinfall | 108, (4) 465 | ||||||||||||
| Aus dem Bericht der Naturschutzkommission
der Naturforschenden Gesellschaft
Schaffhausen, 1962 Am 8. November befasste sich die Naturschutzkommission mit der geplanten Gemeinschaftskläranlage, nachdem sie vorher nie zu einer Stellungnahme aufgefordert worden war. Nach gewalteter Diskussion gelangte sie zum Schluss, dass der Bau in der Röti nicht tragbar sei, da der Eingriff in allernächster Nähe des Rheinfalls erfolgt und diesem Naturdenkmal keine weitere Schmälerung zugemutet werden dürfe. Eine Schmälerung des Rheinbettes und eine ganz unnatürliche Aufschüttung des Rötiareals durch die SIG seien mit dem Naturdenkmal Rheinfall unvereinbar. Eine Kläranlage im Bereich des Fischerhölzlis wäre dem Projekt Röti vorzuziehen. Es wird einstimmig eine Resolution in diesem Sinne beschlossen und eine Unterstützung des Komitees gegen den Bau der Kläranlage in der Röti zugesagt. Anmerkung der Redaktion: Die Bewegung gegen den Standort der Kläranlage 300 m ob dem Rheinfall, ausgehend von einer Handvoll sich für die einzigartige Landschaft einsetzender Schaffhauser und Neuhauser Bürger, ist in der Volksabstimmung ganz knapp unterlegen, in Neuhausen mit 1162 Nein gegen 1219 Ja. Anmerkung H. Bührer 2006:
|
||||||||||||||
| Fischer,H. | Bernhard Peyer (1885-1963). Paläonthologe | 108,467-469 | ||||||||||||
| Huber-Pestalozzi,G. | Fritz Nipkow (1886-1963) Apotheker, Planktologe | 108,470-473 | ||||||||||||
| Schleich,K. | Klaus Clusius (1903-1963). Experimentalphysiker | 108,473-475 | ||||||||||||
| Kern,H. | Ernst Gäumann (1893-1963) Botaniker | 108,475-476 | ||||||||||||
| Theiler,K. | .Die Steuerung der Skelettentwicklung. | 108,477AR | ||||||||||||
| Ausgehend vom trajektoriellen
Bau der Spongiosa wird zunächst die Beanspruchung des Knochens als
Steuerungsprinzip für seine Strukturentwicklung untersucht. Den ersten
statischen Berechnungen von Culmann und Meyer in Zürich folgten die
Arbeiten von W. Roux und in neuerer Zeit diejenigen von Pauwels, Kummer
und Knese. Pauwels fasste die Reaktionsweise des Knochens im «Umbaugesetz»
zusammen. Es gibt die Richtung des Knochenumbaues in Abhängigkeit
der Spannungsgrösse wieder. Dadurch wirken Spannung und Umbau als
eine Art Reglersystem für die Knochenmasse. Durch spannungsoptische
Modelle werden die Beanspruchungen überprüft. Der Bau der Spongiosa
kann nach Pauwels durch das Umbaugesetz erklärt werden. Die Compacta
besitzt nicht den funktionellen Bau der Spongiosa. Sie ist eine Wachstumsstruktur,
eventuell durch den Gefässverlauf geprägt. Bei Belastung gebogener
Röhrenknochen entsteht keine Achsenstreckung, sondern nur eine Verdickung
auf der konkaven Seite.
Neu angebaute Osteone besitzen noch nicht den vollen Kalkgehalt. Dieser kann neuerdings durch Mikroradiografie überprüft werden. Die Einlagerung von neuen Kalksalzen kann durch Autoradiografie mit Ca45 nachgewiesen werden. Das in die Blutbahn injizierte Ca45 schlägt sich in Anbauzonen nieder, in der Spongiosa wie in der Compacta. Die hormonale Regulierung des Knochenbaues wird am Beispiel des Parathormons erwähnt. Die Sekretion der Hormone wird wieder durch Rückkoppelung gesteuert. Neben der allgemeinen Wirkung auf Eiweiss- und Mineralstoffwechsel kann auch eine spezifisch lokale Wirkung festgestellt werden. Das Hormon Testosteron bewirkt zum Beispiel geschlechtsspezifische Umbau- und Anbauprozesse am Becken. Sie beruhen wahrscheinlich auf einer genetisch festgelegten Reaktionsweise bestimmter Skelettpartien, ähnlich wie die Ausbildung anderer sekundärer Geschlechtsmerkmale. Eine mehr direkte genetische Steuerung der Skelettentwicklung ist bei einigen Erbkrankheiten zu beobachten, wie der Chondrodystrophie des Menschen oder dem Syndrom grey-lethal der Hausmaus. Neben diesen allgemeinen Störungen werden immer mehr lokalisierte Störungen bekannt, die auf Erbfaktoren zurückgeführt werden können. Sie wirken meist in recht frühen Entwicklungsphasen, entweder direkt oder über die Störung von Induktionsprozessen. Als Beispiel für diese embryonale Phase der Skelettentwicklung wird der Faktor «truncate» der Hausmaus angeführt, der frühzeitig die Entwicklung der distalen Chorda stört und so eine Sacralagenesie erzeugt. (Autoreferat) |
||||||||||||||
| Hitzig,Walter | Beiträge der immunologischen Forschung zur Genetik | 108,477AR | ||||||||||||
| Aus dem im Titel umschriebenen
Gebiet werden zwei Teilprobleme herausgegriffen: 1. Einflüsse von
Erbfaktoren bei immunologischen Phänomenen im allgemeinen und 2. die
heutige Bedeutung immunochemischer Techniken bei der Abklärung vererbter
Serumeigenschaften.
1. Immunologische Massnahmen schützen den gesunden Körper gegen Einwirkungen aus der Aussenwelt. Das Versagen derselben wurde von Klinikern als «Antikörpermangel-Syndrom» beschrieben. Die zwei vererbten Formen des Antikörpermangelsyndroms, die plasmozytäre Dysgenesie (Agammaglobulinämie) und die lymphoplasmozytäre Dysgenesie (Agammaglobulinämie - Alymphozytose), unterscheiden sich in wesentlichen klinischen, hämatologischen, eiweisschemischen, pathologisch-anatomischen und genetischen Kriterien. Zusammen mit neueren Tierversuchen (Thymektomie kurz nach der Geburt) ergeben sich interessante Zusammenhänge: der kleine Lymphozyt scheint die Transportform der immunbiologisch aktiven Zelle darzustellen. In der perinatalen Periode wandert er aus dem Thymus aus und bevölkert das übrige lymphatische Gewebe. Analoge Vorgänge sind bei der Transplantation von lymphatischem Gewebe oder von Knochenmark im Tierversuch und beim Menschen bekannt. Ihr weiteres intensives Studium ist für die gefahrlose Durchführung von Organ-Transplantationen beim Menschen unbedingt notwendig. 2. Die Anwendung immunologischer Techniken hat sich vor allem bei der Differenzierung feiner vererbter Struktur-Unterschiede der Serumproteine hervorragend bewährt. Bei jedem Menschen kann schon heute ein ganzes Mosaik von Serumprotein-Eigenschaffen bestimmt werden. Man steht hier am Anfang einer Entwicklung, die zur Zeit vor allem Genetiker, Anthropologen und Gerichtsmediziner für die Klärung von Abstammungsfragen interessiert. Immunologische Techniken haben ferner bei der Untersuchung einer Gruppe seltener Erbkrankheiten, die als Defekt-Pathoproteinämien zusammengefasst werden, eine bedeutende Rolle gespielt. Darunter versteht man das ständige Fehlen einer grösseren Proteinfraktion des Serums. Die Analbuminämie, die A-Beta-Lipoproteinämie, die Atransferrinämie und die Afibrinogenämie werden besprochen, die Wilsonsche Krankheit (Fehlen des Coeruloplasmins) kurz erwähnt. Die Patienten werden als homozygot erkrankt angesehen. Teilweise gelingt auch der Nachweis der heterozygoten Genträger mit Hilfe besonders empfindlicher immunochemischer Untersuchungsmethoden. Auch exakte Messungen des Stoffwechsels spezifischer Proteinfraktionen, wie zum Beispiel des Fibrinogens, sind so möglich. Diese «Naturexperimente» tragen zum Verständnis von Protein-Stoffwechselstörungen wesentlich bei. Ihr intensives Studium ist auch für die praktische Medizin wichtig, weil auf Grund der gewonnenen Erkenntnisse unter Umständen die Behandlung erbbiologisch gesunder Menschen verbessert werden kann. (Autoreferat) |
||||||||||||||
| Kern,Heinz | Probleme der Pathogenese pflanzlicher Infektionskrankheiten. | 108,478AR | ||||||||||||
| Parasitische Pilze und
Bakterien schädigen ihre Wirtspflanzen in vielen Fällen durch
giftige Stoffwechselprodukte, die an der Infektionsstelle zur Wirkung gelangen
oder im Transpirationsstrom der Pflanzen über weite Strecken transportiert
werden. Parasitogene Enzyme zerstören das Zellgefüge (zum Beispiel
durch Auflösung der Mittellamellen) und können andern Wirkstoffen
die Ausbreitung und den Eintritt ins Plasma erleichtern. Schleimige Polysaccharide
blockieren die Leitungsbahnen und bringen die Pflanzen zum Welken. Niedermolekulare
Toxine verschiedener Typen (peptidartige Verbindungen, Pyridinderivate,
aromatische Ringverbindungen u. a.) wurden bei zahlreichen Parasiten in
vitro und zum Teil in vivo nachgewiesen; sie greifen entsprechend ihrer
chemischen Struktur in den Wirtsstoffwechsel ein (kompetitive Hemmung von
Enzymreaktionen, Komplexbildung mit Schwermetallen u. a.) und können
selbst chemisch umgewandelt und dabei zum Teil entgiftet werden.
Die Lebensäusserungen der Parasiten und die toxischen Stoffwechselprodukte im besonderen lösen in der Wirtspflanze mannigfaltige Störungen aus, die zunächst verschiedene Zellfunktionen erfassen und schliesslich zu sichtbaren Schädigungen führen. Zu Beginn der Inkubationsperiode ist die physiologische Aktivität der infizierten Gewebe häufig erhöht; an der Infektionsstelle und zum Teil auch an entfernten Stellen der Pflanze steigt die Atmungsintensität vorübergehend an und sinkt mit fortschreitender Erkrankung langsamer oder rascher wieder ab. Gleichzeitig können qualitative Veränderungen in den Atmungsmechanismen eintreten. Der Wasserhaushalt der Pflanzen wird vor allem bei Welkekrankheiten in auffälliger Weise beeinflusst. Permeabilitätsstörungen in der Zelle führen auf verschiedenen Wegen schliesslich zum Austritt von Wasser und gelösten Stoffen aus dem Plasma, zur Koagulation und zum Zelltod. Der Wasserumsatz infizierter Pflanzen kann am Anfang der Erkrankung ansteigen; mit zunehmender Schädigung geht er mehr und mehr zurück. Parasitogene Toxine verursachen an abgeschnittenen Sprossen charakteristische Störungen der Wasserbilanz. Eine andere Gruppe von Parasiten reizt die Wirtsgewebe zu übermässigem, weitgehend ungeregeltem Wachstum. Einzelne dieser Erreger scheiden Wuchsstoffe in die Wirtsgewebe aus; andere bringen den Wuchsstoffhaushalt der Wirtspflanzen durch eine Hemmung der Auxinoxydasen aus dem Gleichgewicht. (Autoreferat) |
||||||||||||||
| Günthard,Heinz | Schnelle chemische Reaktionen. | 108,479 | ||||||||||||
| Chemische Reaktionen zwischen
Teilchen mit einer mittleren Lebensdauer von weniger als 1 ms erfordern
eine spezielle Untersuchungsmethodik. Die heutigen Methoden lassen sich
in drei Hauptgruppen einteilen:
1. Schnelle Änderungen eines Parameters von Gleichgewichtssystemen. 2. Herstellung des Ausgangszustandes durch physikalische Operationen, welche kurzlebige Teilchen erzeugen. 3. Herstellung von chemisch-stationären Zuständen mittels schneller Strömungen. Zunächst werden einige Ergebnisse diskutiert, die mittels der Verfahren 1 über schnelle Reaktionen zwischen Ionen in Lösungen gewonnen worden sind. Zahlreiche Reaktionen zwischen Ionen galten lange Zeit als unmessbar schnell. Wird ein äusserer Parameter (elektrische Feldstärke, Druck, Temperatur) eines Ionengleichgewichts in Zeiträumen von ~ 5 geändert und lassen sich die momentanen Konzentrationen einer lonensorte messen, so lässt sich die Herstellung des Gleichgewichtszustandes verfolgen und lassen sich die Geschwindigkeitskonstanten des Systems bestimmen. In einigen dieser Fälle verläuft die Rekombinationsreaktion der Ionen zu neutralen Molekeln mit der maximal möglichen Geschwindigkeit, indem jede Begegnung auf gewisse Distanz zur Reaktion führt. Speziell bei der Neutralisationsreaktion zwischen Proton und Hydroxylion brauchen sich die Teilchen nur auf einen Durchmesser von ca. 3 Wassermolekeln zu nähern, worauf dann durch Benützung der Wasserstoffbrücke die Bildung der Wassermolekel erfolgt. Die Geschwindigkeit dieser Reaktion ist sonst im wesentlichen durch die Brownsche Bewegung bestimmt. Mittels der Methode 2 (Pulsmethoden) wurden hauptsächlich Erkenntnisse über die Eigenschaften und Reaktionen (zufolge Lichtabsorption oder Elektronenstoss) energiereicher Molekeln gewonnen. Mit der Photoflash-Anregung wurde festgestellt, dass die Lebensdauer photochemisch angeregter Singletzustände drastisch durch gewisse (Quencher-) Molekeln beeinflusst werden kann, obwohl sie meist <1 µs beträgt. Einige Mechanismen dieser schnellen Prozesse werden diskutiert. Angeregte Triplet- und Singlet-Zustände können ihre Energie unter gewissen Bedingungen auf andere Molekeln übertragen, meist durch schnelle chemische Reaktion. Dieser Energie-Transfer scheint eine ganz allgemeine Erscheinung zu sein und dürfte eine Rolle bei der Signalfortpflanzung in Organismen spielen, da er auch in Festkörpern oft eintritt. Am Beispiel der Radiolyse von Benzol werden schnelle Reaktionen von kurzlebigen Teilchen diskutiert, welche durch einen Puls schneller Elektronen gebildet werden. Viele dieser Reaktionen sind diffusionskontrolliert und ihre Geschwindigkeit hängt u. a. ab von der Viskosität des Lösungsmittels, insbesonders aber auch von den Kraftfeldern zwischen den Teilchen. (Autoreferat) |
||||||||||||||
| Fierz,M. | Quantentheorie und Relativitätstheorie. | 108,479AR | ||||||||||||
| Die Quantentheorie und die Relativitätstheorie
sind fast gleichzeitig entstanden; und beide wurden entdeckt beim Studium
elektromagnetischer Erscheinungen: Planck studierte die Gesetze der Wärmestrahlung,
also das Glühlicht, das heisse Körper aussenden. Einstein studierte
die Elektrodynamik bewegter Körper, die eben weil sie sich bewegen,
auch Licht ausstrahlen. Die Lichtquanten hat Einstein als «heuzistischen
Gesichtspunkt» eingeführt, um den photoelektrischen Effekt zu
erklären, und die Formel, welche die Energie des Lichtquants mit seiner
Frequenz verknüpft:
E = h nue, ist eine relativistisch-invariante Formel. Später hat sich jedoch die Quantentheorie unabhängig von der Relativitätstheorie entwickelt, und führte zu einer mathematisch vollständigen Beschreibung der Eigenschaften der Atome und Moleküle - so weit war man um 1930. Nun stellte sich die Aufgabe, auch die Elektrodynamik quantentheoretisch zu formulieren, und dies ist nur in relativistischem Rahmen möglich. Dirac, Pauli, Jordan und Heisenberg haben als erste eine Quantenelektrodynamik entwickelt, die jedoch sogleich zu ernsten mathematischen Schwierigkeiten führte. Heute wissen wir, wie diese umgangen, nicht aber, wie sie gelöst werden können: wir haben Regeln, mit deren Hilfe elektromagnetische Erscheinungen mit grosser Genauigkeit und in bester Übereinstimmung mit der Erfahrung berechnet werden können. Der mathematische Sinn dieser Regeln ist aber immer noch recht unklar. Darum hat man sich in neuester Zeit darum bemüht, eine allgemeine mathematische Quanten-Feldtheorie zu entwicklen, die sich auf möglichst wenig, dafür aber möglichst zwingende, physikalische Annahmen stützt. Diese Theorie soll schliesslich zu einem wohldefinierten Rahmen führen, in welchem auch die Quantenelektrodynamik ihren Platz findet. Es scheint heute nicht allzu kühn, wenn wir hoffen, dass dieses Ziel erreicht werden kann. Schon heute liegen wichtige Ergebnisse vor: man versteht, dass die Elektronen dem Pauli-Prinzip genügen, weil ihr Spin den Wert besitzt - dasselbe gilt für Nukleonen. Man weiss, dass zu jedem geladenen Teilchen ein spiegelbildlich gleiches, mit entgegengesetzter Ladung gehört. Es war möglich, sog. Dispersionsrelationen streng zu beweisen. Schliesslich begreifen wir auch viel besser, warum eine Theorie der Kernkräfte notwendig ungeheuer kompliziert und unübersichtlich sein muss. Ganz unverstanden sind dagegen die sog. schwachen Wechselwirkungen, die die Umwandlung der Elementarteilchen ineinander regeln - z. B. die b-Zerfalls-Wechselwirkung. (Autoreferat) |
||||||||||||||
| Boesch,H. | Neuere morphologische Untersuchungen im schweizerischen Mittelland. | 108,480AR | ||||||||||||
| Form, Verbandsverhältnisse
und Material sind die wichtigsten Kriterien beim morphologischen Arbeiten.
In den letzten Jahren wurde vor allem einer verbesserten Untersuchung des
Materiales vermehrte Beachtung geschenkt, was unter anderem in ausgedehntem
Masse die Anwendung von Laboratoriumsarbeiten notwendig machte. Es handelt
sich dabei nicht um eine Art «Modeströmung»in der Morphologie;
vielmehr zeigte es sich immer deutlicher, dass gewisse Fragen mit den traditionellen
Untersuchungsmethoden nicht überzeugend gelöst werden konnten.
Diese Entwicklung und eine Auswahl von Resultaten wurden im Referat behandelt,
soweit sie die am Geographischen Institut der Universität Zürich
ausgeführten Arbeiten betreffen.
Mit der Bedeutung der sedimentologischen Methoden für die Morphologie setzte sich H. Zimmermann kritisch auseinander (Dipl.-Arbeit, 1959); später wandte er sie mit Erfolg bei der Analyse der eiszeitlichen Ablagerungen im westlichen zentralen Mittelland an (Diss., 1962). Im Greifenseegebiet vermochte G. Jung (Dipl.-Arbeit, 1961) durch Miteinbeziehen der Pollenanalyse die spät-und postglaziale Absenkung des Seespiegels zu rekonstruieren, im toten Tal von Littenheid bei Wil SG kombinierte H. Andresen (Dipl.-Arbeit, 1957) die verschiedenen Methoden zu einer Analyse der morphologischen Entwicklung und zu einer schärferen Fassung der sog. morphologischen Aktivität. E. Bugmann (Diss., 1956) und A. Leemann (Diss., 1958) untersuchten die würmglazialen Schotterkomplexe im Aaretal und Rheintal oberhalb Koblenz. Während sie auf Grund der Schotteruntersuchungen keine weitere Gliederung der Würmeiszeit vornehmen konnten (im Gegensatz zu Alb. Heim und J. Hug), gelang es dann G. H. Gouda (Diss., 1962) durch eine sorgfältige Untersuchung nordschweizerischer Lössvorkommen eine Gliederung aufzustellen, welche vorzüglich mit den neueren Resultaten in Österreich usw. übereinstimmt. Schliesslich hat im Rahmen einer regionalmorphologischen Arbeit H. Andresen (Diss., 1962) durch einen Vergleich von Töss- und Thurgebiet wertvolle Belege zur glazialerosiven Entstehung von Gehängeterrassen beigebracht, die geeignet erscheinen, auch das Problem der Zürichseeterrassen neu in Angriff zu nehmen. Vor allem die früheren Untersuchungen, wie jene von E. Bugmann und A. Leemann zeigten, wie notwendig in vielen Fällen eine feinere Materialuntersuchung ist. Aus diesem Grunde wurde seit etwa 1955 systematisch der Ausbau eines morphologischen Laboratoriums am Geographischen Institut an die Hand genommen, damit alle Studierenden in der Anwendung der Methoden geschult werden können und um für die Doktoranden bessere Untersuchungsbedingungen zu schaffen. Es handelte sich darum, eine zweckmässige Kombination von Untersuchungseinrichtungen zu erreichen, welche für sich und als Ganzes den besonderen Bedürfnissen der Morphologie entsprechen. Besonderes Augenmerk ist dabei zu schenken: der Trennung von Lockermaterialien nach ihrer Grösse, der Bestimmung des Gehaltes an Kalk und Dolomit sowie an organischem Material, der morphometrischen Untersuchung von Geröllen, Pollen- und Schweremineralanalysen. Im weiteren müssen die notwendigen Instrumente zur Verfügung stehen zur optischen Untersuchung von Gesteinen und für die wichtigsten chemischen Analysen. Besonders wertvoll erscheint auch, dass im Zuge dieser Entwicklung eine engere Zusammenarbeit mit benachbarten Instituten (Geologie, Geobotanik usw.) gefunden wurde. (Autoreferat) |
||||||||||||||
| Eckardt,T | Mannigfaltigkeit und Einheit bei den Blütenpflanzen. | 108,481AR | ||||||||||||
| Die Blütenpflanzen
im eigentlichen, engeren Sinne, die Angiospermen, zeichnen sich durch eine
schier unerschöpfliche Mannigfaltigkeit der Gestaltung in fast allen
Merkmalsbereichen aus. Trotz dieser Formenfülle galten sie den Taxonomen
und Morphologen bisher als eine Einheit, als eine so geschlossen einheitliche
Gruppe, dass man sich auch ihre Herkunft, ihren Ursprung nur monogen oder,
wie meist gesagt wird, nur monophyletisch vorstellen konnte. In jüngster
Zeit wird aber immer wieder versucht, an der inneren Einheitlichkeit der
Angiospermen zu rütteln und aus ihren Merkmalen auf eine Pleiophylie,
mindestens auf eine Biphyhe, zu schliessen. Bei diesen Versuchen spielt
der Blütenbau eine entscheidende Rolle, insbesondere die Morphologie
der Karpelle und die Placentation, aber auch das Androeceum. Vorangestellt
wird eine Betrachtung jener Merkmale, die die Angiospermen besonders auszeichnen
und als Einheit prägen, weil sie ausnahmslos gelten: ihre Angiospermie,
die Narbenbildung, die Fruchtbildung, der stete Besitz von Karpellen, der
Bau ihres Embryosacks, die doppelte Befruchtung, der Bau ihrer Stamina
und die Eigenart ihrer Blüten. Auf der Grundlage der klassischen Blütenauffassung,
der Euanthien- oder Strobilartheorie der Blüte, wird gezeigt, dass
das Studium des Gestaltwandels in bestimmten Verwandtschaftskreisen eine
Spannweite der Abwandlungen umfasst, die von grosser Primitivität
bis zu äusserster Reduktion reicht, ja bis hin zur Pseudanthienbildung.
Dies wird dargelegt an den Beispielen Drimys-Liriodendron-Calycanthus-Euptelea-Cercidiphyllum.
Dass schon bei relativ ursprünglichen Familien das Gynoeceum auf höchst
komplexe Weise reduziert sein kann, wird am Beispiel der Berberidaceen
dargetan, die sich doch als pseudomonomer erwiesen haben. Es ist von den
Prinzipien die Rede, die der Merkmalsanalyse zugrunde liegen, wobei die
zentrale Bedeutung des Homologiebegriffes hervorgehoben wird. Das Bekenntnis
zur Typologie bedeutet, dass die Homologien nach klaren Kriterien festgestellt
werden müssen, dass die Merkmalsanalyse soweit ausgreifen muss wie
möglich, und dass sie zunächst rein empirisch von dem vorliegenden
Material ausgeht, ohne es mit phyletischen Vorstellungen von vorneherein
zu belasten. Es wird auf das Verhältnis der Typologie zu der sogenannten
«numerischen Taxonomie» (Sokal u. a.) eingegangen und auf gewisse
Gemeinsamkeiten des Vorgehens bei der Ähnlichkeitsbewertung und Abgrenzung
natürlicher Taxa hingewiesen. Am Beispiel des erst vor kurzem entdeckten
Mooses Takakia lepidozioldes wird die Frage erörtert, ob alle Merkmale
grundsätzlich gleich bewertet werden können, wie es in der numerischen
Taxonomie, allerdings nur unter Verwendung einer möglichst grossen
Zahl von Merkmalen, geschieht, oder ob die Merkmale verschiedenes Gewicht
haben. Im Falle der Takakia hat der Nachweis eines Archegons - die Pflanze
war in der Originaldiagnose zunächst nur in sterilem Zustand beschrieben
worden - mit einem Schlag die nähere Verwandtschaft gesichert. Die
noch unbekannten Kapseln würden ohne Zweifel weiter führen als
alles, was man bisher über die systematische Stellung weiss.
Bei der Erörterung der Einheitlichkeit der Angiospermenblüte spielen die Samenanlagen insofern eine besondere Rolle, als ihnen in neueren Hypothesen ein teils blattbürtiger, teils achsenbürtiger Ursprung zugeschrieben wird (L am u. a. schon früher). Dies sollen auch die histogenetischen Studien von Pankow bestätigen, zu denen auf Grund eigener Untersuchungen an Boussingaultia und gewissen Helobiae kritisch Stellung genommen wird, mit dem Ergebnis, dass die Beteiligung bestimmter Lagen des Vegetationspunktes am Aufbau von Organen kein absoluter Massstab für ihren morphologischen Wert sein kann. Die neue Blütentheone von Melville, die vom Leitbündelverlauf der Karpelle rezenter Typen ausgeht, und Metatopien von Blütenständen auf die Blätter, wie bei den Dichapetalaceae (Chailletiaceae), in Verbindung mit telomatischen Gedankengängen und Verwertung von Glossopteris-Fruktifikationen zu einer Gonophyll-Hypothese gestaltet, wird im Lichte der klassischen Karpellmorphologie gewürdigt, nach der den Leitbündeln durchaus kein Achsencharakter zugeschrieben werden muss. Das Fossilmaterial reicht unseres Erachtens ebenfalls nicht zur Aufstellung so kühner Hypothesen über die Herleitung der Angiospermen aus. (Autoreferat) |
||||||||||||||
| Wyss,O.A.M. | Ueber Nutzen und Schaden in der Wirkung elektrischer Ströme am Menschen. | 108,482AR | ||||||||||||
| Die todbringende Wirkung elektrischer
Ströme beruht, sofern sie nicht massiver Wärmeentwicklung zuzuschreiben
ist, auf deren Reizwirkung. Elektrotonisch bedingte Lähmungseffekte
sind nicht in Abrede zu stellen, aber schwer nachzuweisen. Als eigentliche
Todesursache kommen nur Herzstillstand und eventuell Atmungsstillstand
in Frage; ein primärer Kreislaufkollaps infolge zentraler Vasomotorenlähmung
wäre ebenfalls denkbar, ist aber noch schwieriger nachzuweisen. Die
Herzwirkung steht zweifellos im Vordergrund. Sie kann als reflektorischer
Herzstillstand in Diastole (Erschlaffung) oder als direkte Herzlähmung
erfolgen, meist aber als systolischer Stillstand in Form des Kammerflimmerns.
Die elektrotonischen Effekte und die eigentlichen Reizwirkungen kommen
dem Gleichstrom und dem niederfrequenten Wechselstrom zu. Dabei ist der
technische Wechselstrom (50 Hz) insofern besonders «gefährlich»,
als einerseits die Reizwirkung der Strom- beziehungsweise Spannungs-Schwankung
zuzuschreiben ist, die dem 2 Sqrt(2)-fachen Wert der effektiven Stromstärke
beziehungsweise Spannung entspricht, und andererseits die Frequenz von
50 Hz sowohl für die Erregung vegetativer Nerven als auch für
die Reizung des Herzmuskels die Optimalfrequenz darstellt. Nur schon aus
Sicherheitsgründen muss daher dem Wechselstrom gemessen in Effektivwert
etwa die dreifache Reizwirkung des unterbrochenen Gleichstroms zuerkannt
werden. Die Nichtbeachtung dieser reizphysiologisch grundsätzlichen
Fragen hat noch zur Zeit des Ersten Weltkrieges zu zahlreichen elektrotherapeutisch
bedingten Todesfällen geführt und dem sinusförmigen Wechselstrom
den Stempel der besonderen Gefährlichkeit, der im Grunde genommen
der ungenügenden Sachkenntnis hätte gelten sollen, aufgedrückt.
Die Verwendung des elektrischen Stromes zur absichtlichen Tötung («Elektrokution») ist abzulehnen; denn bei Einwirkung auf das Herz ist die unmittelbare Wirksamkeit nicht vorauszusehen, während bei Einwirkung auf das Gehirn wohl Bewusstseinsverlust eintritt, die lebenswichtigen Zentren im verlängerten Mark aber mit noch geringerer Wahrscheinlichkeit sofort und wirksam betroffen werden. Die nutzbringende Wirkung elektrischer Ströme ist in Elektrodiagnostik und Elektrotherapie unbestritten, obschon alte sowohl wie neue Erkenntnisse noch bei weitem nicht ausgewertet sind. Von besonderer Aktualität ist die Verwendung elektrischer Impulse als Schrittmacher für die Herzaktion (sog. «Pace-maker»), was nicht nur während Herzoperationen in Frage kommt, sondern was auch in Form von chronisch «implantierten» transistorisierten Reizgeräten Verwendung findet, und zwar speziell dort, wo die spontane Impulsgebung des Herzens zu langsam erfolgt oder überhaupt in Frage gestellt ist. Der nächste Schritt wird sein, bei der meistens noch vorhandenen Vorhofaktion (Sinusrhythmus) den die Kammern treibenden künstlichen Schrittmacher vom Vorhofaktionsstrom aus zu steuern. Starke elektrische Stromstösse kurzer Dauer können am kammerflimmernden Herzen zur «Defibrillierung», das heisst zum plötzlichen schockartigen Aufhören des Flimmerns und Einsetzen geregelter Herztätigkeit verwendet werden. Diese Technik des «Elektroschocks am Herzen» ist heute bei Herzoperationen ein unentbehrliches Hilfsmittel für die Erhaltung beziehungsweise Wiederherstellung der Herzaktion. Die elektrische Reizung des Gehirns wird in einem ganz anderen Sinne als «Schocktherapie» verwendet, sei es in Form des Elektroschocks oder der länger dauernden Elektronarkose. Dabei handelt es sich um brutale Massnahmen undifferenzierter elektrischer Reizung und elektrotonischer Beeinflussung höherer Zentren mit dem Erfolg einer unmittelbaren elektrischen Betäubung, welche aber bei richtiger Indikation und sachkundiger Durchführung dem Psychiater in gewissen Fällen ein wertvolles und wirksames therapeutisches Hilfsmittel sein können. Unvergleichlich viel feiner und differenzierter ist die aus den Hirnreizversuchen von W. R. Hess hervorgegangene lokalisierte Reizung tiefliegender Hirnabschnitte, wie sie heute als Testmethode bei den sogenannten stereotaktischen Eingriffen vorgängig der lokalisierten Ausschaltung mittels Hochfrequenzstrom (siehe unten) verwendet wird. Noch neueren Datums sind Beobachtungen, die darauf hinweisen, dass eine länger dauernde Beeinflussung höherer Zentren durch äusserst schwache, dem Gehirn in bestimmter Richtung diffus zugeleitete Gleichströme Effekte zur Folge haben, welche in der psychiatrischen Therapie von Bedeutung sein und später vielleicht sogar mit den psychopharmakologischen Behandlungsmethoden in Konkurrenz treten können. Die neurophysiologische Grundlagenforschung wird hier aber zunächst noch die nötige Vorarbeit leisten müssen. Besonders aktuell ist seit einiger Zeit auch die Verwendung von Hochfrequenzstrom zur lokalisierten, reizlosen Ausschaltung bestimmter Stellen im Gehirn zwecks Behebung des Schütteltremors bei Parkinson-Kranken. Auch hier hat die experimentelle Neurophysiologie die nötigen Grundlagen geschaffen und eine quantitative Methode der Hochfrequenz-Koagulation von Arealen bestimmter im voraus zu bestimmender Grösse geschaffen. Sinusreiner Hochfrequenzstrom von etwa 500000 Hz garantiert hierbei absolute Reizlosigkeit einerseits, genügend genaue Messung der wärmeerzeugenden Stromstärke andererseits. An zunehmender praktischer Bedeutung gewinnt nach und nach auch die sogenannte «Mittelfrequenzreizung», das heisst die Reizung mit Wechselströmen so hoher Frequenzen (1000 bis 100 000 Hz), dass im Gefolge der raschen Wechsel die einzelne Stromschwankung nicht mehr als Reiz wirken kann. Diese Art der Reizung beruht nicht mehr auf dem für Gleichstrom und niederfrequente Wechselströme (bis zu etwa 1000 Hz) geltenden Polaritätsprinzip, sondern vermutlich auf einer direkten Membranwirkung. Sie führt bei der Muskelreizung am Menschen zur sogenannten «Depolarisationskontraktur», welche kombiniert mit einer desensibilisierenden Wirkung solcher Ströme auf Nerven und Nervenendigungen, speziell in der Haut, diese Applikationsart in der Elektrotherapie zu einer subjektiv angenehm, das heisst nicht empfundenen «Elektrisierung» macht. Es handelt sich hier um ein fundamental neues Prinzip der elektrischen Reizung, dessen intimer Mechanismus aber erst noch experimentell abgeklärt und in unvoreingenommener Weise den allzu geläufigen Vorstellungen von der Reizwirkung elektrischer Ströme gegenüber verfochten werden muss. (Autoreferat) |
||||||||||||||
| Autrum,H. | Die sinnesphysiologischen Grundlagen des Farbsehens. | 108,483-484AR | ||||||||||||
| Die Gesetzmässigkeiten
des Farbensehens des Menschen haben zu zahlreichen Annahmen über die
physiologischen Mechanismen geführt, die dem Farbensehen zugrunde
liegen könnten. Unter den Theorien des Farbensehens haben vor allem
zwei eine weite Anerkennung gefunden, weil sie - jede für sich - eine
grosse Zahl von Gesetzmässigkeiten des Farbensehens erklären
können: die von Young, Helmholtz und anderen begründete Dreikomponententheone
und die Gegenfarbentheone von Ewald Hering.
Die Dreikomponententheone fordert drei Sorten von Sehzellen mit verschiedener spektraler Empfindlichkeit; sie geht vor allem von den Phänomenen der Mischung spektraler Lichter, insbesondere von der Tatsache aus, dass sich alle Farben durch Mischung dreier, geeignet gewählter Grund-farben herstellen lassen. Sie kann die beim Menschen beobachteten Farbfehlsichtigkeiten zwanglos durch Ausfall einer der drei Komponenten erklären. Im Gegensatz dazu geht die Gegenfarbentheone von der psychophysischen Tatsache aus, dass sich nicht drei, sondern vier reine Hauptfarben in der Empfindung unterscheiden lassen: Rot, Gelb, Grün und Blau; und dass ausserdem Weiss und Schwarz eigene Qualitäten sind; dass sich ferner Rot und Grün einerseits, Gelb und Blau andererseits in der Empfindung gegenseitig ausschliessen. Die physiologischen Elementarvorgänge beim Farbensehen können nur durch Untersuchung der einzelnen Stationen des Sehprozesses von den Sehzellen bis zu den höchsten zentralnervösen Gebieten geklärt werden. Voraussetzung für derartige Untersuchungen ist eine möglichst genaue Kenntnis des Farbensinnes derjenigen Tiere, bei denen solche Analysen der Einzelelemente und ihres Zusammenwirkens gemacht werden; das ist der Fall bei Bienen, Fischen und höheren Affen. Messungen der spektralen Empfindlichkeit einzelner Sehzellen selbst sind bislang nur bei Insekten, insbesondere Bienen, gelungen. Bei Bienen, deren Farbtüchtigkeit bekannt und in den Grundzügen mit der des Menschen vergleichbar ist, sind drei verschiedene Sorten von Sehzellen mit unterschiedlicher spektraler Empfindlichkeit vorhanden; die Maxima liegen bei 340, 440 und 530 nm. Drohnen haben nur zwei Sorten von Sehzellen mit den Maxima bei 340 und 440 nm. Der Verlauf der Empfindlichkeitskurven der einzelnen Sehzellen bei den Bienenarbeiterinnen stimmt aufs beste zu den Leistungen des Farbensinnes bei den Bienen. Damit ist für das Eingangselement des visuellen Apparates der Biene die Richtigkeit der Dreikomponententheone unmittelbar bewiesen. Bei Wirbeltieren sind entsprechende Messungen bislang nicht geglückt. Die an die Sehzellen anschliessenden Ganglienzellen der Retina - diese Versuche sind an Fischen und Affen gemacht, die nachweislich farbentüchtig sind - verarbeiten jedoch die von den Sehzellen kommenden Informationen zumindest teilweise nach einem Schlüssel, der dem Schema entspricht, das die Gegenfarbentheone fordert: In höheren, zentralnervösen Stationen (zu denen bereits die retinalen Ganglienzellen gehören) spielen sich 1. Vorgänge ab, die reine Helligkeitsempfindungen vermitteln; 2. Vorgänge, die für Rot und Grün (bzw. Gelb und Blau) entgegengesetzten Sinn haben (Rot wirkt erregend, Grün hemmend; analoges gilt für Gelb und Blau); diese Vorgänge spiegeln die Gegensätzlichkeit bestimmter Farben (Rot-Grün, Gelb-Blau) sowie die Erscheinungen des simultanen und sukzessiven Farbkontrastes in physiologischen Prozessen wider. 3. Daneben gibt es bei Affen auch im Zentralnervensystem (im Zwischenhirn) Vorgänge, die auf enge spektrale Bereiche beschränkt sind und dem Helmholtzschen Schema folgen, allerdings hier mit einer grösseren Zahl (zum Beispiel fünf) spektraler Empfindlichkeitskurven. Demnach gilt - durch Experimente nunmehr beweisbar - für die primäre Station der Sehzellen die Dreikomponententheone; die primären Vorgänge in den Sehzellen werden jedoch alsbald von den anschliessenden Ganglienzellen transformiert. Dabei entstehen Informationen, die dem Schema der Gegenfarbentheone entsprechen, und (zumindest bei Affen) ausserdem Informationen, die einer Komponententheone folgen. (Autoreferat) |
||||||||||||||
| Verschiedene | Buchbesprechungen | 108,485 | ||||||||||||
| E. Kuhn-Schnyder
René Hantke H. Fischer R. Cramer André de Haller H.J. Hediger M. Rueff J.J. Burckhardt B. Stüssi R. Cramer Ernst Inhelder H. Baumberger R. Cramer Pierre Tardent W. Saxer Eugen A. Thomas
|
Boessneck, J., Jéquier,
J.-P. u. Stampfli, H. R.: Seeberg, Burgäschisee-Süd; Die Tierreste
485
Bourdier, F.: Le Bassin du Rhône au Quaternaire 486 Von Brunn, W. A. L.: Medizinische Zeitschriften im 19. Jahrhundert 487 Bünning, E.: Die physiologische Uhr 488 Cagnet, M., Françon, M. U. Thrierr, J. C.: Atlas optischer Erscheinungen 489 Christen, H. R.: Allgemeine Chemie 489 Coxeter, H. S. M.: Unvergängliche Geometrie 490 Hofmann, J. E.: Geschichte der Mathematik, 1. Teil 491 Hegi, G.: Illustrierte Flora von Mittel-Europa, Bd. IVIl 492 Hegi, G. u. Merxmüller, H.: Alpenflora 492 Koehler, W.: Intelligenzprüfungen an Menschenaffen 493 Miehe, H.: Taschenbuch der Botanik. Teil II: Systematik 494 Niehans, P.: Von der Zelle zur Zellulartherapie 495 Peyer, B.: Die Zähne, ihr Ursprung, ihre Geschichte und ihre Aufgabe 495 Polya, G.: Mathematik und plausibles Schliessen, Bd. 2: Typen und Strukturen plausibler Folgerung 495 Pringsheim, E. G.: Farblose Algen; ein Beitrag zur Evolutionsforschung 496 Schaller, F.: Die Unterwelt des Tierreiches 497 Scheidegger, A. E.: Principles of Geodynamics 498 Schmeiser, K.: Radionuclide 499 Schmid, F., Stein, J.: Zellforschung und Zellulartherapie 500 Thenius, E.: Versteinerte Urkunden 501 Ergebnisse der Biologie: Bd. 26. Die Orientierung der Tiere 501 Geotechnische Karte der Schweiz 1: 200 000 503 |
|||||||||||||
| de Quervain,F. | Der Stein in der Baugeschichte Zürichs. | 107,1-16 |
| Die nicht sehr zahlreichen alten
Bauten und Bildwerke von Zürich sind eingehend von historischer und
kunsthistorischer Seite bearbeitet worden. In zwei Bänden des grossen
Werkes «Die Kunstdenkmäler des Kantons Zürich» sind
die Ergebnisse der vielen Studien für die Stadt zusammengefasst. Es
ist leicht zu verstehen, dass in diesen Veröffentlichungen das Materialmässige
des Bau- und Werkstoffes, in unserem Falle des Steines, nicht oder mehr
beiläufig behandelt und auch selten in einen grösseren Zusammenhang
gestellt werden konnte.
Es erscheint aber doch von allgemeinerem Interesse, einmal den Stein in den Mittelpunkt einer Betrachtung zu stellen. Der Stein trägt sehr wesentliches zum Charakter eines Bau- oder Bildwerkes bei, auch wenn man dies meistens mehr unbewusst wahrnimmt. Beim Studium der Bausteine erfährt man manches Bemerkenswerte über frühere Zeiten: die Steingewinnung und Verarbeitung, Wege und Arten der Beförderung schwerer Objekte, Handelsbeziehungen usw. Man wird auf die Kenntnisse der Baumeister, Steinmetze und Bildhauer über die Vorkommen der Steinarten aufmerksam und ist oft erstaunt über ihre treffende Beurteilung des Verhaltens am Bauwerk. In zahlreichen Fällen gibt ein Studium des Steines auch Aufschlüsse über die Geschichte eines Bauwerkes, besonders vermag es oft Unsicherheiten der Datierung zu beseitigen. Auch dem Geologen kann es nicht schaden, wenn er den Stein eines alten Bauwerkes genauer ansieht. Sogar der Kenner der lokalen Verhältnisse wird dann und wann eine Steinart oder Varietät entdecken, deren Herkunftszuweisung oder deren Verhalten am Bauwerk ihm Kopfzerbrechen bereitet. Eine Restauration wird nur dann optimal gelingen, wenn man über die Steine des Bauwerkes Bescheid weiss. Im folgenden werden in erster Linie die Steine der Stadt Zürich bis gegen das Ende des 18. Jahrhunderts behandelt. Mehr zusätzlich sind auch einige Beispiele aus dem weiteren Kantonsgebiet angeführt. Gewiss gibt es Gegenden in der Schweiz mit mannigfaltigeren und in gewissem Sinne auch schöneren Steinanwendungen als gerade Zürich und seine Umgebung. Dies ist natürlich in erster Linie durch die geologischen Gegebenheiten der Region bedingt. Daneben war auch die Art der Zürcher prunkvollen Anwendungen teurer (von weither zu beziehender) Steinmaterialien abhold. Einzelne Gesteinsarten mögen beim Bildersturm, durch die laufende Stadtumgestaltung und die Verwitterung vollständig verschwunden sein. Dass dadurch ein falsches Bild über das Wesentliche entsteht ist aber kaum anzunehmen. Die kunsthistorischen Angaben stützen sich zur Hauptsache auf die Kunstdenkmälerbände, in einzelnen Fällen auf jeweils zitierte Detailpublikationen. Ein systematisches Durchgehen der ältern Veröffentlichungen über die Bau- und Bildwerke Zürichs und über seine Wirtschaftsgeschichte war nicht möglich, ebensowenig Nachforschungen in Archiven. Sicher hätte sich daraus noch das eine oder andere Bemerkenswerte ergeben. Soweit noch durchführbar, sind alle Angaben aus der Literatur über Steinanwendungen überprüft worden. A. Übersicht der Gesteinsvorkommen der Umgebung
1. Gestein aus lockeren Ablagerungen
2. Die Steinarten des Untergrundes
Abb. 15. Portal an der Peterskirche in Plattensandstein,
mit Kunststein (untere Teile) unschön geflickt.
Im nördlichen Kantonsteil wurde der Plattensandstein
im 17./18. Jahrhundert ebenfalls viel verwendet, hier aber wiederum von
Rorschach stammend. Beispiele bieten die Portale, Wappen und andere Zierobjekte
an der Klosterkirche Rheinau und die Epitaphien in der Kirche Eglisau.
Die Originalsteine dieser Objekte wurden allerdings bei den kürzlichen
Restaurationen durch Kopien ersetzt, zum Teil in hier sonst ganz fremdem
granitischem Sandstein.
Mit dem Ende des 18. Jahrhunderts sei diese Übersicht
abgeschlossen. Die Hauptverwendung von sichtbarem Stein an heute noch bestehenden
Bauten setzt zwar erst in den folgenden Jahrzehnten ein. Die «Steingeschichte»
der neuem Zeit verliert aber durch die technisch-wirtschaftlichen und geistigen
Umstellungen des 19. Jahrhunderts viel von der relativen Geschlossenheit
früherer Zeiten, und damit wird auch ihre Darstellung weniger anziehend
und dankbar.
|
||
| Hotz,R. | Aus dem Arbeitsgebiet des Kieferorthopäden. | 107,17-30 |
| ... rasch, d.h. l-2 Stunden nach
dem Unfall durch den Fachmann eingegriffen wird, was leider noch viel zu
wenig bekannt ist.
Neben den Unfällen bilden vor allem die Lippen-Kiefer-Gaumenspalten eine schwere Belastung für jede kieferorthopädische Abteilung eines zahnärztlichen Institutes. Es handelt sich meistens um schwierige Fälle, die eine langwierige und in den Methoden oft wechselnde Behandlung erfordern, die für den allg. prakt. Zahnarzt kaum in Frage kommt. Dank der Invaliden-Versicherung ist die finanzielle Seite gelöst, so dass der Andrang zur Behandlung auch aus diesem Grunde grösser geworden ist. Leider ist die allgemeine Auffassung, dass mit dem Verschluss der Lippe und des Gaumens die Hauptsache getan sei, ganz unhaltbar. Die Gebissentwicklung dieser Lippen-Kiefer-Gaumenspalten ist primär und sekundär stark gehemmt. Die Meinungen gehen noch auseinander, ob eine primäre Wachstumshemmung vorliege, oder ob die starke Hemmung der Oberkiefer-Entwicklung als Folge der Operation zum Gaumenverschluss anzusehen sei. Die Schwierigkeit der kieferorthopädischen Spätbehandlung solcher Fälle hat überall zu Versuchen geführt, die Endresultate zu verbessern. Die kieferorthopädische Beeinflussung der Kiefer wurde weiter vorverlegt und man spricht heute allgemein von einer präoperativen kieferorthopädischen Behandlung. Sie beruht darauf, dass die Kiefer des Säuglings noch ausserordentlich leicht beeinflussbar sind und dass der Säugling mit Lust und Ausdauer an etwas saugt, was man ihm in den Mund gibt. Er gewöhnt sich leicht daran, eine Platte tagsüber und nachts im Munde zu halten. Die Nahrungsaufnahme ist aus leicht verständlichen Gründen wesentlich erleichtert, weil die Nasenhöhle von der Mundhöhle getrennt wird, was uns auch die Mitarbeit der Mutter sichert. Diese präoperative kieferorthopädische Behandlung hat zum Ziel, die Kieferfortsätze so zu formen, dass der Verschluss der Lippe ohne Spannung erfolgt und dass der später notwendige Gaumenverschluss erst durchgeführt wird, wenn der Oberkiefer eine gute Form und die Zahnreihen eine gesicherte Intercuspidation aufweisen. Eine der in Zürich versuchsweise durchgeführten präoperativen orthopädischen Behandlungsmethoden ist in Abb. 11 dargestellt. Sie zeigt, ohne auf Einzelheiten einzugehen, die Art der Behandlung nach MCNeIL. Die Vielzahl von neuen Methoden und Variationen in deren Ausführung beweist, dass alles wieder im Flusse ist. Überall setzt sich aber die Erkenntnis durch, dass nur die enge Zusammenarbeit eines Teams, bestehend aus Chirurg, Kieferorthopäde, Sprachlehrer, Prothetiker, imstande ist, die optimale Behandlung der Spaltträger zu gewährleisten. |
||
| Bachofen,Reinhard | Transport und Verteilung von markierten Substanzen III. Einfluss der Fütterungsmethode auf Absorption und Transport von 32P bei Phaseolus vulgaris. | 107,31-39 |
| Durch Untersuchungen des zeitlichen Ablaufs (l~48 Stunden) der Aufnahme und des Abtransports von 32p aus Blättern von Phaseolus konnte gezeigt werden, dass bei Verwendung der vom Blatt aufgenommenen Stoffe als Berechnungsgrundlage der Anteil der abtransportierten Stoffe nach einer Zeit von ca. 12 Stunden ziemlich unabhängig ist von der Wahl der folgenden Fütterungsmethoden: Auftropfen der Lösung auf die Oberseite des Blattes, Auftropfen auf dessen Unterseite oder Blattzungenfütterung mit nach dem Stiel offener Blattzunge. Bei letzterer Methode wird nahezu alles gefütterte Phosphat vom Blatt aufgenommen; sie ist deshalb als für unsere Zwecke am geeignetsten zu betrachten. | ||
| Bachofen,R. | V. Ueber die Natur der transportierten Kohlehydrate bei Phaseolus multiflorus. | 107,41-47 |
| Pflanzen von Phaseolus
multiflorus wurden während 1-4 Stunden über das jüngste
trifoliate Blatt mit radioaktivem Co2 versorgt. Die Fixierung des Kohlenstoffs
erfolgte im gefütterten Blatt sehr rasch (zum Teil bis 70% in einer
Stunde), während in Früchten nach 4 Stunden noch rund die Hälfte
der markierten Kohlenstoffverbindungen in 70% Alkohol löslich waren.
In Leitorganen lag der Fixierungsgrad zwischen 5 und 15 % je nach Fütterungsdauer.
Als Transportzucker konnte eindeutig Saccharose bestimmt werden; auf Grund der hohen spezifischen Markierung darf auch Raffinose als Transportform von Kohlehydraten angenommen werden. Die Radioaktivität nimmt in der Hauptachse logarithmisch ab. Seitliche Organe scheinen die logarithmische Verteilung nicht zu beeinflussen. |
||
| Suter,K. | Ueber Quelltöpfe, Quellhügel und Wasserstollen des Nefzaoua (Südtunesien). | 107,49-64 |
| Aus der vorliegenden kurzen Darlegung geht hervor, dass zwischen den Wasservorkommen des Nefzaoua, seien sie nun natürlichen oder künstlichen Ursprungs, ein enger Zusammenhang besteht. Darauf weisen übrigens auch die chemischen Untersuchungen des Wassers hin, das sie zutage fördern, und dessen Temperaturen, die im allgemeinen zwischen 240 und 270, doch häufig zwischen 250 und 260 liegen (CII. DOMERGUF, 5. 115). Über die geologisch-hydrologischen Verhältnisse dieses artesisch gespannten Wassers weiss man aber im Grunde genommen noch nicht viel. Nach CH. DOMFRGUE (5. 117) soll das Wasser, das an vereinzelten Stellen am Südfusse des Südastes, und zwar vom Am Brimba im E bis zum Am el Ksir im W, hervorsprudelt, aus den wasserführenden Turon-Kalken herstammen. Doch für gewisse Abschnitte des Nefzaoua dürfte nach dem gleichen Autor als Wasserlieferant eine andere Schicht in Betracht fallen, nämlich das oberste Glied der Kreide (Campan). | ||
| Schüepp,M. | Die Reduktion des Luftdrucks auf das Meeresniveau. | 107,65-100 |
| Schlussfolgerungen
1. Für die Reduktion des Luftdruckes auf das Meeresniveau von einer höhergelegenen Station aus ist eine Annahme über den Temperatur- und Feuchtigkeitsgehalt der Luft in der fiktiven Zwischenschicht notwendig. Die Feuchtigkeit ist dabei - ausgenommen die feuchtwarmen (tropischen) Gebiete von zweitrangiger Bedeutung. Bei der Temperatur kann als Näherung der vertikale Gradient der internationalen Atmosphäre a 0,65°/100 m eingesetzt werden, doch lassen sich bei entsprechend gewählter Ausgangstemperatur Ts im Stationsniveau auch andere Annahmen, zum Beispiel eine isotherme Atmosphäre, verwenden. Entscheidend ist somit die Wahl von Ts. 2. Die Diskussion der anzustrebenden Ziele und der praktisch durchführbaren Möglichkeiten ergibt drei prinzipiell verschiedene Wege: a) Falls das Ziel der Reduktion darin besteht, die einzelnen Hoch- und Tiefdruckgebiete in ihrer Bahnkurve und Intensität möglichst genau zu verfolgen (zum Beispiel auf Zirkumglobalkarten), muss die Temperatur in der fiktiven Zwischenschicht möglichst eine Extrapolation der Temperaturverhältnisse der freien Atmosphäre darstellen, was in der Praxis am besten durch die Wahl von Ts=(T+T12)/2 eventuell mit einem additiven Zusatzglied F erreicht wird (bei persistenten Bodeninversionen, vor allem in den kalten Klimaten). b) Falls die reduzierten Werte ein möglichst getreues Abbild der Windverhältnisse auf hochgelegenen, flachen Gebieten vermitteln sollen, muss eine konstante, jedoch von den extrapolierten Werten der freien Atmosphäre nicht stark abweichende Temperatur verwendet werden, also ein regionales Mittel, das entweder auf Grund der aktuellen Messungen oder als klimatologischer Mittelwert bestimmt werden kann. c) An Stelle der Methode b kann für hochgelegene Teile des Gebietes, zum Beispiel für Hp>= 800 m auf eine Reduktion auf das Meer verzichtet und in diesem Gebiet die Höhenlage einer Standarddruckfläche (850 bzw. 700 mb) eingesetzt werden, welche ungefähr der Geländehöhe entspricht. Die Äquidistanz der Höhenkurven (Isohypsen) ist dabei zur leichteren Beurteilung der Gradientwindverhältnisse derjenigen der Isobaren im Meeresniveau anzupassen (40 m entsprechen 5-mb-Abständen). Die Methode c ist besonders dort b vorzuziehen, wo infolge grosser Temperatur-gegensätze innerhalb des Gebietes sich bereits in verhältnismässig geringem, vertikalem Abstand (zum Beispiel 0 m und 1500 m) grosse Unterschiede im Luftdruckbild ergeben, zum Beispiel im Winter in Zentralasien. Für eine weltweite Übermittlung der Meldungen scheinen die mit Hilfe von a berechneten reduzierten Werte die zweckmässigste Lösung zu sein, während für Spezialkarten in kontinentalem oder subkontinentalem Massstab b und c Vorteile bieten können. Zur Durchführung von b sind entsprechend reduzierte Luftdruck-Angaben für das Stationsnetz notwendig, welche sich in Form einer Zusatzgruppe zum internationalen Code übermitteln lassen. 3. Bei der Frage, ob die Reduktion auf das Meeresniveau beibehalten werden soll oder entsprechend dem in der freien Atmosphäre verwendeten System die Höhenangabe der 1000-mb-Fläche mit Vorteil an deren Stelle treten könnte, zeigen sich positive wie auch negative Gesichtspunkte (positiv zum Beispiel die Vereinheitlichung der Darstellung Boden und Höhe, ferner erleichterte Reduktion im Gebiet der winterlichen kontinentalen Antizyklonen, negativ zum Beispiel die Komplizierung der Reduktion auf dem Meer sowie die für weite Kreise ungewohnte Darstellung des Druckfeldes durch Höhenkurven). Die negativen Punkte überwiegen dabei, so dass - ausgenommen die durch die Methode b speziell erfassten Gebiete - sich mindestens im gegenwärtigen Zeitpunkt kein Übergang zur Isohypsendarstellung aufdrängt. 4. Bei der Reduktion hochgelegener Stationen (Hp > 800 m) auf eine darüberliegende Standardfläche H850 bzw. H700 ist bei der Festlegung der T5-Werte auf die tatsächliche Temperatur im Höhenintervall H850 bzw. H700-Hp abzustellen. Regionale Untersuchungen sollen zeigen, ob im Vergleich zur Annahme Ts=(Ts+T12)/2 durch andere Wahl von Ts eine verbesserte Annäherung an die richtigen Werte erzielt wird. 5. Die Feuchtigkeit wird in den tropischen Gebieten durch einen Zuschlag zu Ts berücksichtigt, wobei dieser in °C die Grösse (0,12) ><(herrschender Dampfdruck e) in mb in der Bodenwetterkarte erreicht, in den Höhenkarten 850 und 700 mb dagegen 0,15 e. 6. Die Punkte 1. 5. zeigen, dass das gestellte Problem offenbar nicht mit einer Einheitsmethode, einem «Patentsystem» für alle vorkommenden Zweckbestimmungen generell gelöst werden kann, sondern dass sich neben den für globale Zwecke benötigten Reduktionswerten nach (2 a) für einzelne Regionen spezielle Lösungen entsprechend (2 b) und (2 c) aufdrängen. |
||
| Waldmeier,M. | Die Sonnenaktivität im Jahre 1961. | 107,101-116 |
| The present paper gives
the frequency numbers of sunspots, photospheric faculae and prominences
as well as the intensity of the coronal line 5303 Ä and of the solar
radio emission at the wavelength of 10.7 cm, all characterizing the solar
activity in the year 1961.
Die vorliegende Veröffentlichung gibt die die Sonnenaktivität charakterisierenden Häufigkeitszahlen der Sonnenfiecken, der photosphärischen Fackeln, der Protuberanzen, die Intensität der Koronalinie 5303 Ä und diejenige der solaren radiofrequenten Strahlung auf der Wellenlänge 10,7cm. Mean daily sunspot relative-number Mittlere tägliche
Sonnenflecken-Relativzahl 53,9 (112,3)
The tables 1, 2 and 11 give the daily values of the relative-numbers,
of the group-numbers and of the radio emission, the tables 3, 5, 6, 8 and
9 contain the distribution in latitude of the spots, faculae, prominences
and of the coronal intensity. Fig. 1 and 3 are showing the course of the
relativenumbers and of the radio emission, and by fig. 2 the distribution
in latitude of the.spots, faculae, prominences and of the coronal intensity
is demonstrated.
|
||
| Peyer,B. | Ueber einige Fragen der Gebissgestaltung. | 107,117-125 |
| Einleitung
Es freut mich, zur Festschrift für meinen Freund HANS FISCHER etwas beitragen zu dürfen, und ich danke den Veranstaltern für die freundliche Aufforderung. Ein Beitrag zu einer Festschrift soll weder zu umfangreich noch zu belanglos sein. Glücklicherweise ergaben sich nun bei der während der letzten Jahre mit Unterstützung durch den Schweizerischen Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung durchgeführten Ausarbeitung einer Odontologie Befunde, deren Mitteilung, obwohl sie ein Spezialgebiet betreffen, doch von allgemein-biologischem Interesse sein dürfte. Ich wähle zwei Beispiele aus, eines aus den Haien und Rochen, das andere aus den Reptilien. Die Chondrichthyes, d.h. die Haie im allerweitesten Sinne, besitzen in ihrer Mundhöhle in der Regel zweierlei Zähne, nämlich Gebisszähne, die manchmal einen komplizierten Zahnbau aufweisen und deren Zahnwechsel durch eine Zahnleiste beherrscht wird, und andererseits Zähnchen der Mundschleimhaut, deren Zahnbau, wie derjenige der Hautzähnchen der Haifische, einfach bleibt und deren Zahnersatz, wie auch der Zahnersatz der Hautzähnchen der Haifische, ohne sichtliche Regel erfolgt. Bei einigen Haien gingen nun die Zähnchen der Mundschleimhaut verloren. Sehr viele Gattungen und Arten besitzen indessen noch solche Mundschleimhautzähnchen. Diese Tatsache geriet jedoch so sehr in Vergessenheit, dass von ihr in den meisten odontologischen Darstellungen neueren Datums überhaupt nicht mehr die Rede ist. Im folgenden brauche ich, der besseren Verständlichkeit halber, den Ausdruck Haie im systematischen Sinne von Chondrichthyes, d.h. von haifischartigen Fischen im allgemeinen. Bei den Haien in diesem Sinne dauert der Zahnersatz in unerschöpflicher Fülle das ganze Leben hindurch an. Die Anzahl der Ersatzzahngenerationen ist übrigens nicht genauer bekannt und für die einzelnen Gattungen jedenfalls verschieden. Ein Ersatzzahn wird nun nicht an der Stelle, wo er an gelegt wird, später auch funktionieren, sondern er muss den Ort, wo er auf dem Kiefer fixiert wird und seine Funktion aufnehmen kann, durch eine von innen (lingual) nach aussen (labial) gerichtete Dislokation erreichen. Durch welche Kräfte diese Verschiebung bewirkt wird, ist |
||
| Thomas,E.A. | Die Eutrophierung von Seen und Flüssen, deren Ursprung und Abwehr. | 107,127-140 |
| Beitrag zur Festschrift zum 70.Geburtstag von Prof.Dr.Hans Fischer. | Durch Abwässer auch wenn diese mechanisch und biologisch gereinigt sind gelangen reichlich Düngstoffe für Algen und höhere Wasserpflanzen in die Flüsse und Seen. Die als Düngstoffe besonders wichtigen Nitrate und Phosphate stimulieren das Wachstum von Algen und höheren Wasserpflanzen, was zu mannigfaltigen Schädigungen und Belästigungen führt. Als direkte Massnahme gegen die Eutrophierung der Flüsse und Seen verspricht die gründliche Entfernung der Phosphate aus den Abwässern am meisten Erfolg. Wo in industriellen Betrieben grössere Mengen von Phosphaten ins Abwasser gelangen, sollen diese Phosphate wenn möglich schon innerhalb des Betriebes aus dem Abwasser entfernt oder die phosphatreichen Abwässer landwirtschaftlich verwertet werden. Auf einige weitere Hilfen in der Abwehr der Eutrophierung bei Seen und Flüssen wird hingewiesen. Bei der Wahl von Abwehrmassnahmen ist dem speziellen limnologischen Charakter jedes einzelnen Gewässers besonders Rechnung zu tragen. | |
| Schnurrenberger,H. | Ueber einige interessante Reptilfunde in der libyschen Wüste. | 107,141-145 |
| Es ist manchmal erstaunlich, wie vegetationslose, abgelegene Wüstengebiete Reptilien noch Lebensraum bieten können. Obschon sich die Herpetofauna der libyschen Sahara auf die Oasen, die steppenartigen Vegetationsgebiete und die ausgetrockneten Flussläufe (Uadis), also auf Gebiete mit mehr oder weniger Pflanzenwuchs, konzentriert, kann es vorkommen, dass an Stellen, wo keine Lebensbedingungen vorhanden zu sein scheinen, Reptilien oder deren Spuren gefunden werden. Ich möchte hier vor allem vier bemerkenswerte Fundorte beschreiben (cf. Abb. 5): | ||
| Leuthold,W. | Vorzugstemperatur, Temperaturwahl und Temperaturabhängigkeit der Bewegungsaktivität bei Drosophila subobscura und Drosophila obscura. | 107,147-154 |
| Diskussion und Zusammenfassung
Die Ergebnisse aller erwähnten Versuche zeigen unter anderem, dass Drosophila subobscura noch bei tieferen Temperaturen aktiv ist als D. obscura. Diese Befunde im Laborversuch stehen in Einklang mit faunistischen Beobachtungen an den beiden Arten. So steigt zum Beispiel D. subobscura in den Alpen höher hinauf als D. obscura (BURLA 1951). In Nordeuropa besteht allerdings nach den bisher vorliegenden Fangergebnissen ein Widerspruch in dieser Hinsicht, indem D. subobscura noch nie innerhalb des Polarkreises gefunden wurde, wohl aber D. obscura (BASDEN 1956, BASDFN und HARNDEN 1956). Doch erweist sich im allgemeinen D. subobscura hinsichtlich Vorkommen und Biotopwahl entschieden euryöker als D. obscura. Vor allem reagiert die Art auf Änderungen von Umweltfaktoren weniger empfindlich als D. obscura. Nähere Angaben zu diesen Feststellungen finden sich bei BURLA (1951), BURLA und GREUTER (1959 a, b), BURLA (1961), KOCH und BURLA (1962). In der mittleren Vorzugstemperatur konnten keine Unterschiede zwischen den beiden Arten gefunden werden; für die ökologische Valenz spielt aber der Mittelwert eine untergeordnete Rolle. Von Bedeutung ist vielmehr die Temperaturtoleranz, d.h. der Temperaturbereich, innerhalb dessen die Art eine normale Aktivität zeigt. Als Mass für die Temperaturtoleranz kann bei geeigneter Versuchsanordnung die Streuung der mittleren Vorzugstemperatur dienen. Temperaturwahl und Bewegungsaktivität hängen von verschiedenen endogenen Faktoren ab, so von Geschlecht, Alter und physiologischer Konstitution (Ernährungszustand) der Versuchstiere. Da zwischen Bewegungsaktivität und Dispersion eine enge Korrelation besteht, ist auch die Dispersion dem Einfluss der genannten Faktoren unterworfen. |
||
| Thomas,E.A. | Versuche mit Plankton-Test-Loten im Baldeggersee. Schlussteil, vom 13.Mai bis 14.Oktober 1958. | 107,155-196 |
| 5. Das Verhalten anderer Planktonalgen
Ceratium hirundinella fand sich bei der 10., 12. und 13. Exposition vereinzelt im freien See; den Lebensraum der Test-Lote schien diese Alge dagegen nicht zu ertragen, eher den der Versuchsflaschen. Andere Planktonalgen erlangten im Sommer 1958 weder im Baldeggersee noch in den Test-Loten oder Versuchsflaschen eine produktionsbiologische Bedeutung. 6. Keimzahl und coliforme Bakterien
7. Das Verhalten der Zooplankter
8. Phytoplankton und Nitrat- und Phosphatgehalt
|
||
| Steiner,H. | Befunde am dritten Exemplar des Urvogels Archaeopteryx. | 107,197-210 |
| Mit allen diesen Befunden erweist sich der dritte Archaeopteryx als eine aufschlussreiche Ergänzung der beiden früheren Exemplare. Am 2. September 1954 hielt de Beer vor der zoologischen Sektion der "British Association for the Advancement of Science" an ihrer Versammlung in Oxford eine bedeutsame Präsidialrede über Archaeopteryx und die Evolution. Darin lenkte er die Aufmerksamkeit auf die Tatsache, dass während noch manche Eigenschaften dieses fossilen Urvogels unverkennbares Reptilienerbe sind, nicht viel weniger Bildungen echte Vogelmerkmale darstellen. Es steht Archaeopteryx zwischen zwei Tierklassen, den Reptilien und den Vögeln, und dennoch stellt er kein Übergangs- oder Mittelding dar. Keine oder nur sehr wenige seiner Merkmale sind wirklich intermediär, denn während die einen noch ganz reptilienhaft verbleiben, sind die anderen schon echt vogelartig. Diese Merkmale liegen wie ein Mosaik nebeneinander, derart, dass der Übergang vom Reptil zum Vogel sich, wie es De BEER zu bezeichnen vorschlägt, in einer Art von «Mosaik-Evolution» abspielte. Bei diesem Entwicklungsgang sind es immer nur einzelne Strukturen und Organsysteme, welche genotypisch und konstitutionell durch die Selektion gefördert werden und damit die Merkmale einer nächsthöheren Klasse entwickeln, ohne die früheren ganz zu verlieren. Auf diese Weise müssen Formen entstehen, die eine Mischung, ein Mosaik, ursprünglicher und spezialisierter Eigenschaften aufweisen. Beispiele hierfür liefern alle Klassen der Wirbeltiere. Sie sind dem Paläontologen gut bekannt. Dennoch scheint es mir fraglich zu sein, ob die Bezeichnung Mosaik-Evolution das Wesen der evolutiven Vorgänge wirklich erfasst. Zunächst ist es nicht denkbar, dass im harmonischen Aufbau und funktionellen System eines Organismus einzelne Teile sich selbständig weiter entwickeln könnten, ohne andere Teile oder Organe und damit den Gesamtorganismus zu beeinflussen. Sodann ist in allen diesen Beispielen der Übergangstypen unverkennbar, wie das eigentliche Agens der Evolution ein Wechsel der Lebensbedingungen gewesen ist. Ein jeder solcher Wechsel lässt einen Organismus nur weiterbestehen, wenn ihm die Anpassung an die neuen Lebensbedingungen durch den erhöhten Selektionsdruck auf die in erster Linie hierfür in Betracht kommenden Organe und Strukturen gelingt. So war es beim Übergang vom Wasser zum Landleben bei den fischartigen Vertebraten unter vorauseilender Ausbildung pentadaktyler Extremitäten (Ichthyostega), bei den Reptilien infolge der gänzlichen Emanzipation vom Wasserbiotop (Hornschuppen, Entwicklung der Eier mit Amnionbildung des Embryos), bei den Mammaliern bei ihrer Anpassung an eine ausserordentliche Vielgestaltigkeit ihres Lebensraumes (Haare, Homoiothermie, heterodontes Gebiss, Squamoso-dentales Kiefer-gelenk, Zwerchfell, Milchdrüsen, Gehirnentfaltung). Sie alle weisen aber neben den für ihren Klassentypus charakteristischen Eigenschaften eine mehr oder weniger grosse Anzahl unverkennbar primitive Merkmale auf, welche ihren früheren Organisationsstufen zukamen. Es sind Merkmale, welche für die neuen Anpassungen nicht in Betracht kamen. Solange sie ihre Funktionsfähigkeit nicht einbüssten, konnten sie noch neben den fortschrittlichen Differenzierungen bestehen bleiben, aber sobald sie bedeutungslos wurden, fallen sie der Rudimentation anheim. Das Nebeneinander höherer und primitiver Merkmale ist somit eine allgemeine Evolutionserscheinung, verschieden ist im konkreten Falle lediglich der Grad der Rudimentation ursprünglicher Differenzierungen, die so weit gehen kann, dass Rudimente vollständig verschwinden und damit der Übergangscharakter der betreffenden Form ausgelöscht wird. Die Evolution, Entwicklung einer Tierform aus einer andern, stellt sich nicht als ein Mosaik der Merkmale dieser beiden Tierformen in den sogenannten missing links dar, sondern in der Bildung neuer Eigenschaften auf einer übernommenen früheren Grundlage, welche selbst allmählich verschwindet. Dass hierbei vielfach ein Funktionswechsel der früheren Organe eintritt, der aber ihre Struktur vollständig ändert, soll nicht übersehen werden, auch nicht, dass funktionslos gewordene Strukturen, solange sie nicht stören oder ihr Material zum Aufbau neuer Bildungen gebraucht wird, sehr lange persistieren können. Darnach erscheint Archaeopteryx nach wie vor als ein Dokument der schon im Mesozoikum eingetretenen, beschleu ... | ||
| Schnurrenberger,H. | Neuer Fund der afrikanischen Hausschlange, Boaedon fuliginosum fuligi-nosum (Boie) in Südmarokko. | 107,211-212 |
| Fundort: Inezgane N30°22'25" W9°32'14", südl. Agadir | ||
| Hauschteck,E. | Die Chromosomen einiger in der Schweiz vorkommenden Ameisenarten. | 107,213-220 |
| Summary
Chromosome sets of twelve ant species from the subfamilies Myrmicinae and Formicinae have been investigated and diploid numbers between 8 and 30 have been found (see Table). The diploid chromosome number of the Formicinae is usually higher than those of the Myrmicinae. Species with bw Chromosome numbers have longer chromosomes than species with high chromosome numbers. In the genus Lasius, four species have a diploid number of 30 and two species have a diploid number of 28 chromosomes. The latter belong to two different subgenera. The karyotype of Leptothorax exhibits an exceptionally long chromosome and shows additionally two striking constrictions on one pair of chromosomes. |
||
| Hantke,René | Zur Altersfrage des höheren und des tieferen Deckenschotters in der Nordostschweiz. | 107,221-232 |
| Die Deckenschotter zwischen
der Lägern und dem Rhein
Seit R. Frei (1912) werden zwischen der Lägern und dem Rhein, dem klassischen Gebiet der schweizerischen Deckenschotter, zwei noch weitgehend zusammenhängende höhere Schotterfluren unterschieden, die als höherer und tieferem Deckenschotter der Günz- und der Mindel-Eiszeit zugeschrieben werden. R. Frei zeichnete für diesen Bereich Kurvenkarten ihrer Auflagerungsflächen, die er als präglaziale Landoberfläche bzw. als solche der ersten Interglazialzeit betrachtete. Würden diese effektiv die Landoberfläche im Präglazial bzw. in der ersten Interglazialzeit darstellen, so müsste sich das Rheintal in diesem Abschnitt seit der Günz-Eiszeit der Auflagerungsfläche des höheren Deckenschotters um 270 m, seit der Mindel-Eiszeit der Auflagerungsfläche des tieferen Deckenschotters - um 200 m eingetieft haben. Doch liegen die altersmässigen Zuordnungen selbst hier nicht endgültig klar und bedürfen - trotz neuerer morphologischer Arbeiten - einer erneuten kritischen Überprüfung. Insbesondere ist das günz- bzw. mindeleiszeitliche Alter dieser hoch-gelegenen Schotterfluren gar nicht bewiesen. Auch sie können sehr wohl jünger sein. Möglicherweise sind sie ebenfalls mit alten Eisrandlagen vorstossender Gletscher in Zusammenhang zu bringen, boten doch der Tafeljura und die flachliegenden Molasseserien des Mittellandes den randlichen Schmelzwässern der durch das Rheintal, das Glattal und das untere Aaretal vorstossenden Gletscherzungen die einzige Möglichkeit einer Schotterablagerung. Dass die Ablagerung dieser hochgelegenen Schotter sowohl an der Egg als auch am Siggenberg sehr eisrandnah erfolgt sein musste, ist bereits von L. DU Pasquier (1891: 98/99) bemerkt worden, wies doch schon er auf die eingelagerten gekritzten Geschiebe in den Deckenschottern der Egg und auf die Blockfazies am Siggenberg hin. Ebenso betonte J. Hug (1917) verschiedentlich das Auftreten von Grundmoränen-Einlagerungen, die er sogar zur Gliederung der Günz-Eiszeit in einen Egg- und einen Albis-Vorstoss heranzog. Das Einfügen der Schottervorkommen zwischen Lägern und Rhein zu mehr oder weniger einheitlichen Fluren mit sanftem Gefälle gegen NW lässt sich auch in diesem Abschnitt sehr gut mit dem ausgeglichenen Gefälle ehemaliger Gletscheroberflächen erklären. Inwieweit diese alten Gletscherstände mit Eisrandlagen der Mindel- und der Riss-Eiszeit bzw. mit solcher der Elster, Saale- und Warthe-Eiszeit gleichzusetzen sind, bleibt noch zu untersuchen. Ebenso kann die Zerschneidung der höheren Deckenschotterplatte Dürn-Gländ (Siggenberg)-Bowald-Egg-Stadlerberg durch das Surbtal, die Talung Niederweningen-Siglisdorf und das Bachsertal nur durch mächtige Gletscherschmelzwässer und kaum durch Bäche in einer Interglazialzeit erfolgt sein. Derartige Schmelzwässer erfordern jedoch Riss-Gletscherstände. .... |
||
| Furrer,E. | Der Bergsturz von Bormio. | 107,233-242 |
| Über den Bergsturz sind
keine geschichtlich verbürgten Nachrichten bekannt. Dass er von nacheiszeitlichem
Alter ist, erweist sich durch das Fehlen von Moränen innerhalb des
Ablagerungsgebiets. Der Schutt besteht, abgesehen von Rollsteinen der Abflussrinnen,
durchwegs aus Kalk (einschliesslich Dolomit). Moränen hätten
eine andere Textur und müssten weit vorwiegend die Silikatgesteine
des Violatales enthalten. Lediglich in der Randzone, aber ausserhalb der
Bergsturzablagerungen, habe ich an wenigen Stellen Moränen beobachtet
(siehe Abb. 1). Zwar begegnete ich im Schuttgebiet vereinzelten Silikatblöcken
bis zu ½ m³ Inhalt. Sie sind also erheblich grösser als
die Rollsteine und sind nicht gerollt. Wahrscheinlich sind sie aus höher
gelegenen Moränen in das Schuttgebiet abgestürzt. Dafür
spricht auch, soweit ich beobachten konnte, ihr Vorkommen nahe der Randzone.
Über die Dimensionen sich einen Begriff zu gestalten, hält überaus schwer, da von den ursprünglichen Sturzmassen schon sehr viel, vielleicht weit über die Hälfte weggeräumt ist. Zudem wissen wir nicht, wie tief sie hinabreichen. Möglicherweise ist der Talkessel von Bormio übertieft, da sich hier zur Eiszeit gewaltige Eisströme aus vier Tälern - den Tälern Viola, Frae'le, Braulio und Zebrü/Furva - vereinigten. In welchen Mächtigkeiten sich in diesen Tälern die See-, Fluss- und Bergsturzablagerungen übereinanderschichten, ist mir nicht bekannt. Für den Weststrom dürfte der Schutt bei Premadio eine Mächtigkeit von mindestens 200 m betragen haben, auch nahe dem westlichen Ende noch über 100 m. Nehmen wir bei 5 km2 Schuttfläche ein Mittel von 100 m an, so gelangen wir auf 500 Millionen m3 oder ½ km3. Diese Sturzmasse wäre den beiden von Oberholzer berechneten Klöntaler Bergstürzen ungefähr gleichzustellen. Der wirkliche Inhalt könnte auch weniger, eher aber mehr ausgemacht haben. An Ursachen muss wohl in erster Linie an die erosive Tätigkeit der Adda gedacht werden, die nach dem Rückzug der Gletscher besonders lebhaft eingesetzt haben dürife. Es darf nicht vergessen werden, dass das Bett der Adda früher weiter östlich am Fuss des Reit lag, dessen Hang sie unterspülte. Ausserdem kann die Überschiebungsfläche am Reit als Gleitfläche gewirkt haben, indem das Niederschlagswasser in die zerklüfteten Kalk- und Dolomitmassen einsickerte und auf dem kristallinen Grund die glimmerreichen Schiefer aufweichte, so dass gleichsam eine Schmierfläche zustande kam, ähnlich den von Nagelfluhplatten überlagerten Mergeln am Rossberg ob Goldau. Inwieweit als weitere Ursache die Entlastung vom Eisdruck nach dem Abschmelzen der Gletscher im Spiel war, ist schwierig zu beurteilen. Diese und vielleicht noch andere Ursachen mögen einzeln oder vereint den Absturz ausgelöst haben. Die Entstehung der Bergsturzlandschaft von Bormio dürfte damit in einigen Hauptzügen geklärt sein. Auf mehrere Unsicherheiten habe ich bereits hingewiesen, und es bleiben noch weitere Fragen offen, deren einige hier gestreift sein mögen. Dass der Bergsturz ein einmaliges Ereignis war, glaubte ich vor 50 Jahren bejahen zu müssen. Ich stand damals unter dem Eindruck der Darstellungen durch Albert Heim über die Bergstürze von Goldau, Elm und Flims und der glarnerischen, die Oberholzer beschrieben hat. Heute möchte ich neben einem Hauptsturz, der seine Wellen bis hoch jenseits der Viola hinaufgeworfen hat, auch weitere, kleinere Stürze gelten lassen, die vor- und nachher vom Reit und vom Monte delle Scale niedergegangen sind. Die verschiedenen Stürze nach Herkunft und in ihrer Aufeinanderfolge zu unterscheiden, dürfte schwierig sein, einerseits wegen der Einheitlichkeit des Gesteins im Gebirgszug Seale-Reit, anderseits wegen der weit fortgeschrittenen Abtragung der Sturzmassen. Dagegen kann ich der Auffassung von R. Pozzi und A. Giorcelli (Boll. Serv. Geol. d'Italia, Vol. 81, 1960, S.55/56), die die ganze Trümmermasse vom Monte delle Scale herleiten, nicht zustimmen. Erstens sind die Abrissnischen am Scale-Grat viel zu klein, als dass aus ihnen eine so gewaltige Sturzmasse hätte herausbrechen können. Zweitens öffnen sie sich nach SSW, während die Ablagerungen schon südlich darunter mit dem Weststrom ihr Ende finden (Abb. 8). Eher könnte mit der Annahme gerechnet werden, dass die Felsmassen aus dem Raum zwischen Scale und Reit herstammen, wo sich heute die Adda in einer tiefen Schlucht hindurchwindet; denn dieser Durchbruch aus dem alten Tal BraulioFrae'le nördlich der Kette Reit-Scale-Plator, das sich früher aus dem Stelvio-Gebiet nordwestwärts nach dem Engadin hin entwässert hat, ist geologisch jung. In diesem Zusammenhang sei immerhin auf die Möglichkeit hingewiesen, dass auch vom Monte delle Scale einst ein grosser Bergsturz niedergegangen sein könnte. Betrachten wir die Gebirgskette Scale/Reit mit ihren Fortsetzungen westwärts zum Plator und ostwärts zum Cristallo (Abb. 8 und Landeskarte «Berninapass») eine Kette, die stratigraphisch und tektonisch als einheitlich erkannt wurde , so fallen beim Monte delle Scale zwei Abweichungen auf: Die Kammhöhe liegt mindestens 400 m tiefer, und sie ist um rund 500 m nach Süden vorgeschoben. Sofern nicht tektonische Ursachen wie Absenkung und Transversalverschiebung vorliegen, könnte man sich in der Linie Plator-Reit einen Scale-Kamm von rund 3000 m Höhe denken, der durch Absturz während oder vor der Eiszeit zur heutigen Höhe erniedrigt wurde und dessen Trümmer bereits weggeräumt sind. Für eine künftige Bearbeitung fehlt es also nicht an ungelösten Problemen. |
||
| Kuhn,W. | Der Firnzuwachs pro 1961/62. 49. Bericht | 107,243-251 |
| Resumé 1961/62
Die winterliche Schnee-Akkumulation war auf Clariden etwas übernormal, auf den übrigen in diesem Bericht erwähnten Gletschern etwa normal. Die Ablation wurde im Hochgebirge erst von Mitte Juli an intensiv; bis Mitte September schmolzen dann aber grosse Schneemengen, wobei die Firngrenze namentlich auf den Bündner Gletschern hoch hinauf rückte. Das Temperaturgefälle von Süden nach Norden war im Sommer 1962 über Europa gegenüber der normalen Verteilung verstärkt; daraus erklären sich auch gewisse regionale Unterschiede innerhalb der Schweizer Alpen |
||
| Burla, H. | Die öffentlichen naturhistorischen Sammlungen und die medizinhistorische Sammlung beider Hochschulen in Zürich | 107,252 |
| Einleitung
In Zürich bestehen an der Universität und an der E.T.H. eine Reihe naturhistorischer Sammlungen, die nicht nur für den Unterricht an der Hochschule und für wissenschaftliche Untersuchungen bestimmt, sondern auch der Öffentlichkeit zugänglich sind. Über die Herkunft dieser Sammlungen, ihren Aufbau und ihre mannigfachen Funktionen sollen die nachfolgenden Berichte Aufschluss geben. Es ist vorgesehen, solche Berichte in Jahresabständen zu wiederholen. Die mineralogisch-petrographische, die geologische, die botanische, die zoologische und paläontologische Sammlung stehen in engei Beziehung zur Naturforschenden Gesellschaft in Zürich. Sie erwuchsen aus einem Raritätenkabinett, das mit seinen Anfängen in das 18. Jahrhundert zurückreicht und 1745 bei der Gründung der Naturforschenden Gesellschaft in Zürch an diese überging. Um die gleiche Zeit wurde an der Walche ein botanischer Garten errichtet. Das Naturalienkabinett, welches jegliche Art von Naturgegenständen aufnahm, war zunächst bestimmt für Naturprodukte aus dem Kanton Zürich. Die grosse Schenkfreudigkeit seiner Gönner führte allerdings dazu, dass diese Beschränkung bald fallen musste, und fortan fanden Sammelobjekte aus allen Erdteilen im Kabinett Aufnahme. Von seinem alten Standort im Zunfthaus «Zur Meisen» verbrachte man es 1821 ins «Hinteramt», am Münzplatz, wo 1837 die Universität entstand, und bei welcher Gelegenheit die Sammlungen in den Besitz des Kantons übergingen. Fortan dienten sie als Lehrsammlungen für den Hochschulunterricht. Mit der Gründung des Eidgenössischen Polytechnikums wurde der Bund Mitbesitzer der Sammlungen. Diese wurden ins Poly-Gebäude überführt, nachdem zwischen Bund, Kanton und Stadt in den zwei Verträgen von 1859 und 1860 die Besitzverhältnisse der «Vereinigten Sammlungen» geregelt waren. Mit dem Neubau der Universität 1911-1914 erfolgte eine Aufteilung dieser Sammlungen, die bereits 1908/09 in einem «Aussonderungsvertrag» festgelegt wurde. Die mineralogisch-petrographische wie auch die geologische Sammlung gelangten an die ETH. Von den zoologischen Präparaten erhielt die ETH eine kleine Lehrsammlung, während der Grossteil der Universität zukam. Er bildete den Grundstock für die gegenwärtigen Sammlungen. Von den Fossilien gelangten diejenigen mit stratigraphischer Bedeutung an die ETH, während die bemerkenswerten Wirbeltiergruppen der Universität zufielen. Die Verteilung nahm Rücksicht auf die Forschungsrichtung der beteiligten Institute. Jüngeren Datums ist die ethnographische Sammlung der Universität, die 1888 entstand. 1956 wurde vom Zoologischen Museum ein selbständiges Paläontologisches Museum abgetrennt. Seit 1961 ist der Öffentlichkeit eine medizinhistorische Sammlung zugänglich, über welche ebenfalls berichtet wird. Die nachfolgenden Ausführungen über die einzelnen Sammlungen beziehen sich im wesentlichen auf das Jahr 1961. An dieser Stelle sei im Namen aller Sammlungsvorstände, den zuständigen Behörden sowie den Gönnern gedankt für mannigfache Förderung. Den Mitgliedern der Naturforschenden Gesellschaft seien die Sammlungen zum Besuche empfohlen. |
||
| Grünenfelder, M. | Die mineralogisch- petrographische Sammlung der ETH | 107,252-255 |
| Die Sammelaktivität, die
im Laufe der Zeit zu den gegenwärtigen Beständen der mineralogisch-petrographischen
Sammlung der ETH führte, hat vor rund 200 Jahren begonnen. Die Naturforschende
Gesellschaft in Zürich hatte bereits am Ende des 18. Jahrhunderts
durch Erwerbung von privat angelegten Sammlungen sowie durch Käufe
von einzelnen Mineralien die ersten Ansätze zu einem systematischen
und nach wissenschaftlichen Gesichtspunkten vereinheitlichten Mineralienkabinett
geschaffen. Durch zahlreiche Geschenke konnte die Sammlung zu Beginn des
19. Jahrhunderts weiter vergrössert werden.
Unter dem ersten Ordinarius für Mineralogie und Petrographie an der ETH und der Zürcher Universität, Prof. A. Kenngott, erhielt die Sammlung durch das testamentarische Vermächtnis des bekannten Zürcher Mineralogen, D. F. Wiser, sein berühmtes Mineralienkabinett. Ende 1908 ging die mineralogische Sammlung durch den Ausscheidungsvertrag in den Besitz der Eidgenossenschaft über. Mit dem Umzug des Mineralogischen Institutes aus dem Hauptgebäude der ETH in das neue Naturwissenschaftliche Gebäude an der Sonneggstrasse 5, wo die Sammlung das ganze erste Unterstockwerk einnahm, ist sie unter den Konservatoren L. Weber (1921-1931) und R. L. Parker (1931 bis 1958) in einer ihrem Umfang und Reichtum entsprechenden Weise zur Schau gestellt worden. Es ist das Verdienst Prof. Parkers, insbesondere die Systematik alpiner Kluftminerallagerstätten ausgearbeitet zu haben, eine Arbeit, die in seinem 1954 erschienenen Buch «Die Mineralfunde der Schweizeralpen» (Verlag Wepf & Co., Basel) niedergelegt worden ist. Die Bestände sind zum grössten Teil in permanente Ausstellungen zusammengefasst und als einzige museumsartige mineralogische und petrographische Kollektion in Zürich dem Publikum zugänglich (Öffnungszeiten jeweils am 1. und 3. Sonntag des Monats, 10-12 Uhr, ausgenommen Feiertage; Eingang Clausiusstrasse). Als Sammlung für Forschung und Unterricht ist sie stets eng mit dem Institut für Kristallographie und Petrographie der ETH verbunden und spiegelt in ihrem Aufbau die jeweils am Institut gepflegte Forschungstätigkeit und spezielle Arbeitsrichtung wieder. In neuester Zeit (1957 und 1961) wurden durch den Bau von Forschungslaboratorien im nordwestlichen Seitensaal der Sammlung grössere Umstellungen notwendig, die eine Neuordnung der bisherigen Schausammlung bedingten. Die Sammlung gibt in ihrer Gesamtheit Auskunft über die die äussere Lithosphäre auf bauenden Mineralien und Gesteine. Sie versucht, dem Besucher die äusseren Merkmale sowie die Mannigfaltigkeit in der Erscheinungsform der Mineralien zu erklären. Die oft vollkommene Kristallausbildung lässt für jede Mineralart, als natürlich auftretende Verbindung, Symmetrieeigenschaften, Habitus und Tracht erkennen, die gesetzmässige Äusserungen ihres atomaren Aufbaus sind. Die Ausstellung enthält eine grosse Anzahl von alpinen Mineralklüften, an denen besonders die Wachstumsart der Kristalle, ihre Aggregatformen und vor allem die verschiedenartigsten Mineralvergesellschaftungen (Paragenesen) studiert werden können. In einem petrographischen Sektor bietet sie Einblick in die Vielfalt der am Aufbau der Erdkruste massgeblich beteiligten Gesteine, die ihrer Entstehung nach durch Mineralbestand, Textur und Struktur bestimmt sind. Die einzelnen Abteilungen der Sammlung umfassen: - eine Ausstellung mit Kristallstufen, die der speziellen Mineralogie gewidmet ist, geordnet nach kristallchemischen Gesichtspunkten; - ein Edelsteinkabinett mit Beispielen natürlicher sowie künstlicher Schmucksteine, mit Modellen bekannter historischer Diamanten und gebräuchlichen Schlifformen; - eine regional-alpine Mineraliensammlung mit Kristallstufen schönster Qualität, die Seltenheitswert besitzen; - eine Sammlung bautechnisch wichtiger Gesteine und nutzbarer Mineralien der Schweiz; - einen erzlagerstättenkundlichen Teil, in welchem klassische Assoziationen von Erzmineralien und Gangarten durch grosse Schaustücke vertreten sind, und - eine petrographische Sammlung eruptiver sowie metamorpher Gesteine mit Kollektionen aus bekannten petrographischen Provinzen. Einen wertvollen Bestandteil der Sammlung bildet die bereits erwähnte Kollektion von F. D. Wiser mit vor allem alpinen Mineralien, die einmalige, ausgezeichnete Exemplare von klassischem Wert enthält. Dazu kommen die Sammlungen alpiner Mineralparagenesen von J. Königsberger und F. Weber sowie diejenige von C. Taddei mit Mineralien aus den Tessiner Alpen. Gesondert aufgestellt sind instruktive Kristalimodelle - konstruiert und der Sammlung von Herrn C. Pinsent geschenkt -, ferner eine Gesteinssammlung schweizerischer Vorkommen und eine Demonstrationssammlung mit Modellen bekannter Meteorite. Wichtige Eigenschaften der Mineralien wie Härte, Glanz und Farbe werden an typischen Objekten in den 1958 erworbenen vier Leuchtkästen demonstriert, in welchen auch die Gliederung der Gesamtsammlung durch Schaustücke erklärt wird. Ferner sind darin eine kleine Ausstellung über Mineralien für die Atomenergie sowie eine über «Strahler des Atomzeitalters» untergebracht. In einer speziellen Vitrine sind Tektite der bisher bekannten Fundorte vereinigt. Durch die Tätigkeit ehemaliger Schüler im Ausland wurden der Sammlung verschiedentlich Gesteins- und Erzkollektionen vermacht, die besonders für den Unterricht von Bedeutung sind. Desgleichen sind Belegsammlungen der im Laufe der Jahre am Institut für Kristallographie und Petrographie ausgeführten Diplom- und Dissertations-Arbeiten, grösstenteils regional-petrographischer Art, in Depots aufbewahrt. Die Sammlung verfügt auch über namhafte Bestände von petrographisch wichtigen Belegstücken aus Stollen- und Tunnelbauten. Als weiteres Depositum wird die Studiensammlung vulkanischer Gesteine der Stiftung Vulkaninstitut 1. Friedlaender verwaltet. Personal Direktor der mineralogisch-petrographischen Sammlung ist seit 1954 Prof. Dr. F. Laves, Vorsteher des Institutes für Kristallographie und Petrographie an der ETH; Konservator ist seit 1959 PD Dr. M. Grünenfelder. |
||
| Hantke, René | Die geologische Sammlung der ETH | 107,256-258 |
| Die Anfänge der geologischen
Sammlung der ETH gehen auf alte Bestände der Stadt und des Kantons
Zürich zurück, die bei der Gründung des Polytechnikums dem
ersten Dozenten für Geologie, Arnold Escher v.d. Linth, für eine
Schausammlung überlassen wurden. Sie bildeten, zusammen mit Eschers
eigenen Aufsammlungen und den ihm von seinem Freunde Oswald Heer bearbeiteten
fossilen Pflanzenresten, den Grundstock der Sammlung.
Durch einen Vertrag vom Mai 1860 zwischen Bund, Stadt und Kanton Zürich wurde unter dem Vorsitz des damaligen Präsidenten des Schweizerischen Schulrates, Karl Kappeler, für die natur-wissenschaftlichen Sammlungen eine Aufsichtskommission bestellt und für die mineralogischgeognostische und paläontologische Sammlung von der Zürcher Regierung Bergrat StockarEscher gewählt. Ab 1. Januar 1861 waren auch die Rechtsverhältnisse der Sammlungsobjekte zwischen den drei Beteiligten geregelt. Von 1850 an war Karl Mayer-EymaR beim Ordnen der Fossilien des Jura und des Tertiärs die rechte Hand Eschers. 1858 wurde er de facto Konservator des paläontologisch-stratigraphischen Teils; 1862 erfolgte die definitive Wahl. Bis zu seinem Lebensende im Jahre 1907 entfaltete Mayer, dank seiner zahlreichen europäischen und nordafrikanischen Studienreisen zur Erforschung des Tertiärs, eine gewaltige und fruchtbare Sammeltätigkeit, für die bald die Raumverhältnisse im Hauptgebäude des Polytechnikums viel zu eng wurden. Für den allgemein-geologischen Teil amtete Casimir Moesch von 1866 bis zu seiner hauptamtlichen Wahl als Konservator der zoologischen Sammlung im Jahre 1888. Im selben Jahr kamen auch die von Oswald Heer bearbeiteten fossilen Insekten an die geologische Sammlung. Im Hinblick auf den Neubau der Universität ging die geologische Sammlung Ende 1908 durch einen neuen Vertrag an die ETH über, während die zoologischen Objekte vom Kanton Zürich übernommen wurden. Für die paläontologischen Objekte wurde am 1. März 1909 zwischen den beiden Institutsvorständen Albert Heim und Arnold Lang eine etwas künstliche Aufteilung vereinbart. Darnach kamen die fossilen Wirbeltiere ans zoologische Museum der Universität, die übrigen Fossilien, die Wirbellosen und die Pflanzen, gingen an die geologische Sammlung der ETH über. Ebenso wurden Doppelstücke von Wirbeltieren in der geologischen Sammlung belassen und dieser das Recht eingeräumt, vor Abgabe der Objekte davon Gipsabgüsse zu nehmen. Im Jahre 1908 trat Louis Rollier die Nachfolge Mayers an. Durch umfangreiche Belegsammlungen zu seinen Studien im Juragebirge und im Alttertiär der Schweizer Alpen sowie durch grosse Ankäufe von klassischen ausländischen Fundstellen wurden die Bestände erneut gemehrt. Unter ihm erfolgte 1915 auch der zahlreiche Tücken bietende Umzug der gesamten Sammlung aus dem Hauptgebäude ins neue erstellte Naturwissenschaftliche Gebäude der ETH an der Sonneggstrasse-Clausiusstrasse, wo die geologische Sammlung gegenwärtig im Erdgeschoss untergebracht ist. Als Nachfolger Rolliers wirkte Alphonse Jeannet von 1931 bis zu seinem Rücktritt im Jahre 1953. Seiner wissenschaftlichen Tätigkeit verdankt die Sammlung insbesondere die prachtvollen Ammoniten aus dem Eisenerzlager von Hernach sowie umfangreiche Kollektionen fossiler Seeigel. In den letzten Jahren wurde die Reorganisation in bezug auf Ausstellungstechnik und wissenschaftliche Bearbeitung veralteter Sammlungen aktiver an die Hand genommen. Administrativ ist die geologische Sammlung dem Geologischen Institut der ETH unterstellt. Direktor ist der Institutsvorsteher, Prof. Dr. A. Gansser, Konservator Prof. Dr. R. Trümpy; als wissenschaftlicher Bearbeiter wirkt PD Dr. R. Hantke. Ferner ist der Sammlung ein Halbassistent, z.Z. W. Ryf, zugeteilt. Die Sammlung ist jeweils am 1. und 3. Sonntag des Monats von 10-12 Uhr geöffnet (Eingang Clausiusstrasse). Sie kann von Interessenten und Schulklassen auch während der Woche (8-12 und 14-18 Uhr) nach Anmeldung bei einem der oben erwähnten Herren oder beim Hausmeister besichtigt werden (Eingang Sonneggstrasse 5). Umfang der Sammlungen
Aufgaben
|
||
| Markgraf, F. | Der Botanische Garten und das Botanische Museum der Universität Zürich | 107,259-261 |
| Die Anlage befindet sich auf
einem Moränenhügel (Zürich 39, Pelikanstrasse 40), der ehemals
unter dem Namen «Katz» zu einer Bastion ausgebaut worden war
und heute unter Denkmalschutz steht. Das bepflanzte Gelände hat eine
Grösse von ca. 2 ha, darin 600 mi Gewächshäuser. Es bietet
im Freiland Abteilungen für Blütenbestäubung, für Medizinal-
und Nutzpflanzen, für Insektivoren, für Systematik, für
Alpenpflanzen und für pflanzengeographische Gruppen der Mittelmeer-
und der neuseeländischen Flora. In den Gewächshäusern sind
die tropischen Gewächse nur nach ihren oekologischen Bedürfnissen
verteilt. Darunter ist aber eine nicht unerhebliche Anzahl seltener Arten
vertreten. An diesem Platz wurde der Botanische Garten 1837 angelegt. Er
bestand jedoch schon viel länger. Nachdem bereits Conrad Gessner im
16. Jahrhundert einen privaten botanischen Garten in Zürich unterhalten
hatte, legte ein Urgrossneffe von ihm, Johannes Gessner, um 1750 mit Hilfe
der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich einen Botanischen Garten
in der Walche an, leider auf Pachtland, so dass die Gesellschaft schon
bald den Gayten auflösen musste und in rührender Opferbereitschaft
privat die Pflanzen weiterpflegte, bis man im kantonalen Schimmelgut eine
neue Stätte für sie fand.
Nach Gründung der Universität (1833) wurde auch der Botanische Garten vom Kanton übernommen und 1837 auf die «Katz» verlegt. Der Pflanzenbestand, über dessen Herkunft, Erneuerung und Vermehrung sorgfältig Buch geführt wird und dessen Bestimmungen laufend kontrolliert werden, dient dem Unterricht der Universität, der Schulen, der Volkshochschule und dem allgemeinen Bildungsstreben des Volkes. Hierzu wird auch durch öffentliche Führungen beigetragen. Ausserdem dient er der wissenschaftlichen Forschung, z. B. für entwicklungsgeschichtliche und morphologische Studien an lebendem Material. Im Jahre 1896 übernahm der Kanton auch die Verantwortung für ein Botanisches Museum, für das die Gebäude im Botanischen Garten erweitert wurden. Sein Kernstück ist das Herbar. Daran gliedert sich eine Sammlung von Anschauungs- und Untersuchungsmaterial und die Kursräume usw. für die Studenten. Durch die oft stürmischen Zeiten erhalten geblieben sind an alten Sammlungen das Herbar Johannes Gessner aus der Zeit Linne's und das Herbar Hegetschweiler. Den Grundstock des moderneren Forschungsmaterials bildete das südwestafrikanische Herbanum H. Schinz, zu dem später viele andere Sammlungen aus aller Welt durch Geschenk, Tausch und Kauf hinzu-kamen, in neuerer Zeit besonders die Sammlung Daniker aus Neu-Kaledonien. Das Herbar enthält viele Belege für neu entdeckte Arten, die sorgfältig aufbewahrt und wissenschaftlichen Bearbeitern zugänglich gemacht werden. Es gehört heute schon zu den grösseren Herbarien der Welt und steht mit diesen in Austausch. Neben dem Weltberbar besteht ein umfangreiches Schweizer Herbar, aus dem z. B. die Verbreitung der Arten, nach den geographischen Bezirken der Schweiz geordnet, ermittelt werden kann. Die Aufgaben des Museums bestehen im Sammeln, Präparieren und Bestimmen von Pflanzen für Unterrichtszwecke, im Ordnen und wissenschaftlichen Durcharbeiten dieses Materials mit morphologischen, anatomischen und anderen Methoden zur Erforschung phylogenetischer Zusammenhänge und durch die Vielzahl von Belegexemplaren auch in der Ermittlung der Gesamtverbreitung der Arten. |
||
| Burla, H. | Das Zoologische Museum der Universität Zürich | 107,261-263 |
| Mit der Eröffnung des neuen
Universitätsgebäudes im April 1914 erhielt das Zoologische Museum
im Biologie-Trakt an der Künstlergasse 16 den gegenwärtigen Standort.
Die Einrichtung repräsentiert die um die Zeit der Jahrhundertwende
in Schwung gekommene stammesgeschichtliche Denkweise in der Zoologie und
blieb bis 1959 im wesentlichen unverändert. Der Gestalter des Museums
war der damalige Ordinarius für Zoologie und Vergleichende Anatomie,
Arnold Lang (1855-1914). Sein Schüler und Nachfolger, Karl Hescheler
(1868-1940), vollzog den endgültigen Ausbau.
Raumverhältnisse
Bestände
Wissenschaftliche Untersuchungen
Besuch
|
||
| Kuhn-Schnyder, Emil | Das Paläontologische Institut und Museum der Universität Zürich | 107,263-268 |
| Am 24. Mai 1956 beschloss der
Regierungsrat des Kantons Zürich auf Antrag der Philosophischen Fakultät
II der Universität ein selbständiges Paläontologisches Institut
und Museum zu schaffen. Damit wurde eine Entwicklung abgeschlossen, die
der grosse Zürcher Zoologe Arnold Lang eingeleitet hatte.
Arnold Lang (1855-1914), ein Schüler von Ernst Haeckel, wurde 1889 an die beiden Zürcher Hochschulen berufen. An der Universität begründete er ein blühendes Zoologisch-vergleichend anatomisches Institut, das sich anfänglich ganz der vergleichenden Anatomie der wirbellosen Tiere verschrieb. Das Ziel war, die Geschichte der Tierstämme mit Hilfe der Ontogenie zu rekonstruieren. In der Entwicklungsgeschichte sah man damals nicht nur den Schlüssel zur Lösung aller vergleichend anatomischer Probleme, sondern auch den wahren Lichtträger in der Stammbaumforschung. Lang war einer der ersten, die die Grenzen der Embryologie zur Lösung phylogenetischer Fragen erkannte. «Ich habe schon oft gegen diejenige Auffassung der Ontogenie polemisiert, die in den Larvenstadien einer Tierform ohne weiteres die getreue Reproduktion ihrer Stammform erblickt.» (A. Lang, 1904). Die führenden Zoologen wurden der stammesgeschichtlichen Problematik allmählich müde. A. Lang stürzte sich mit seinem ganzen Feuereifer und seiner unermüdlichen Arbeitskraft auf das Gebiet der experimentellen Vererbungslehre. Der junge Karl Hescheler widmete sich auf Wunsch seines Lehrers der Paläontologie, für die an der Universität Zürich 1903 eine besondere Professur geschaffen wurde. Während experimentelle Arbeitsmethoden Theorie und Praxis der Zoologie zu bereichern begannen, wurde die Erforschung der Stammesgeschichte zur Domäne der Paläontologie. Das praktische Arbeitsgebiet, das sich Karl Hescheler (1868-1940) auserkor, war die Untersuchung prähistorischer Knochenreste. Es liegt an der Grenze von Zoologie und Paläontologie. Wenn sich K. Hescheler nicht eigentlich paläontologischen Aufgaben zuwandte, ist dies dem Umstande zuzuschreiben, dass er durch die Übernahme der Nachfolge A. LANGS eine gewaltige Bürde auf sich genommen hatte. Zu Beginn unseres Jahrhunderts besass in der Schweiz einzig Basel in H. G. Stehlin (1870-1941) einen begnadeten Paläontologen. Nicht als Professor, sondern als Privatmann widmete er sich mit beispielloser Energie und grossem Erfolg der Erforschung tertiärer Säugetiere und bildete eine Reihe ausgezeichneter Mitarbeiter heran. In Zürich war damals die Paläontologie selbstlose Dienerin der Geologie. Wohl hatte hier ein Oswald Heer (1809-1883) gewirkt. Doch hinterliess er keine Schule. Im Sommersemester 1918 habilitierte sich Bernhard Peyer, einer der letzten Schüler Arnold Langs, für Paläontologie und vergleichende Anatomie an der Universität Zürich. Damit hatte B. Peyer ein Arbeitsfeld in Angriff genommen, das wegen der damaligen schwierigen Zeiten keineswegs leichte Erfolge versprach. Bald war jedoch ein grossartiges Arbeitsfeld gefunden: Die Erforschung der Triasfauna der Tessiner Kalkalpen. Im südlichsten Zipfel des Kantons Tessin, wo sich am Luganersee die Berge zum letzten Mal stauen und schroffe Hügel bilden, die dann gegen Süden abklingen, war im Erdmittelalter Meeresgebiet. Seine Ablagerungen sind spät, erst bei der Bildung der Alpen, Festland geworden. Aus bituminösen Schiefem dieser Sedimente waren schon in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts bei Besano, unweit Porto Ceresio, auf italienischem Boden, zahlreiche Wirbellose, Fische und unvollständig erhaltene Saurier der Trias bekannt geworden. Angeregt durch Ferdinand Broili in München und unterstützt durch Karl Hescheler konnte B.Peyer 1924 eine Grabung in gleichaltrigen Schichten am Monte San Giorgio auf Schweizer Boden durchführen. Ein erster Versuch, in einem der Stollen, in denen die bituminösen Schiefer durch eine Gesellschaft bergmännisch ausgebeutet werden, Fossilien zu gewinnen, schlug fehl. Über Erwarten erfolgreich war B. Peyer dagegen, als er in einem verlassenen Tagbau in der Valporina, am Südhang des Monte San Giorgio, seine Bergleute einsetzte. Dort konnte eine Schichtfläche freigelegt werden, und dann wurde Schicht um Schicht flächenhaft abgetragen. Neben Wirbellosen, Fischen und Mixosauriern wurde ein Placodontier geborgen. Das schöne Ergebnis ermunterte zu einer intensiven Fortsetzung der Grabungen. Sie wurde dank der grosszügigen finanziellen Unterstützung durch die Georges und Antome Claraz-Schenkung möglich. Im Laufe der Jahre wurden weitere Wirbeltierfaunen auch in den Meridekalken, die praktisch als fossilleer galten, entdeckt und ausgebeutet. Ebenso schwierig wie die Bergung eines Sauriers ist seine kunstgerechte Präparation. Für die Präparation stand anfänglich im Zoologischen Museum der Universität Zürich nur ein einziger kleiner Raum zur Verfügung, wo B. Peyer und einige Mitarbeiter in gedrängter Enge den Meissel und die Präpariernadel führten. Als eine grosse Hilfe, sowohl für die Präparation als auch für die wissenschaftliche Untersuchung der Funde, erwies sich die Anwendung von Röntgenaufnahmen. Dank der Grosszügigkeit von Prof. Dr. H. R. Schinz, dem Direktor des Röntgeninstitutes des Kantonsspitales Zürich, konnte sie B. Peyer erstmals in umfassender Weise in der Wirbeltierpaläontologie einführen. Der Kampf um die Geltung der Paläontologie in Zürich war jahrelang hart. Auf die Krise der dreissiger Jahre folgten düstere politische Verhältnisse. Der Staat musste und wollte sparen. Jede Verbesserung der Werkstatteinrichtung war ein grosses Ereignis. Erst als B. Peyer 1939 die Leitung des Zoologischen Museums übertragen wurde, liess sich freier atmen. Werkstätten und Magazine konnten ausgebaut, die Zahl der Mitarbeiter erhöht werden. Die heroische Periode der Zürcher Paläontologie ging, nachdem B. Peyer 1955 in den Ruhestand getreten war, mit der 1956 erfolgten Schaffung eines selbständigen Paläontologischen Institutes und Museums zu Ende. Das neue Paläontologische Institut und Museum ist also nicht auf dem Wege der Urzeugung entstanden. Seine Mutter ist das Zoologische Museum, sein Vater der Monte San Giorgio. Als Aussteuer wurden ihm die gesamten Bestände an Fossilien sowie eine Reihe von Räumen des Zoologischen Museums zugewiesen. Die erste Aufgabe bestand in der Organisation des Unterrichtes und der Forschung. Die Grundlagen des paläontologischen Unterrichtes bilden die Lehr- und Übungssammlungen. Dr. B. Ziegler baute eine Lehrsammlung wirbelloser Fossilien auf; daneben ist eine grosse Übungssammlung im Entstehen begriffen. Fehlendes Material wird durch Tausch und durch eigenes Sammeln aufgebracht. Deshalb wird jedes Jahr eine grössere Sammelexkursion durchgeführt. Solche Sammelexkursionen führen in kurzer Zeit über relativ ausgedehnte Gebiete. Ganz anders liegen die Verhältnisse bei der Beschaffung von Untersuchungsmaterial für die Forschung. Hier konzentrieren sich die Anstrengungen oft jahrelang auf einen ganz bestimmten Punkt. So arbeiten wir seit dem Jahre 1950 während der grossen Semesterferien in der Trias des Monte San Giorgio auf P. 902. Neben der Bergung ist die Präparation für das Schicksal eines Fossiles von entscheidender Bedeutung. Der Verbesserung und Verfeinerung der Präparationsmethoden wird deshalb die grösste Aufmerksamkeit geschenkt. Dank der Fürsorge der Behörden konnte die Einrichtung der Präparierwerkstätten bedeutend verbessert werden. Heute gehören sie zu den bestausgerüsteten Europas, und die Präparatoren sind Meister ihres Fachs. Damit und mit der Einrichtung von photographischen Laboratorien und der Schaffung einer eigenen Bibliothek sind die Voraussetzungen für die Forschung geschaffen. Unsere wissenschaftliche Tätigkeit hat verschiedene Brennpunkte. Natürlich liegt das Schwergewicht auf dem Gebiete der Wirbeltiere. Da im paläontologischen Unterricht und im geplanten Museum das Gesamtgebiet der Paläontologie berücksichtigt werden muss, ist es jedoch notwendig, auch Mitarbeiter zu gewinnen, deren Liebe den Wirbellosen gilt. Die vom Zoologischen Museum übernommenen Bestände an Fossilien bilden den Grundstock der wissenschaftlichen Sammlungen des paläontologisch~n Museums. Unsere wissenschaftlichen Sammlungen umfassen neben einer systematischen Sammlung eine Reihe von Spezialsammlungen. Unter den letzteren ist diejenige der Triasfossilien vom Monte San Giorgio weitaus die umfangreichste. Sie ist im grossen Magazin untergebracht. Die systematische Sammlung befindet sich gegenwärtig im Gang des II. Untergeschosses. Ihr definitiver Standort, der ehemalige Raum der Heimatsammlung im Zoologischen Museum, soll 1962 eingerichtet werden. Wir erachten es ferner als unsere Pflicht auch den Fossilfunden der engeren Heimat unsere ganze Aufmerksamkeit zu widmen. Mit den Problemen der Schaffung eines paläontologischen Schaumuseums werden wir uns in allernächster Zeit befassen. Es kann sich natürlich nicht darum handeln, eine grosse Schau im Stile des Basler Naturhistorischen Museums zu errichten. Im Biologiegebäude der Universität sollen nur die schönsten Stücke aus der Tessiner Trias öffentlich ausgestellt werden. Eine Übersicht über die Entwicklung des Lebens auf der Erde und eine Sammlung von Fossilien aus dem Kanton Zürich und seiner nächsten Umgebung werden voraussichtlich in einem neu zu errichtenden Museumsgebäude Platz erhalten. Ebenso sollen dort die Mammutfunde von Niederweningen und die S. Rothsche Kollektion der Pampas-Säugetiere aufgestellt werden. Nach diesem knappen Überblick über Herkunft und Charakter der paläontologischen Sammlungen der Universität Zürich, sei kurz über die Tätigkeit im Jahre 1961 berichtet. Personalverhältnisse
Verbesserung der Einrichtungen
Tätigkeit: Monte San Giorgio, Ammoniten, Krokodil Dielsdorf |
||
| Steinmann, A. | Die Sammlung für Völkerkunde der Universität | 107,268-273 |
| Die Sammlung für Völkerkunde
der Universität
die ihren Standort im Laufe ihrer wechselvollen Geschichte verschiedentlich verlegen musste, befindet sich heute im Hauptgebäude der Universität, Rämistrasse 71, Zürich 6. Die eigentlichen Sammlungsbzw. Ausstellungsräume einschliesslich der Photoabteilung und eines kleinen Magazinraumes sind im 2. Stock untergebracht und erstrecken sich vom Turmsaal des Kollegiengebäudes im rechten Winkel hinüber ins angrenzende Biologiegebäude (Abb. 1). Im gleichen Stockwerk befinden sich die aus dem Direktorzimmer, dem Arbeitszimmer des Konservators und dem Katalogzimmer bestehenden Verwaltungsräume sowie ein abseits gelegener Lesesaal im Kollegiengebäude mit der Hauptbibliothek, während die übrigen grösseren Magazinräume teils im 3. und teils im 7. Stock des Kollegiengebäudes gelegen sind. Die Anfänge der Sammlung gehen auf das Ende des vorigen Jahrhunderts zurück und fallen in eine Zeit, in der sowohl im Ausland wie in der Schweiz ethnographische Museen mit staatlicher und privater Unterstützung entstanden. Im Jahre 1888 ist sie als eine Schöpfung der ehemaligen, auf die Initiative wissenschaftlicher, kommerzieller und industrieller Kreise gegründeten Ethnographischen Gesellschaft «zwecks wissenschaftlicher Pflege und Förderung der Völkerkunde» ins Leben gerufen worden. Im Zuge der darauffolgenden Verschmelzung dieser Gesellschaft mit der einige Jahre später gegründeten Geographischen Gesellschaft ging die Sammlung im Jahre 1899 zunächst an die neue «Geographisch-Ethnographische Gesellschaft» über und wurde später (1914) von der Regierung des Kantons Zürich übernommen. Sie untersteht unmittelbar der Kantonalen Erziehungsdirektion. Anfänglich (1889) vorübergehend in der Rotunde des damaligen Börsengebäudes aufgestellt und von 1895 an vorübergehend in einigen Räumen am Seilergraben 5 notdürftig untergebracht, wurde ihr erst seit 1914 mit der Fertigstellung des neuen Universitätsgebäudes ihre gegenwärtige Heimstätte zugewiesen, wo sie in verschiedenen Etappen erweitert und ausgebaut worden ist. Infolge ihrer besonderen, zwischen dem Kollegien- und dem Biologiegebäude eingekeilten Lage, bildete bei ihrer inneren Ausgestaltung die Anpassung an die gegebenen Raumverhältnisse ein keineswegs leicht zu lösendes Problem, das erst nach jahrelangen Um- und Neuaufstellungen sowie diversen Erweiterungen auf eine einigermassen befriedigende Weise bewältigt werden konnte. In diesem Zusammenhang verdient vielleicht der erst 1939 eingerichtete und 1957 von Spezialisten für musealen Innenausbau nach den neuesten ausstellungstechnischen Prinzipien gestaltete und mit grossen Wandvitrinen, Plexiglasschaukästen, Spotlights und Spannteppich ausgestattete China-Saal besondere Erwähnung (Abb. 2); zusammen mit dem benachbarten Japan-Saal, dessen grossflächige Schau-... |
||
| Ackerknecht, E.H. | Die medizinhistorische Sammlung der Universität | 107,273-274 |
| Diese Sammlung enthält Gegenstände,
welche die Geschichte der Medizin von der Urzeit bis zur Gegenwart illustrieren.
Sie ist eine Abteilung des Medizinhistorischen Instituts der Universität
Zürich, und ist vor allem aus dem Sammelfleiss des Zürcher Arztes
PD Dr. med. Gustav Adolf Wehrli (1888-1949) entstanden. 1932 wurde sie
von der Universität erworben und 1961 dem Publikum zugänglich
gemacht. Sie befindet sich auf dem 4. Stock des Turms der Universität,
der in einen Ausstellungsstock und einen Magazinstock geteilt wurde, während
die «Papierabteilung» des Instituts (Bibliothek, Portrait-
und Illustrationensammlung, Briefe und Handschriften) im 6. Stock ansässig
ist.
Die Ausstellung dient dem Bildungs- und Lehrzweck der Sammlung. Sie enthält weniger als einen Zehntel der Bestände und besteht aus den besten und für das Publikum geeignetsten Stücken der Sammlung. Die Magazinbestände stehen vor allen Dingen für Forschungszwecke sowie auch zur Unterstützung anderer Institutionen bei temporären Ausstellungen zur Verfügung. Umfang der Sammlung
|
||
| Leibundgut, H. | Naturschutzkommission 1961,
17. Jahresbericht auf das Jahr 1961 |
107,252 |
| 17. Jahresbericht der Naturschutzkommission
der Naturforschenden Gesellschaft
in Zürich für das Jahr 1961 Die Naturschutzkommission bemühte sich um die rasche
Behandlung ihrer Anträge für die Bezeichnung der Naturschutzobjekte
von nationaler wissenschaftlicher Bedeutung im Kanton Zürich. Verschiedene
Objekte, so
|
||
| Höhn-Ochsner,W. | Zürcherische Naturschutzobjekte von nationaler wissenschaftlicher Bedeutung. Die Sihllandschaft zwischen Zürichsee und Zugersee. | 107,277-298 |
| I. Geologische Übersicht
Das Sihlgebiet zwischen Zürich- und Zugersee stellt allein auf diesem beschränkten Raume eine Landschaft dar, die durch ihren Reichtum an geologischen, pflanzen- und tiergeographischen Eigentümlichkeiten und ganz allgemein durch den Reiz ihrer Schönheit als einzigartig bezeichnet werden muss. Die sich hier durchschlängelnde Sihl vermochte nicht ein breites Tal zu formen, sondern durchfliesst von Schindellegi bis in die Gegend von Hirzel eine Schlucht, die stellenweise einen beinahe alpinen Charakter besitzt. Dazu erweist sich der Sihllauf von Schindellegi an abwärts als ein geologischer Sonderfall, wie er in diesem Ausmass in der ganzen Schweiz nirgends ein zweites Mal zu finden ist und wohl in ganz Europa sich kaum in dieser ausgeprägten Form wiederholt. Denn hier ist etwas ganz Unerwartetes geschehen. Hoch oben, an dem steilen ursprünglichen Talhang wurde ein jüngeres, epigenetisches Tal geschaffen, das in der gleichen Richtung wie das Haupttal des Zürichsees verläuft, aber viele hundert Meter über dem Grunde des letztem (Abb. 1). Während der letzten zwei Eiszeiten (Riss und Würm) wurde das Stammtal der Sihl, das heutige Zürichseetal, von den vordringenden Eismassen des Linthgletschers ausgefüllt und die aus den Schwyzerbergen hervorbrechende Sihl gezwungen, vereinigt mit der südlichen Flankenentwässerung des Gletschers, einen neuen Ausweg nach Westen zu suchen. Der einzig mögliche Weg führte dem Nordhang des Hohen Ron entlang. Die vom würmeiszeitlichen Linthgletscher gebildete Eisbarriere dauerte so lange, bis sich die Sihl, vereinigt mit den flankierenden Gletscherwassern, nicht nur durch die Seitenmoräne hindurchgegraben, sondern auch noch im anstehenden tertiären Felsuntergrund eine enge Felsschlucht auserodiert hatte. So ergab sich für die Sihl nach dem endgültigen Rückzug des Linthgletschers keine Möglichkeit mehr, in ihr ursprüngliches Stammtal zurückzukehren, wenn auch die niederste Stelle des Moränendammes bei Schindellegi kaum 15 m über dem Sihlbett liegt. ... II Flora (mit den typischen Pflanzen) III Fauna ... Und weitaus der grösste Teil dieser Lebewelt ist durch so kleine Tiergestalten vertreten, dass sie mit unbewaffnetem Auge kaum wahrgenommen werden können. Man denke nur an die Mikrobiozönosen der Sphagnumrasen. Welche ausserordentliche Bedeutung die Moore für die Erforschung der gesamten Nacheiszeit mittels der Pollenanalyse gewonnen haben, ist allgemein bekannt. Unser Sihlgebiet ist in den letzten Jahren in steigendem Masse für Dorf- und Stadtbewohner ein Wander- und Erholungsziel geworden. Die Vereinigung «Pro Sihltal» hat in verdankenswerter Weise den Zugang zu demselben zu erleichtern versucht durch Verbesserung und Neuanlagen von Wanderwegen längs der Sihl. Damit ist aber auch die Gefahr verbunden, dass gewisse Kreise unerlaubtes Neuland für Zeltlager, Camping und Weekendhäuschen benützen. Durch die noch weitgehende Unberührtheit vom motorisierten Verkehr, durch die ungezählten stillen Winkel, durch die Romantik seiner Felsschluchten, durch den reichen Wechsel im Relief des Geländes, durch die herrlichen Aussichtspunkte auf dem Berggrat und auf Moränenzügen stellt diese Landschaft einen grossen ideellen Wert dar, der durch die wissenschaftliche Bedeutung noch stark erhöht wird. Die Schaffung einer Schutzverordnung für das ganze Gebiet würde eine wichtige und wertvolle Ergänzung darstellen zu den schon bestehenden Schutzbestimmungen für die Moorreservate auf dem zürcherischen Moränenplateau. Dahin gehören nämlich. 1. Der Hüttnersee mit der vom Zürcher Regierungsrat festgesetzten Schutzzone. 2. Das im Besitze der Allmendkorporation Richterswil sich befindliche Flachmoor Haslenzopf auf Samstagern. 3. Die Hüttnerschanze, von der Gemeinde Hütten erworben, um diese historische Stätte der Nachwelt zu erhalten. 4. Schutz des Waldhochmoores Waldrain-Spitzenbühl durch den Gemeinderat Schönenberg. 5. Das Moor Hinterbergried, über das eine kantonale Schutzverordnung besteht. 6. Das Spitzenmoos Hirzel, das im November 1959 vom Schweizerischen Naturschutzbund käuflich erworben wurde. 7. Das Krutzelenmoos/Hirzel, das ebenfalls unter kantonaler Schutzverordnung steht. 8. Das Grindelmoos im Horgenberg, das mit dem Moos im Wührenbach von der Gemeinde Horgen angekauft und unter Naturschutz gestellt wurde. 9. Erlass einer Bauordnung und eines Zonenplanes zum Schutze des Landschaftsbildes in der Gemeinde Hirzel 1962. |
||
| Jaag, Otto & Suter,H. | Zürcherische Naturschutzobjekte von nationaler wissenschaftlicher Bedeutung. Der Rheinfall. | 107,299-305 |
| Allgemeines
Ich denke, dass der Rheinfall und seine Umgebung in mancherlei Hinsicht zu jenen Gegenden im Schweizerland gehört, die unbedingt als Ganzes und ungeschmälert erhalten bleiben müssen: 1. In wirtschaftlicher Hinsicht
Abb. 1. Der Rheinfall, nach Matthäus Merian (1642
erste Aufl., 1654 zweite Aufl.) (zu Seite 300/301).
durch die geologischen Gegebenheiten, speziell
|
||
| Suter,H, Knopfli,W. &Merz,W. | Zürcherische Naturschutzobjekte von nationaler wissenschaftlicher Bedeutung: Die Maschwander Allmend. | 107,305-318 |
| Zur Geologie
Vom geologischen Standpunkt aus gehört die Maschwander Alimend inklusive Rüssspitz und Rözi zu den schützenswerten Landschaffen des Reusstales. Neuere geologische Untersuchungen im Amt haben die eiszeitliche Entstehungsgeschichte dieser Landschaft erkennen lassen. Die Anlage des breiten, mit mittelglazialen bis rezenten Ablagerungen angefüllten Reusstales zwischen Emmen und Mellingen erfolgte in der Hochriss-Eiszeit als gemeinsame seitliche Schmelzwasserrinne des Reuss- und des Linth/Rheingletschers. Anlässlich einer Grundwasserbohrung nordöstlich Cham wurden in 54 m Tiefe mächtige Seetone getroffen, ein Hinweis dafür, dass dieses Tal, ähnlich wie dies im Limmat- und Glattal der Fall ist, in der Riss-Würm-Interglazialzeit von einem langgestreckten See eingenommen wurde. Leider fehlen im Reusstal tiefere Bohrungen, die diese Annahme bestätigen würden. Abb. 2. Alte Kopfweiden an der Lorze (Photo M. Weiss, Kantonales Hochbauamt). Biologie
... oberhalb Mellingen, der Reuss-Altlauf bei Fischbach
und die unter Schutz stehende «Stille Reuss» von Rottenschwil.
Grundsätzlich sollte auf der linken Reussseite der Landstreifen zwischen
der Reuss und dem alten Hochwasserdamm bzw. dem Binnenkanal (von Rickenbach
an) auf der Strecke Rottenschwil-Reussweiden in Höhe Stadelmatt von
einer Melioration ausgeschlossen bleiben. Eines völligen Schutzes
bedürfen nicht nur aus Gründen des Natur- und Landschaftsschutzes,
sondern auch zur Reinhaltung des Grundstromes sämtliche den Fluss
begleitende Waldungen. Es ist Sache der Naturfreunde, in den vier Reusskantonen
die Gebietsstrecken genauer zu bestimmen, die eines Schutzes von mehr als
bloss lokalem Interesse würdig sind.
Die Flora der Maschwanderallmend
|
||
| Suter,H. & Suter,K. | Zürcherische Naturschutzobjekte von nationaler wissenschaftlicher Bedeutung: Das Lägerngebiet. | 107,319-323 |
| Im folgenden wird dargelegt,
dass die Lägernkette, wenigstens im Abschnitt Hochwacht bis Baden,
samt der Halbklus von Ober-Ehrendingen mit den daselbst befindlichen Gipsgruben
in wissenschaftlicher Hinsicht ein Objekt von nationalem Interesse ist
und gegen Eingriffe des Menschen geschützt zu werden verdient. Das
vorgeschlagene Gebiet, das unbedingt als schutzwürdig erklärt
werden sollte, ist auf Abb. 1 eingetragen. Es gehört ins Hoheitsgebiet
der Kantone Aargau und Zürich.
Die Lägernkette zwischen Dielsdorf und Baden bildet den östlichsten Ausläufer des Kettenjura. Sie war immer und ist heute noch ein klassisches Gebiet der Jurageologie, in stratigraphischer wie auch in tektonischer Hinsicht. Die Lägern besteht zur Hauptsache aus mesozoischen Gesteinen der Trias- und Juraformation. Sedimente der Kreideformation fehlen, denn solche sind im ganzen Ostjura nicht abgelagert worden. Hingegen nehmen am Aufbau auch Gesteine des Tertiärsteil. Die Trias, im besonderen der dieser Formation angehörende Keuper, ist durch Sandsteine, Dolomite, vor allem aber durch dunkle und buntfarbige Mergel und Gipsgesteine vertreten, unzweideutigen Ablagerungen eines einst langsam austrocknenden Meeres, das damals unsere Gegend bedeckte. Der Gips ist, wie die prachtvollen Aufschlüsse in der Gipsgrube von Ehrendingen zeigen, als dichter, weisser bis rötlicher Alabaster ausgebildet, mit Kluftausfüllungen von weissem, stark seidenglänzendem Fasergips. Ganz reiner Alabaster wurde früher in Zürich zu allerlei Schmuckstücken verarbeitet. Den Gips, der hier während 2½ Jahrhunderten abgebaut wurde, verwendete man vor allem als Düngemittel zur Verbesserung des Ackerbodens. Der Abbau ist heute fast ganz eingestellt. Die Keuperformation stellt das tiefste noch aufgeschlossene Schichtglied der Lägern dar. Über dem Keuper folgen die Schichten der Juraformation: von unten nach oben die Ablagerungen Lias, Dogger und Malm. Während der Lias nur wenig mächtig, in Form von Mergeln und Sandkalken ausgebildet ist, nehmen Dogger und Malm grosse Flächen ein. Es handelt sich dabei um marine Mergel und Kalke. Die hellen Malmkalke bilden im besonderen den die ganze Gegend überragenden Berggrat mit den bekannten Aussichtspunkten Hochwacht, Burgruine, Burghorn (859 m) und Gugel. Auch das Ostende der Kette, von Regensberg bis Dielsdorl, besteht ausschliesslich aus Malmkalken. In den Schichten der Juraformation findet man häufig Versteinerungen: Ammoniten, Muscheln, Schnecken, seltener Schwämme. Die Kalksteine eignen sich als Baumaterial und werden heute in grossen Steinbrüchen bei Dielsdorf intensiv abgebaut. Die obern Malmkalke enthalten bis faustgrosse Feuersteinknollen, sogenannte Kieselkonkretionen, wie sie in verschiedenen Kalksteinen vorkommen können. Aus diesem Material stellten die Steinzeitmenschen ihre Werkzeuge her. |
||
| Thomas,Eugen A. | Carl Adolf Burckhardt-Zwicky (1873-1961)
(Seidenzwirnerei, Nähseiden) |
107,325 |
| Hunziker,E. | Carl Fridolin Baeschlin (1881-1961).
(Geodäsie) |
107,326-327 |
| Jenny,H. | Emil Giger (1885-1962).
(Botaniker) |
107,327 |
| Saxer,W. | Ernst Völlm (1898-1962).
(Mathematik, Nomogramme) |
107,327-328 |
| Gattiker,W. | Emil Ganz (1879-1962).
(Photographie, Kino) |
107,328-329 |
| Stüssi,F. | Zum 70.Geburtstag von Prof.Dr.H.Fischer. | 107,330 |
| Dütsch,H.U. | Atmosphärisches Ozon und Zirkulation in der Stratosphäre. | 107,331-332AR |
| 30. Oktober 1961 | Der Ozongehalt der Atmosphäre
variiert mit Jahreszeit und geographischer Breite und ist auch von der
Wetterentwicklung abhängig. Da das Gas durch photochemische Vorgänge
dauernd gebildet und zerstört wird, ist es nicht gleichmässig
mit der Luft vermischt, sondern weist ein Konzentrationsmaximum zwischen
20 und 25 km Höhe auf. Da sich nur in den oberen Teilen der Stratosphäre
ein photochemisches Gleichgewicht rasch einstellt, ist in der unteren Hälfte
der Ozonschicht die Verteilung des Gases nicht durch solche Reaktionen,
sondern durch Luftströmungen bestimmt, was die Differenzen erklärt,
die zwischen der aus der Theorie berechneten und der beobachteten Ozonverteilung
mit Jahreszeit und geographischer Breite auftreten. Da der Ozongehalt in
der unteren Stratosphäre eine konservative Eigenschaft einer Luftmenge
ist, kann das Gas als Tracer Verwendung finden. Zur praktischen Anwendung
eines solchen Verfahrens genügen aber Gesamtozonmessungen nicht, sondern
es muss der Ozongehalt als Funktion der Höhe bestimmt werden.
Im letzten Jahrzehnt sind eine Reihe von Methoden entwickelt worden, die sich zur routinemässigen Messung der vertikalen Ozonverteilung eignen. Sie arbeiten teilweise indirekt (vom Boden aus) und verwenden dabei Messungen am ultravioletten Zenitstreulicht (Umkehrmethode) oder im infraroten Strahlungsbereich, oder es werden optisch oder chemisch arbeitende Ozonsonden durch Ballone oder Raketen in die erforderlichen Höhen getragen. Durch wiederholten, gleichzeitigen Einsatz der verschiedenen Methoden versucht man die Vergleichbarkeit der Resultate, trotz gewissen Unsicherheiten in den Einzelbeobachtungen, zu sichern. Die bisherigen Ergebnisse der Messungen zeigen in mittleren Breiten einen ausgesprochenen Jahresgang des Ozongehalts in der unteren Stratosphäre (Anstieg während des Winters), der durch Ozonverfrachtung durch die allgemeine Zirkulation bedingt ist, während oberhalb von 25 bis 30 km die schwächeren jahreszeitlichen Variationen photochemisch gesteuert erscheinen. In der Äquatorialzone liegt das beobachtete Maximum der Ozonkonzentration viel höher als das theoretisch erwartete. Durch Luftströmungen wird hier aus dem unteren Teil der Stratosphäre ständig Ozon weggeführt und vermutlich nach der Winterhemisphäre höherer Breiten verfrachtet. Zwischen Temperaturverlauf und Ozongehalt der Stratosphäre besteht im Hochwinter eine ausgesprochene positive Korrelation, die wenigstens in höheren Schichten gegen das Frühjahr rasch abnimmt. Es kann daraus geschlossen werden, dass zur Zeit der höchsten Intensität der stratosphärischen Zirkulation die scharf ausgeprägten wetterhaften Schwankungen des Ozongehaltes im wesentlichen durch Vertikalbewegungen hervorgerufen werden, dass aber später bei zunehmenden meridionalen Gradienten auch advektive Vorgänge wichtig werden. Die Korrelation zwischen Tropopausenhöhe als Index für den troposphärischen Wetterablauf und dem stratosphärischen Ozongehalt zeigt eine gesetzmässige Verknüpfung zwischen der Zirkulation in den beiden Schichten der Atmosphäre, die aber mit zunehmender Höhe in der Stratosphäre rasch abklingt. Die Analyse im Einzelfall zeigt, dass daneben auch stratosphärische Störungen auftreten, die keine direkte Beziehung mit der Troposphäre aufweisen und zum Teil viel grösseren Massstab besitzen, wie sich besonders am Beispiel der explosionsartigen Stratosphärenerwärmung im Jahre 1958 zeigt. Durch Zusammenfassung von Temperatur- und Ozonmessung erhält man ein recht einheitliches Bild dieses stratosphärischen Umsturzes. Ein vorgeschlagenes Schema des jahreszeitlichen Ozonkreislaufes zeigt eine kontinuierliche Produktion in der tropischen Stratosphäre und einen in der Höhe nach der jeweiligen Winterhemisphäre gerichteten Ozonfluss, daneben eine Ozonzerstörung in Bodennähe zur Erklärung der beobachteten jahreszeitlichen Variation. Dabei werden jährlich etwa dreissig bis vierzig Prozent des atmosphärischen Ozongehalts zerstört und wieder gebildet. Man hofft durch Heranziehung anderer Tracer, wie Wasserdampf und radioaktiven Zerfallsprodukten sowie einer Ausweitung der Ozonmessungen, die noch unklaren Details dieses Schemas in den nächsten Jahren sichern zu können und damit zu einem bessern Verständnis der allgemeinen Zirkulation zu kommen. Überwachung der Konstanz der Sonnenstrahlung im nahen Ultraviolett sowie weltweite Ausmessung des oberen Teils der Ozonschicht von Satelliten aus, soll in den nächsten Jahren eine all-fällige Bedeutung des Ozons im gesuchten Zusammenhang zwischen Sonnenaktivität und irdischem Wetterablauf abklären. (Autoreferat) |
|
| Hunsperger,R. | Aktivierung von Wut und Angststimmungen beim Tier durch Hirnreizung. | 107,332AR |
| 13.November 1961 | Bei der Begegnung eines Tieres
mit einem Feind kann das Tier je nach der Umgebungssituation auf die Bedrohung
mit Flucht oder mit Abwehr, die sich bis zum Abwehrangriff steigern kann,
reagieren. Ähnliche Reaktionen können beim Tier in äusserlich
neutralen Umgebungsbedingungen durch künstliche, elektrische Reizung
in subkortikalen Gehirnabschnitten aktiviert werden. Da der Erfolg einer
zentral im Gehirn ansetzenden Reizung vorwiegend durch die Organisation
der Neurone in den betreffenden Bezirken und ihrer Verbindungen zu den
Effektorstrukturen bedingt ist, erlaubt die Methode der Himreizung Substrate,
die einer bestimmten Reaktion zugrunde liegen, lokalisatorisch zu bestimmen
und diese gegenüber anderen Hirnstrukturen abzugrenzen.
Die Versuche wurden mit der von W. R. Hess entwickelten Methode der elektrischen Reizung subkortikaler Hirnabschnitte an der wachen Katze durchgeführt. Durch Ausdehnung der von W. R. Hess im Zwischenhirn durchgeführten Reizungen auch auf Strukturen im Mittel- und Vorderhirn konnte ein komplexes, anatomisch zusammenhängendes Substrat abgegrenzt werden, das den Reaktionen Flucht, Abwehr und Abwehrangriff zugrunde liegt. Dieses System erstreckt sich von dorso-medialen Teilen des Mandelkerns im Vorderhirn durch Vermittlung der Stria terminalis bis zu deren Bettkern um die vordere Kommissur und von hier im Zwischenhirn kontinuierlich durch das Höhlengrau des Hypothalamus bis ins zentrale Höhlengrau des Mittelhirns. Innerhalb dieses Systems für Affektreaktionen lässt sich auf der Stufe des Zwischen- und Mittelhirns je eine Zone abgrenzen, aus der eine Abwehrreaktion ausgelöst wird. Diese ist charakterisiert durch Fauchen in Abwehrhaltung, Erweiterung der Pupillen, Zurücklegen der Ohren und Haarsträuben an Rücken und Schwanz. Aus einem grösseren Gebiet, das die beiden Zonen für Abwehr umgibt und untereinander verbindet, wird Flucht aktiviert. Verstärkte elektrische Reizung innerhalb der Abwehrzonen ergibt den Abwehrangriff, verstärkte Reizung in der Fluchtzone unter Umständen Fauchen, das von Flucht gefolgt ist. Auf der Stufe des Vorderhirns dieses Systems wird vor allem Knurren in Abwehrhaltung aktiviert. Flucht wird in diesen Strukturen selten ausgelöst; die Reaktion scheint bereits Elemente zu enthalten, die dem epileptischen Formenkreis angehören. Durch Einführung gewisser Reizmuster in die Versuchssituation, wie Versperren des Fluchtweges mit den Händen oder das Hinbringen von geeigneten Attrappen auf den Versuchstisch, kann gezeigt werden, dass das Tier auch während der künstlich aktivierten Reaktion auf Änderungen in seinem Wahrnehmungsfeld zweckentsprechend reagiert. So können Versperren des Fluchtweges beziehungsweise der Wahrnehmungsreiz der Attrappe statt der ursprünglichen Flucht nun Abwehr bedingen. Von besonderem Interesse ist die Entwicklung eines Abwehrangriffs bei Gegenwart einer Attrappe und lediglicher Reizung des Tieres in der Fluchtzone. Der psychologischen Betrachtung dieses Vorganges, nämlich einer Umwandlung von Flucht in Abwehrangriff, werden drei neurophysiologische Mechanismen zur Seite gestellt. Erstens eine mögliche Beeinflussung der Tätigkeit assoziativer Kortexabschnitte im Temporalhirn durch den Hirnstammreiz; zweitens eine experimentell nachgewiesene Steigerung der Erregbarkeit der Neurone in der Abwehrzone bei Reizung in der Fluchtzone; drittens eine Verstärkung der Abwehr durch eine länger dauernde Einwirkung des Reizstromes. (Autoreferat) |
|
| Hegglin,R. | Der Stoffwechsel des Herzmuskels. | 107,333AR |
| 27. November 1961 | Um eine Kontraktion des Muskels
herbeizuführen, sind Aktomyosin, ATP und Ionen in einem optimalen
Verhältnis sowie geregelte Austauschmöglichkeiten durch die Membran
notwendig. ATP gilt als Energielieferant, Aktomyosin ist die eigentliche
sich kontrahierende Eiweissubstanz, die Ionen und die den Ionenaustausch
regulierende Membran stellen das Milieu, in welchem sich die Kontraktionsvorgänge
vollziehen können, dar. Für den Kliniker handelt es sich darum,
zu wissen, welche dieser Faktoren bei der menschlichen Herzinsuffizienz
verändert sind. Man kann die Vorgänge, die sich bei den Stoffwechselvorgängen
im Muskel abspielen, auch in verschiedene Phasen einteilen:
1. Energiefreisetzung aus den energieliefernden Substanzen (Kohlenhydrate, Fette, Eiweisse). 2. Energiekonservierung im Herzmuskel der energiereichen Substanzen (ATP, ADP, Kreatinphosphor...). 3. Energieutilisation durch die Eiweisse (Aktomyosin), der sogenannten Kontraktionsmaschine. Eine Herzinsuffizienz als Folge eines gestörten Aufbaues der Energiesubstanzen findet sich bei Anoxämie, bei Verschiebung des optimalen lonengleichgewichtes (sogenannte hypodyname oder energetisch-dynamische Herzinsuffizienz), bei Ben-Ben (weil der Aufbau von ATP infolge Fehlens von Vitamin B1 durch Blockierung des Abbaues der Brenztraubensäure gestört ist). Bei gesteigerter Schilddrüsentätigkeit (Hyperthyreose) wurde wegen der durch Thyroxin verursachten Entkoppelung der Phosphorylierung eberifalls eine Verminderung des Energiekapitals vermutet. Die Verhältnisse liegen aber komplizierter. Der gestörte Myokardstoffwechsel wird offenbar durch eine sich günstig auswirkende Katecholaminwirkung, welche die Kontraktionskraft steigert, ausgeglichen. Bei der eigentlichen hämodynamischen Herzinsuf fizienz konnten keine signifikanten Änderungen des Myokardstoffwechsels festgestellt werden (BING und andere). Die Ergebnisse wurden dadurch gewonnen, dass der Gehalt der Nährstoffe im Arterienblut mit demjenigen des Herzvenenblutes verglichen wurde. Aus dem Verhältnis dieser beiden Werte kann auf den Stoffwechsel im Myokard geschlossen werden. Diese Befunde lassen den Schluss zu, dass die klinisch häufigste sogenannte hämodynamische Herzinsuffizienz keine primäre Stoffwechselkrankheit ist. Aufbau und Konservierung der Energieträger sind nicht gestört. Bei der hämodynamischen Herzinsuffizienz liegt dagegen eine Störung der Energieverwertung vor. Es konnten beim insuffizienten Herzen von mehreren Autoren Veränderungen des Aktomyosins gegenüber dem normalen Herzen festgestellt werden. Besonders war das Molekulargewicht nach Olson von 226 000 auf 695 000 Å gesteigert. Olson fand auch Veränderungen der Viskosität. Bing und Kako sahen zudem, dass das Aktomyosin, welches vom Myokard an Herzinsuffizienz verstorbener Menschen gewonnen wurde, eine weniger intensive Kontraktionsfähigkeit zeigte als das Aktomyosin von Normalen. Die Konsequenzen für die Behandlung der Herzinsuffizienz ergeben sich aus dieser Feststellung. Bei der seltenen hypodynamen Herzinsuffizienz muss die allgemeine Stoffwechselstörung (häufig Elektrolyte) korrigiert werden. Bei der hämodynamischen Herzinsuffizienz, welche auch als Überlastungsinsuffizienz bezeichnet werden kann, ist dagegen eine Entlastung anzustreben. Senkung des Blutdruckes im grossen und kleinen Kreislauf sowie chirurgische Massnahmen können eine Entlastung bei manchen Fällen herbeiführen. Digitalis, das kräftigste Medikament, um die Kontraktion anzuregen, wirkt wahrscheinlich direkt am Myosin. Diese Auffassung wird durch Untersuchungen WASERS gestützt und kann auch am besten mit der Muskelkontraktionstheorie, wie sie derzeit angenommen wird, in Übereinstimmung gebracht werden. (Autoreferat) |
|
| Blaser,J.P. | Neue Entwicklungen in der Beschleunigungsphysik. | 107,333AR |
| 11.Dezember 1961 | Unsere heutigen Kenntnisse über
die Atomkerne sowie über Elementarteilchen (Nukleonen, Elektronen,
Mesonen, Hyperonen) wurden zum überwiegenden Teil durch Experimente
mit Beschleunigern gewonnen. In den letzten 10 Jahren sind neue Prinzipien
entdeckt worden, die es gestattet haben, die Energie der künstlich
beschleunigten Teilchen bis auf 30 Milliarden Elektrovolt zu treiben.
Warum sind Beschleuniger zur Erforschung der Elementarteilchen nötig, und wie rechtfertigt sich der enorme materielle Einsatz für diesen rein wissenschaftlichen Zweck? (Die grössten heutigen Projekte kosten schon fast 1 Milliarde Franken!) Die zwischen den Kernteilchen auftretenden Kräfte sind so stark, dass sie nur durch Bombardierung durch sehr schnelle Teilchen erprobt werden können. Die Kenntnis dieser Kraftgesetze ist eines der fundamental-theoretisch wie auch praktisch-technisch wichtigsten Ziele der heutigen Physik. Die Beschleunigung von Protonen muss in elektrischen Feldern erfolgen, nachdem der Wasserstoff ionisiert worden ist. Magnetische Felder ändern die Energie eines Teilchens nicht, sind aber zur Führung der Teilchen wichtig, da die Kraft proportional mit der Geschwindigkeit wächst. Statische Beschleunigungsspannungen sind auf etwa 5 Millionen Volt (Isolation) beschränkt (Van-de-Graaff). Weiter kommt man nur durch zyklische Beschleunigung in hochfrequenten Wechselfeldern. Während der falschen Polarität des Feldes muss das Teilchen vor dem Feld versteckt werden (Faraday-Käfig). Dieses Grundprinzip wendet man in Linearbeschleunigern sowie zirkularen Maschinen an (Zyklotron und Synchrotron). Die Teilchen legen in den Beschleunigern sehr lange Wege zurück (CERN-Proton-Synchrotron z.B. 100000 km); sie müssen also unbedingt durch fokussierende Kräfte an die gewünschte Bahn gebunden werden. Vor zehn Jahren entdeckte man das Prinzip der sogenannten «starken Fokussierung» durch alternierende Feld-Gradienten. Ein optisches Analogon besteht aus einer Folge von konvergenten und divergenten Linsen von sich paarweise aufhebender Brechkraft. Trotzdem erfolgt immer eine Fokussierung. Dieses Prinzip hat ungeahnte Fortschritte ermöglicht, indem der Strahlquerschnitt durch die starke Fokussierung so verkleinert werden kann, dass die Magnete viel leichter konstruiert werden können. Dadurch wird es möglich sein, in den nächsten 10 Jahren bis gegen 1000 Milliarden eV vorzudringen. Leider lassen sich diese ungeheuren Energien nur unvollständig ausnützen. Da man auf feststehende Teilchen schiesst, ist die Energie im Schwerpunktssystem - die einzig für eine Wechselwirkung zur Verfügung steht - bei kleinen Energien nur die Hälfte der kinetischen Energie im Laboratoriums-System. Bei relativistischen Geschwindigkeiten (nahe an der Lichtgeschwindigkeit) wächst die verfügbare Energie nur mit der Wurzel der kinetischen Energie. Dies hat zum Vorschlag der kollidierenden Strahlen geführt. Die beschleunigten Teilchen werden dabei in Speicherringen (Synchrotrons) gestapelt. In einer Überschneidungszone können die gegenläufigen Teilchen bei der vollen Energie in Wechselwirkung treten. So werden in Zukunft Energien erreicht werden, die nur noch wenig von den sehr seltenen schnellen Teilchen der kosmischen Strahlung übertroffen werden. Aus den bei diesen höchsten Energien auftretenden neuen Prozessen erhofft man eine tiefere Einsicht in die fundamentale Struktur der Elementarteilchen, aus denen die Materie besteht. (Autoreferat) |
|
| Voss,K. | Neuere Untersuchungen der Verbiegbarkeit von Polyedern und Flächen. | 107,334AR |
| 15. Januar 1962 | Unter einem Polyeder soll hier
eine geschlossene Fläche im Raum verstanden werden, die sich aus endlich
vielen ebenen Polygonen zusammensetzt. Schon in der Elementargeometrie
tritt die Frage auf, ob zwei konvexe Polyeder mit kongruenten Seitenflächen
als Ganzes kongruent sind. Ein Polyeder heisst verbiegbar, wenn es sich
so deformieren lässt, dass alle Seitenpolygone kongruent bleiben,
jedoch die Winkel an gewissen Kanten geändert werden. Eine infinitesimale
Verbiegung ist eine Deformation, bei der alle Polygone, jedoch nicht alle
Kantenwinkel, in 1. Näherung kongruent bleiben.
Alle konvexen Polyeder sind infinitesimal starr (Cauchy). Unter den nichtkonvexen Polyedern gibt es solche, die infinitesimal verbiegbar («wackelig») sind. Hierfür werden einfache Beispiele vom kombinatorischen Typ des Oktaeders angegeben. Diese Polyeder gestatten jedoch keine endliche Verbiegung. Alle «wackeligen Achtflache» sind bereits 1920 von Liebmann bestimmt worden. Schon 1897 hatte Bricard die endliche Verbiegbarkeit der Achtflache vollständig diskutiert: Es gibt zwei Arten von verbiegbaren Achtflachen; in beiden Fällen durchdringen sich jedoch die Seitenpolygone gegenseitig. Verbiegbare Polyeder bilden in der Gesamtheit aller Polyeder einen seltenen Ausnahmefall. Es ist bis heute unbekannt, ob es verbiegbare Polyeder ohne Selbstdurchdringungen gibt. Verlangt man nur, dass die Kantenlängen erhalten bleiben («Stangenpolyeder»), so werden viele Polyeder beweglich (Beispiel :Würfel). Unterteilt man jedoch die Polygone eines konvexen Polyeders in Dreiecke, so erhält man ein infinitesimal starres Gerüst. Dieser Satz ist für die Realisation eines abstrakt gegebenen Eulerschen Dreieckspolyeders mit gegebenen Kantenlängen und Konvexitätsbedingung der Ecken von Bedeutung (A. D. Alexandrov). Bei Flächen im Raum mit stetiger Tangentialebene und Krümmung (also ohne Ecken und Kanten) sind die isometrischen (längentreuen) Abbildungen und die Verbiegungen (längentreuen Deformationen) von besonderem Interesse, da sie die Form der Fläche im Raum verändern, jedoch nicht die innere Geometrie der Fläche im Sinne der Längen- und Winkelmessung. Die lokale Verbiegbarkeit genügend kleiner Flächenstücke ist heute weitgehend geklärt: Die Flächen mit positiver Gaussscher Krümmung K verhalten sich wesentlich anders als die mit negativem K (Unterschied zwischen elliptischen und hyperbolischen Differentialgleichungen). Die Umgebung eines Punktes auf der Fläche F, der nicht Flachpunkt ist, lässt sich stets verbiegen, und jede zu F isometrische Fläche lässt sich entweder in F oder in das Spiegelbild von F verbiegen. Dagegen haben Untersuchungen von H. Hopr, Schilt, Efimov und Hoesli die merkwürdige Tatsache ergeben, dass es Flächen mit Flachpunkt gibt, die sich überhaupt nicht verbiegen lassen und ausserdem keine andere Flachpunktrealisation besitzen. Insbesondere gibt es isometrische Flächenstücke, die sich nicht ineinander verbiegen lassen. Über die globale Verbiegbarkeit einer Fläche als Ganzes ist heute u.a. folgendes bekannt: Geschlossene Flächen mit positivem K (Eiflächen) sind infinitesimal starr; isometrische Eiflächen sind kongruent. Jedoch wird eine Eifläche verbiegbar, wenn man ein beliebig kleines Loch anbringt. Offene vollständige Flächen mit positivem K sind verbiegbar oder starr je nachdem, ob die Totalkrümmung kleiner oder gleich 2 Pi ist. Cohn-Vossen (1929) und Rembs (1952) haben nichtkonvexe geschlossene Flächen mit nirgends identisch verschwindender Infinitesimal-Verbiegung gefunden und damit auch isometrische, aber nichtkongruente Flächenpaare, die nirgends zusammenfallen. Neuerdings gelang es zu zeigen, dass eine vollständige konvexe Fläche nicht isometrisch sein kann zu einer nicht-konvexen Fläche (im Gegensatz zur Situation bei Polyedern, bei denen Kanten auftreten, so dass man durch Spiegelung eines Teils der Fläche solche Isometrien erzeugen kann). Weitere Fortschritte hat die Theorie von A. D. Alexandrov geliefert, welche die konvexen Polyeder und Flächen unter einem gemeinsamen Gesichtspunkt zu behandeln gestattet. (Autoreferat) |
|
| Oehler,E. | Zytogenetik der Getreidearten. | 107,335-336AR |
| 29. Januar 1962 | Der Tribus Hordeae der Gramineen
umfasst die Gruppe der Triticinae mit den Gattungen Triticum (Weizen),
Secale (Roggen), Aegilops, Haynaldia und Agropyrum (Quecke) sowie diejenigen
der Hordeinae mit Hordeum (Gerste), Elymus, Sitanion und Hystrix.
Aus zahlreichen Kreuzungsversuchen geht hervor, dass sich alle Arten der Gattungen Triticum, Secale, Aegilops und Haynaldia miteinander verbinden lassen. Von den Agropyrumarten können einige mit Vertretern der Triticinae, andere mit solchen der Hordeinae gekreuzt werden. Innerhalb der Hordeinae sind Artkreuzungen schwer herzustellen und entsprechende Bastarde erst wenige bekannt. Die Chromosomengrundzahl der Hordeae beträgt n 7. Die Arten der meisten Gattungen bilden polyploide Serien mit diploiden, tetraploiden, hexaploiden, selten oktoploiden oder dekaploiden Gliedern. Aus den Paarungsverhältnissen der Chromosomen während der Reduktionsteilung der F1Bastarde können die gegenseitigen Beziehungen der miteinander in Verbindung getretenen Genome ermittelt werden. Es geht aus zahlreichen Untersuchungen dieser Art hervor, dass die höherchromosomigen Arten der Hordeae Additionsbastarde niedrig-chromosomiger Arten der gleichen oder anderer Gattungen darstellen. So sind z.B. die tetraploiden Weizenarten (Genome AB) aus Kreuzungen zwischen diploiden Weizen (Genome A) und Aegilops speltoides (B), die hexaploiden (ABD) aus tetraploiden Weizen (AB) und Aegilops squarrosa (D) hervorgegangen. Die Gattung Secale sowie die Untergattung Cerealia von Hordeum enthalten nur diploide Arten. Durch Colchizinbehandlung konnten experimentell bei beiden Gruppen autotetraploide Rassen hergestellt werden mit grösseren kräftigeren Organen (Stengel, Blätter, Ähren, Körner), deren Fertilität jedoch gegenüber den Ausgangsrassen vermindert ist. Bei der allohexaploiden Art Triticum aestivum (gewöhnlicher Saatweizen) sind aneuploide Formen mit je einem fehlenden oder überzähligen Chromosom oder Chromosomenpaar (mono-, nulli-, tri-, tetrasome Linien) lebensfähig. Kreuzungsversuche zwischen solchen Formen ergeben, dass die Chromosomen der drei Weizengenome einander entsprechende Gene enthalten und wahrscheinlich aus einem gemeinsamen Urgenom abgeleitet werden können. Die Analyse solcher aneuploider Formen erlaubt, eine Lokalisation der Gene auf die verschiedenen Chromosomen vorzunehmen. In der F1 eines Artbastardes können sich die artfremden Chromosomen nur paaren, wenn sie einander homolog sind. Ungepaart bleibende sogenannte univalente Chromosomen führen zur Bildung von Gonen mit sehr variablen Zahlen, von denen nur ein Teil entwicklungsfähig ist. Nach starken Störungen entstehen pollensterile Pflanzen, aus denen nur nach Rückkreuzungen Nachkommenschaft gebildet werden kann. Die Formbildungsmöglichkeiten in den Nachkommenschaften von Art- und Gattungsbastarden hängen ganz von den Homologiebeziehungen der elterlichen Genome ab. Ist auch nur ein Teil der elterlichen Genome einander homolog, können konstante, euploide, fertile Kombinationstypen durch Genaustausch gebildet werden. Beim Fehlen jeglicher Homologiebeziehungen werden jedoch solche Formen nur durch Ein- oder Anlagerung ganzer artfremder Chromosomen oder Chromosomen-stücke gebildet werden können. Solche Substitutions- und Additionsformen besitzen in der Regel eine leicht verminderte Vitalität und Fertilität. Durch die Vereinigung sämtlicher elterlicher Genome, verbunden mit einer Verdoppelung der Chromosomenzahl, entstehen konstante, fertile Amphidiploide genannte neue synthetische Arten. Innerhalb der Hordeae sind bis heute 188 solcher Formen bekannt geworden, die für die Züchtungsforschung theoretisch wichtige Kombinations- und Verbindungsglieder darstellen. (Autoreferat) |
|
| Jost, Alfred | Recherches sur le controle de la charge en glycogène du foie fatal. | 107,336AR |
| 12. Februar 1962 |
Recherches sur le contrôle endocrinien de la charge en glycogène du foie fétal Dans le problème analyse' au cours de cet expose'
deux glandes endocrines jouent un rôle essentiel, la cortico-surrénale
et l'hypophyse; il est utile de rappeler que ces deux glandes ont une activité
physiologique chez le ftus. On peut par exemple montrer l'existence d'interrelations
entre les deux glandes: ainsi l'hypophysectomie du fétus (par décapitation)
provoque une atrophie de la corticosurrenale que l'injection de corticostimuline
au ftus répare. L'atrophie de a cortico-surrénale f~tale
peut aussi être produite par l'injection d'un excès de cortisone
au f~tus; dans ce cas l'hypophyse est mise au repos par un mécanisme
de «feed back».
|
|
| Niggli,A | Erweiterungen des kristallographischen Symmetriebegriffes. | 107,337AR |
| 26. Februar 1962 | Trotzdem die 32 Kristallklassen
und 230 Raumgruppen als Werkzeug des Kristallographen längst bekannt
sind, ist die Symmetrielehre als Forschungsgebiet in den letzten zehn Jahren
angeregt durch neue Anwendungsmöglichkeiten vor allem in der Festkörperphysik
- wieder in Fluss geraten. (Grundgedanke: H. Heesch, Z. Krist. 73 (1930),
325; russische Schule mit Schubnikow, Below u. a.; in der Schweiz vor allem
von kristallographischer Seite das Zürcher Hochschulinstitut, von
mathematischer Seite J. J. Burckhardt und B. L. v. d. Waerden.)
Für den Kristallographen stellt sich die klassische Symmetrie als Gruppe von Decktransformationen (Verschiebungen, Drehungen, Spiegelungen und Kombinationen davon) dar, die ein Gebilde so in sich selbst überführen, dass der Endzustand vom Anfangszustand nicht zu unterscheiden ist. Dadurch wird Gleichartiges wiederholt, das heisst vorgegebene Elemente (Punkte, Gerade, Ebenen, oder Atome, Ionen, Moleküle) werden vervielfacht. Eine interessante Verallgemeinerung besteht nun darin, den symmetrieverknüpften Punkten des Raumes eine Eigenschaft zuzuordnen, die sich - gekoppelt mit den klassischen Symmetrieoperationen - gesetzmässig verändert. Erfolgt diese Veränderung einsinnig, so resultiert eine Polarität, die unendlich fortgesetzt werden kann (z. B. sich verjüngende Blätter eines Zweiges); interessanter sind zyklische Veränderungen, die nach endlich vielen Schritten zum Anfangszustand zurückführen. Ist die zugeordnete Eigenschaft als reelle Funktion aufzufassen, so führt der Vorzeichenwechsel als Veränderung (Zyklen der Ordnung 2) zur Antisymmetrie, die wegen der anschaulichen Darstellungsmöglichkeit auch Schwarzweiss-Symmetrie genannt wird. Ein grösserer Wertevorrat der Eigenschaftsveränderung führt analog zu Farbsymmetrien; in diesem Fall wird die zugeordnete Eigenschaft durch eine komplexe Funktion (Exponentialfunktion mit komplexem Argument) beschrieben. Auch kompliziertere Fälle sind denkbar, in denen die zugeordnete Eigenschaft durch mehrdimensionale Matrizen dargestellt werden muss. Da die Eigenschaftsveränderung aber immer gesetzmässig verläuft, wird die zugrundeliegende klassische Symmetrie nicht einfach zerstört oder vermindert; sie ist in versteckter Form stets noch vorhanden, was zur Prägung des Begriffes der Kryptosymmetrie für derartige Verallgemeinerungen geführt hat. Beispiel einer Antisymmetrie: Der durch Aneinanderreihung nach zwei Richtungen das (unendlich fortgesetzt gedachte) Muster eines Schachbretts liefernde Elementarbereich ist ein etwa durch die Mittelpunkte der vier um ein weisses herumliegenden schwarzen Felder begrenztes Quadrat. Dieses ist antizentriert, weil die Verschiebung um eine halbe Diagonale das Muster unter Farbwechsel in sich selbst überführt. In den Feldermitten liegen vierzählige Drehpunkte, das heisst die Drehung um Vielfache von 900 ist Symmetrieoperation; in den Felderecken liegen vierzählige, in den Mitten der Felderkanten zweizählige Anti-Drehpunkte. Parallel den Felderkanten verlaufen abwechslungsweise Spiegelgerade und Gleitspiegelgerade, parallel den Felderdiagonalen abwechslungsweise Spiegelgerade und Anti-Gleitspiegelgerade. All das bildet eine der 46 möglichen ebenen, zweifach-periodischen Antisymmetriegruppen, die den 17 klassischen Symmetriegruppen etwa der Tapetenmuster entsprechen. An kristallographischen Möglichkeiten (Beschränkung auf 2-, 3-, 4- und 6zählige Drehungen, da nur diese mit den zur Gitterstruktur der Kristalle führenden Verschiebungen verträglich sind) bietet der dreidimensionale Raum folgende Anzahlen: den 32 Punktsymmetriegruppen (Kristall-klassen) entsprechen 58 Antisymmetriegruppen, den 75 einfach-periodischen Balkengruppen deren 244, den 80 zweifach-periodischen Schichtgruppen deren 370 und den 230 dreifach-periodischen Raumgruppen deren 1191. Übrigens werden auch mehrfache, die gleichzeitig nach verschiedenen Gesetzen erfolgende Veränderung mehrerer Eigenschaften beschreibende Kryptosymmetrien untersucht. In der Kristallographie werden Schwarzweiss- und Farbsymmetrien heute zur Beschreibung gesetzmässig verwachsener Zwillinge und Viellinge sowie zur Klassifikation von Strukturtypen verwendet. Die Verrückungsvektoren der Normalschwingungen etwa von Molekülen lassen sich anschaulich durch Kryptosymmetrien darstellen, und die Beschreibung antiferromagnetischer Strukturen stützt sich zur Erfassung der antiparallelen Richtungen magnetischer Momente auf die Antisymmetriegruppen. Da allgemein in der Kristallphysik die meisten Eigenschaften eines Stoffes durch Tensoren charakterisiert werden, sind die Kryptosymmetrien das geeignete Werkzeug zur Beschreibung der Eigensymmetrie und des Verhaltens dieser Tensoren in den symmetrischen Räumen der Kristalle. Anwendungen von Anti- und Farbsymmetrien auf die bildende Kunst finden sich vor allem im Werk von M. C. Escher (Grafiek en Tekeningen; Zwolle 1960, J. J. Tijl N. V.). Wenn man bei diesen Erweiterungen des klassischen Symmetriebegriffes auch nicht mehr von einer Wiederholung von Gleichartigem oder gar Ununterscheidbarem sprechen kann, so behält doch auch für sie die Definition Pascals immer noch ihre Gültigkeit: symétrie, en ce qu'on voit d'une vue, fondée sur ce qu'il n'y a pas de raison de faire autrement. (Autoreferat) |
|
| Bünning,E. | Physiologische Zeitmessvorgänge. | 107,338AR |
| 28. Mai 1962 | Schon seit sehr langer Zeit ist
bei Pflanzen und Tieren das Vorkommen von Phänomenen bekannt, die
an den Gang der Uhr erinnern. Es bestehen physiologisch selbst gesteuerte,
also auch noch unter konstanten Bedingungen weiter laufende ungefähr
tagesperiodische Schwingungen. Erst die gegenwärtig verfügbaren
experimentellen Hilfsmittel aber haben es gestattet, einerseits diese Schwingungen,
andererseits ihre tatsächliche Nutzung zur biologischen Zeitmessung
exakt zu erfassen.
Die Schwingungen äussern sich in vielen peripheren Vorgängen, also gleichsam in «Uhrzeigern»: in periodischen Stoffwechselvorgängen, Bewegungen, Aktivitätsschwankungen usw. Die frei laufenden, das heisst nicht mehr vom Licht-Dunkel-Wechsel oder anderen äusseren Zeitgebern hinsichtlich Phasenlage und Periodenlänge gesteuerten Schwingungen zeigen Perioden von meist etwa 23-25 Std. Die individuenspezifische Periode kann aber oft mit einer Genauigkeit von wenigen Minuten eingehalten werden. Überraschenderweise haben diese physiologischen Uhren im Gegensatz zu anderen physiologischen Prozessen nur eine sehr geringe Temperatur-Abhängigkeit, mit Q10 -Werten, die meist zwischen 0,9-1,1 oder noch engeren Grenzen liegen. Dieser Rhythmik liegen möglicherweise Oberflächenreaktionen im Cytoplasma zugrunde. Dafür sprechen zum Beispiel starke Wirkungen von schwerem Wasser und von Alkoholen. Nach dem Verhalten beim Unterbinden der Energiezufuhr zu urteilen und auch nach anderen Kriterien gehören die Schwingungen zum Typ der Kippschwingungen. Genutzt wird die physiologische Uhr von Pflanzen und Tieren nicht nur zur sinnvollen Einordnung der einzelnen Leistungen in die geeignete Tageszeit, sondern (von Tieren) zum Beispiel zur Berücksichtigung der Tageszeit bei der Benutzung eines Sonnenkompasses. Pflanzen und Tieren dient die Uhr ausserdem zur Tageslängenmessung und damit zur Einordnung der Entwicklungsvorgänge in den Gang der Jahreszeiten. Selbst die Einordnung physiologischer Prozesse in den Gezeitenwechsel wird durch ähnliche Schwingungen möglich. Durch das Zusammenwirken dieser physiologischen Gezeitenrhythmik mit der Tagesrhythmik wird offensichtlich infolge des Eintretens von «Schwebungen» auch die bisher als fast mysteriös geltende Einordnung von Entwicklungsvorgängen bei Meeresorganismen in die lunaren Zyklen verständlich. (Autoreferat) |
|
| Verschiedene | Buchbesprechungen | 107,339-356 |
| J. Wellauer
A.Ribi M.Waldmeier Karl Theiler
H.C.Curtius R. Cramer
N.Pavoni
|
Babaiantz, L. und Cardis, F.:
Die Röntgendiagnostik der Lunge 339 Bauer, K. Fr., Erlangen: Medizinische Grundlagenforschung 339 Becker, Fr. und Ruppel, W.: Vier Jahre Radioastronomie an der Universität Bonn - Grosse Richtantennen 340 Bucher, O.: Histologische und mikroskopische Anatomie des Menschen 341 Christen, H.-R.: Chemie 341 Frömming, E.: Das Verhalten unserer Schnecken zu den Pflanzen ihrer Umgebung 342 Gurtner, O., Hofmann, F. und Suter, H.: Sprechende Landschaft 343 Hadorn, E.: Experimentelle Entwicklungsforschung an Amphibien 344 Hawker, L. E., Linton, A. H., Folkes, B. F. und Carlile, M. J.: Einführung in die Biologie der Mikroorganismen 344 Heidermanns, C. und Kirschner, Inge: Die Ausscheidung von Wirkstoffen im Harn von Wild- und Nutztieren 345 Huber, B.: Grundzüge der Pflanzenanatomie 346 Israel, H. und Krebs, A.: Kernstrahlung in der Geophysik 347 Lessing, L. P.: Verständliche Chemie 347 Neugebauer, 0.: The astronomical tables of Al-Khwärizmi 348 Polya, G.: Mathematik und plausibles Schliessen 349 Scheidegger, A. E.: Theoretical geomorphology 350 Schwarzenbach, F. H.: Botanische Beobachtungen in der Nunatakkerzone Ostgrönlands zwischen 74° und 75° n. Br 352 Suter, H. und Hantke, R.: Geologie des Kantons Zürich 352 Vogel, F.: Lehrbuch der allgemeinen Humangenetik 353 Sitzungsberichte der Gesellschaft Naturforschender Freunde zu Berlin 356 |
|